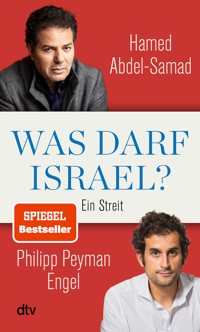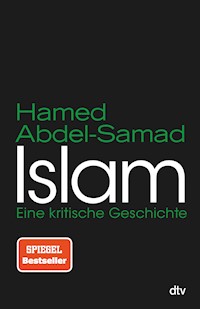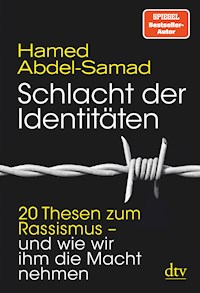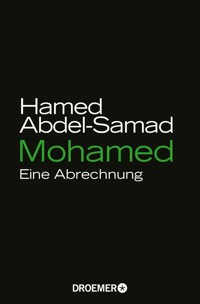9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der SPIEGEL-Bestseller jetzt im Taschenbuch Deutschland hat eine Tradition der Aufklärung – und eine der Inhumanität. Demokratie, Meinungsfreiheit, Pluralität haben uns die Alliierten gebracht. Es ist an der Zeit, sich dieser Werte bewusst zu werden und dafür einzustehen. Kaum jemand weiß besser als Hamed Abdel-Samad, welches hohe Gut die in Deutschland gelebte Liberalität ist. Er beobachtet aber seit Jahren eine toxische Tendenz des öffentlichen Klimas, die freie, streitbare Diskursethik, Grundlage jeder demokratischen Auseinandersetzung, gegen eine engstirnige und antiaufklärerische Gesinnungsethik einzutauschen. Es bedarf vielleicht eines zugewanderten Deutschen, der seinen Landsleuten klarmacht, wie kostbar und wie wenig selbstverständlich diese Errungenschaften sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
»Ich möchte Ihnen mein Deutschland näherbringen. Ich will Ihnen erklären, was ich an diesem Land so schätze, will Ihnen aber auch meine Sorgen über das, was gerade in Deutschland geschieht, nicht vorenthalten. Ich halte es für meine Bürgerpflicht, Gedanken über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieses Landes mit anderen auszutauschen – als Teil eines Dialogs, der dringend nötig ist, um die gegenwärtigen Herausforderungen zu meistern. Alle, die diesen ehrlichen Dialog durch Demagogie, Gesinnungsethik, Moralisierung, Maulkörbe und Denkverbote behindern, fügen dem Land großen Schaden zu und hindern es daran, seine Potenziale zu entfalten.
Ich habe diesem Buch den Titel ›Aus Liebe zu Deutschland‹ gegeben. Aus Dankbarkeit für die Freiheit, die ich hier genießen darf, aber auch aus Sorge um den inneren Frieden und die Errungenschaften dieses Landes, die wir nicht leichtfertig verspielen sollten. Wir müssen gewappnet sein, um Gefahren von außen wie von innen abwehren zu können.«
Einführung
In diesem Jahr feiert Deutschland dreißig Jahre deutsche Einheit. Auch für mich ist dieses Jahr ein besonderes. Meine Ankunft in Deutschland jährt sich zum 25. Mal. 1995 betrat ich, aus Ägypten kommend, erstmals deutschen Boden. Seitdem ist viel passiert. Mit mir, mit Deutschland und mit meiner Beziehung zu diesem Land. Ich wurde ein freier Mensch, der sich aus der Umklammerung der Religion mit all ihren Zwängen lösen konnte. Ich wurde ein freier, aber auch unbequemer Denker, ein freier, aber auch ein bedrohter Schriftsteller, der von Personenschützern begleitet werden muss. Das Land wurde in den vergangenen 25 Jahren bunter, diverser, liberaler. Und dann langsam immer polarisierter. Aus der Polarisierung wurde mit der Zeit eine tiefe Spaltung. Eine Spaltung, die zunehmend den gesellschaftlichen Frieden bedroht und die Errungenschaften dieses Landes gefährdet.
Meine Beziehung zu Deutschland verlief in mehreren Etappen: Da waren zunächst die Faszination und das Interesse an diesem Land aus der Ferne, ich war ein Betrachter von außen. Dann kam die Hoffnung auf einen Neubeginn in diesem Land, gefolgt von Überforderung, Skepsis und Enttäuschung. Auf Angst und Hadern folgte langsam das Verstehen, das Bekenntnis zu Deutschland, die Identifikation mit seinen Wunden wie mit seinen Erfolgen, mit seiner Geschichte, seinen Stärken und Schwächen und mit seinen Werten. Diese letzte Stufe der Entwicklung meiner Beziehung zu Deutschland mündete in Liebe und Verbundenheit, trotz aller Probleme, die das Land hat, und die umgekehrt auch ich mit diesem Land immer noch habe.
Ich liebe dieses Land mit all seinen Fehlern, Brüchen, Widersprüchen und Narben. Ich unterscheide nicht zwischen einem hellen und einem »Dunkeldeutschland«, nicht zwischen »Gutmenschen« und Patrioten. Ich suche mir aus der Geschichte keine dunklen Jahre und keine Sternstunden heraus, um Deutschland daran festzumachen oder es darauf zu reduzieren. Deutschland ist das Produkt all dessen, was auf seinem Boden geschah, und es ist die Summe aller Menschen, die hier leben. Es gibt für mich nur ein Deutschland, das viele Gesichter hat und viele Widersprüche in sich vereint. Diese Widersprüche zu verstehen, sie auszuhalten und daran zu wachsen, macht für mich persönlich Deutsch-Sein aus.
Vielleicht sind es gerade diese Widersprüche, die Deutschland für mich zu einem Land der Inspiration und der Hoffnung machen. Früher hatte ich fast jeden Tag ein neues Bild von Deutschland und den Deutschen. An guten Tagen, an denen ich mit mir und mit meinen Leistungen zufrieden war, erschienen mir die Deutschen zuvorkommend, höflich und weltoffen. An Tagen, an denen ich mit mir und mit meinem Leben haderte, waren sie arrogante Rassisten, die unter sich bleiben wollten und ein Problem mit Ausländern hatten. Kam ich gerade aus Ägypten zurück, waren die Deutschen für mich viel zu hektisch und zu durchorganisiert. Kam ich aber aus Japan zurück, erschienen sie mir eher langsam und unpünktlich. Erlebte ich sie bei der Arbeit, wirkten sie mir zu ernst und verbissen. Traf ich sie beim Spaziergang im Wald, waren sie gelöst und aufgeschlossen. Ich vermochte nicht, sie zu greifen, so unterschiedlich erschienen mir diese Deutschen, je nach Ereignis oder Situation. Dass dabei auch ich, meine Ängste und Unsicherheiten, eine Rolle spielten, kam mir lange nicht in den Sinn. Ich sah, was ich bestätigt sehen wollte, im Positiven wie im Negativen.
Erst als ich aufhörte, Deutschland als Projektionsfläche für meine eigenen Ängste und für meine Unzufriedenheit zu nutzen und überzogene Erwartungen zu hegen, entdeckte ich erstaunliche Sachen – über dieses Land und über mich selbst. Ich stellte fest, dass Deutschland mir sehr ähnlich ist. Wir haben beide einen sehr langen Weg zu uns selbst zurückgelegt. Ein Weg, der von Selbstüberschätzung, Zerrissenheit, Wut, Aggression, Selbsthass und Schuldgefühlen, aber auch von Selbstkritik, Selbstverantwortung und Selbstüberwindung gekennzeichnet ist. Wir haben beide eine Art frühkindliche Störung und ein Trauma erlitten, das bis heute posttraumatische Verhaltensstörungen mit sich bringt. Wir waren beide lange stark auf das Unheil in unserer Geschichte fixiert und versuchten, auf seinen Trümmern eine Identität und ein Wertesystem zu errichten, das sich vor allem in Abgrenzung zum Vergangenen definiert. Wir neigten beide in der Vergangenheit dazu, von einem Extrem ins nächste zu wechseln. Aber wir beide wagten es auch, uns für die westlich-freiheitliche Lebensweise zu öffnen, obwohl unsere früheren Identitäten gleichsam als Antithese dazu galten. Wir wagten beide den Wandel und zerbrachen nicht an den Veränderungen, obwohl wir immer noch verwundbar sind.
Wenn ich heute sage: »Ich bin Deutschland«, dann meine ich das auf einer anderen Ebene als viele Menschen, die sich mit Deutschland identifizieren. Es ist für mich nicht Ausdruck von Nationalismus oder Patriotismus, sondern Ausdruck der vielen gegensätzlichen Erfahrungen, die dieses Land zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und wenn ich sage: »Ich liebe Deutschland«, dann ist das in gewisser Weise auch ein Liebesbekenntnis an mich selbst. Deshalb wird dieses Buch auch zwischen politisch-historischer Analyse und Berichten über meine persönlichen Erlebnisse in und mit Deutschland wechseln. Ich habe in den vergangenen 25 Jahren Deutschland aus zwei Perspektiven kennengelernt. Aus der des Ausländers, der sich zunächst durch die Beschäftigung mit den üblichen Kulturklischees Zugang zur deutschen Identität verschaffen wollte: Ich hörte Wagner und Beethoven, probierte Schwarzbrot und Hefeweizen, lauschte Volksliedern, beschäftigte mich mit Goethe und Schiller, mit der wechselvollen Geschichte, mit Fußball und dem Wald. Je länger ich hier lebte, umso mehr wechselte die Außensicht einer Innensicht. Ich versuchte zu verstehen, was die »deutsche Seele« ausmachte. Heute bin ich deutscher Staatsbürger, mein Wissen über dieses Land ist in Teilen erlebt, in Teilen durch die Beschäftigung mit Literatur, Philosophie und geschichtlichen Werken »erlesen«. Weil ich in einer anderen Kultur sozialisiert wurde, habe ich mit manchen Dingen weniger Probleme als meine deutschen Freunde. Mit Begriffen wie Nation, Identität, Heimatliebe oder dem, was gemeinhin als deutsch gilt. Ich habe aber auch kein Problem damit, das Wertesystem und die Errungenschaften dieses Landes als etwas sehr Positives hervorzuheben und die Notwendigkeit eines gemeinsamen Konzepts für das Zusammenleben zu betonen. Wenn westlich-liberale Wertvorstellungen mit dem Verweis auf Multikulturalismus ausgehebelt werden, habe ich damit ein Problem.
Ich möchte Ihnen, liebe Leser, mein Deutschland näherbringen. Ich will Ihnen erklären, was ich an diesem Land so schätze, will Ihnen aber auch meine Sorgen über das, was gerade in Deutschland geschieht, nicht vorenthalten. Ich halte es für meine Bürgerpflicht, meine Gedanken über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieses Landes mit anderen auszutauschen – als Teil eines Dialogs, der dringend nötig ist, um die gegenwärtigen Herausforderungen zu meistern. Alle, die diesen ehrlichen Dialog durch Demagogie, Gesinnungsethik, Moralisierung, Maulkörbe und Denkverbote behindern, fügen dem Land großen Schaden zu und hindern es daran, seine Potenziale zu entfalten.
Ich habe diesem Buch den Titel »Aus Liebe zu Deutschland« gegeben. Aus Dankbarkeit für die Freiheit, die ich hier genießen darf, aber auch aus Sorge um den inneren Frieden und die Errungenschaften dieses Landes, die wir nicht leichtfertig verspielen sollten. Wir müssen gewappnet sein, um Gefahren von außen wie von innen abwehren zu können. Dafür müssen wir uns aber bewusst werden, was Deutschland wirklich ausmacht. Was Deutsch-Sein bedeutet und was Deutschland – über die Zeitläufte hinweg – im Innersten zusammenhält. Wir müssen uns die Frage stellen, woher plötzlich die starke Polarisierung kommt, die unsere Gesellschaft spaltet und lähmt. Wir müssen uns fragen, welche Werte für uns noch unverrückbar sind und wie wir mit dem gewachsenen Einfluss von Islamisten umgehen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie es zu dem starken Aufschwung von Populisten und Rechten kommen konnte und welche Rolle die Diskursverengung durch die politische Linke dabei spielt.
Es gibt ein ganzes Bündel an Fragen, auf die ich versuchen möchte, eine Antwort zu finden. Manche stehen für sich, andere hängen miteinander zusammen, sind Folge von oder bedingen einander. Die dahinterliegenden Probleme aber können – ungelöst – alle eine toxische Wirkung für die Gesellschaft entfalten. Es geht um Fragen, wie die folgenden: Wie kam es zu dieser vergifteten Streitkultur einerseits und zum Schweigen der vielen in der Mitte andererseits? Ist die Meinungsfreiheit wirklich in Gefahr, oder glauben viele Deutsche immer weniger an Freiheit und Demokratie? Warum wird das Land immer attraktiver für Migranten und Flüchtlinge, während gebildete Eliten und qualifizierte Fachkräfte einen Bogen um Deutschland machen? Warum finden viele eine Willkommenskultur gut, eine Leitkultur aber dumpf, nationalistisch und rassistisch? Tatsächlich haben wir viele Sub-Leitkulturen, die ideologisch den Ton bei den Debatten angeben, wie etwa die linksliberale, die rechtskonservative und auch die islamische, die jede für sich Exklusivität und Allgemeingültigkeit zugleich beanspruchen. Wir brauchen stattdessen eine gesamtdeutsche Leitkultur, die auf gemeinsamen Werten, nicht auf ideologischen oder gar religiösen Fundamenten basiert. Eine Leitkultur, die das Verbindende betont, statt das Trennende zu feiern. Ohne diese Leitkultur macht eine Willkommenskultur keinen Sinn, denn eine unsichere Identität lädt diejenigen, die neu dazukommen, nicht zu Integration und Teilhabe ein, sondern ermutigt sie zu Rückzug und Abgrenzung.
Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft angesichts der großen Herausforderungen, vor denen sie steht? Wie umgehen mit der noch immer nicht verarbeiteten und bewältigten Flüchtlingskrise des Jahres 2015 und all dem, was mit ihr einherging? Wie umgehen mit der nächsten Welle, mit den Menschen, die unter unwürdigen Umständen in Lagern in der Türkei und in Griechenland ausharren, die in Syrien immer mehr zwischen die machtpolitischen Fronten geraten, während man in Brüssel vergeblich europäische Solidarität anmahnt? Wie umgehen mit dem wiedererstarkenden Antisemitismus, mit Ausgrenzung und Hass in den sozialen Medien und im Alltag? Wie umgehen mit der Verachtung, die denen »da oben« entgegenschlägt, Vertretern der Politik und Zivilgesellschaft, die immer mehr zur Zielscheibe werden, die bedroht werden und sogar ihr Leben verlieren?
Mit all diesen Fragen im Gepäck bin ich durch die Republik gereist und habe mit Politikern, Wissenschaftlern, Historikern, Künstlern und Intellektuellen geredet. Ich habe ihnen von meinem Deutschland berichtet und mit ihnen darüber diskutiert, wie sie das Land heute sehen. Wie hat es sich in der vergangenen Dekade verändert? Wofür steht es? Und wohin steuert es?
Ich habe gegenüber den meisten Deutschen den Vorteil, dass ich die Entwicklung des Landes aus der Distanz verfolgen und dennoch Teil des Prozesses sein kann. Ich gehöre nicht zu jenen Migranten, die nur das Gute in Deutschland erkennen und es als gelobtes Land sehen; ich gehöre aber auch nicht zu jenen, die ständig Forderungen stellen und über das, was ihnen hier nicht gefällt, meckern, ohne einen Beitrag zur Lösung zu leisten. Ich kann das Gute sehen und schätzen, möchte aber auch die Probleme thematisieren, die dieses Gute bedrohen. Ich möchte versuchen zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Das Verstehen, der Prozess des Bewusstwerdens, verhindert einen einseitigen Blick. Und es bremst Verbitterung und Wut ebenso wie Selbstgefälligkeit und Hybris.
Ob politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich – Deutschland hat außergewöhnlich viel geschafft, und die Menschen, die dazu einen Beitrag geleistet haben, können sehr stolz auf sich sein. Das Land musste mehrere Traumata durchleben, um sein Gleichgewicht zu finden. Doch dieses Gleichgewicht droht jetzt aus der Balance zu geraten. Das hängt mit Problemen zusammen, die sich wie die Glieder einer Kette aneinanderfügen: Eine Vergangenheit, die nicht vergeht, und eine Zukunft, die Angst macht. Eine fehlende gemeinsame Identität, die in der Vergangenheit zu Selbstüberschätzung und Narzissmus führte. Man wollte einen Platz an der Sonne und bekam die Niederlage im Ersten Weltkrieg und den Vertrag von Versailles gleich obendrauf. Die Folge war eine gekränkte Nation, die die Kränkung mit noch mehr Narzissmus und Aggression zu bekämpfen versuchte. Die Gräuel des Zweiten Weltkriegs erzeugten erst Verdrängung und Schweigen, dann Schuldgefühle.
Wenn Schuldgefühle eine Debatte hemmen oder steuern, ist eine sachlich-rationale Analyse unmöglich. Wenn wir gut sein wollen, nur weil wir das Bild des »bösen Deutschen« fürchten, haben wir nicht die richtigen Schlüsse gezogen, sondern eine Erinnerungskultur hervorgebracht, die mäandert zwischen »nie wieder« und einer Erinnerungsabwehr in Sinne von »nun muss aber mal gut sein«.
Die Folgen eines emotional und verengt geführten Diskurses sind eine zunehmende Spaltung und Polarisierung, und falsche Schlussfolgerungen und Entscheidungen, beispielsweise in der Migrationspolitik. Aber auch bei anderen Themen – bei der Umweltpolitik, bei Fragen zu Europa und dem Euro, zur Corona-Krise oder dem Umgang mit der AfD etwa – findet ein offener und sachlicher Diskurs immer weniger statt. Abweichende Meinungen werden zunehmend nicht nur ignoriert, sondern als Gefahr dargestellt, was wiederum zu noch mehr Spaltung und Entfremdung führt. Selbst viele Politiker tappen in die Moralisierungsfalle, statt klare Konzepte und Visionen zu entwickeln. Bei vielen entscheidenden Themen, die unsere Gesellschaft in Zeiten des Wandels verunsichern, mahnen und warnen Wissenschaftler, statt zu analysieren. Journalisten belehren, statt neutral zu berichten. Und jeder hat Angst vor jedem: Die Rechten vor dem Islam und der »Überfremdung«, die Muslime vor dem Verlust ihrer Identität, die Parteien der Mitte vor dem Rechtsruck, die Grünen vor dem Klimawandel. Die Linken haben Angst vor dem entfesselten Kapitalismus, die Rechten vor der Ökodiktatur. Jeder hat seine Apokalypse als Wegweiser vor Augen und meint, seine Apokalypse sei die größte und wahrhaftigste. Angst und Polarisierung verhindern einen Verständigungsprozess über die gemeinsamen Werte und die Art, wie die großen Herausforderungen gemeistert werden können.
»Nazi«, »Klimaleugner«, »Merkel-Versteher«, »Pack«, »Corona-Leugner«, »Islamphobiker«, »Verschwörungstheoretiker« … solche Begriffe geben die Seiten vor, auf denen jemand vermeintlich steht, sie dominieren den Diskurs und machen den notwenigen Verständigungsprozess unmöglich. Denn jede Seite definiert sich durch die Abgrenzung zur jeweils anderen, die gleichzeitig als Gefahr dargestellt wird. Die Art und Weise, wie Diskussionen in den sozialen Netzwerken und in den Kommentarspalten mancher Zeitungen geführt werden, zeigen, wie düster es um die Debattenkultur im Land bestellt ist. Man muss nur Begriffe wie »Klima«, »Greta«, »Flüchtling«, »Islam«, »Brexit«, »Corona«, »Trump«, »Merkel« oder den Namen eines anderen Politikers, egal aus welchem Lager, nennen, dann wird sofort mit Leidenschaft verspottet, unterstellt und gedroht. Aus allem wird ein Politikum, selbst aus der Wahl des Christkindes in Nürnberg, weil das Mädchen einen Migrationshintergrund hat. Ein Satiriker wird gemobbt, weil er das Auftreten von Greta Thunberg bei der UN kritisiert. WDR-Redakteure bekommen Morddrohungen, weil der Kinderchor des Senders ein satirisches Lied singt, das Omas für den Klimawandel verantwortlich macht. Als der »Umweltsau-Song« aus dem Netz genommen wird, wogt die nächste Empörungswelle hoch – gegen die »Einknicker« beim Sender.
Gerade im Netz scheinen viele Nutzer geradezu zwanghaft dem Reflex folgen zu müssen, unausgereifte und unreife Gedanken, infantile Emotionen und jede Menge Hass und diffuse Ängste in die Debatte einbringen zu müssen. Man schreit irgendetwas, um gehört zu werden oder um wenigstens die anderen zum Schweigen zu bringen.
Aber auch jenseits der sozialen Medien hört kaum jemand ernsthaft und ideologiefrei zu, um zu verstehen oder sich in die Lage des Anderen zu versetzen. Offenbar braucht es Feinde und Feindbilder, die man verantwortlich für das machen kann, was (vermeintlich oder tatsächlich) schiefläuft. In ihrem Furor entfernen sich alle von den Eigenschaften, die Deutschland besonders machen: Ambivalenz im Sinne des Abwägens und Ringens um eine Entscheidung, Konsensfähigkeit und Vielschichtigkeit! Nicht das Eindimensionale macht dieses Land aus, sondern das Prozessuale.
Das ist anstrengend, das kostet Zeit und das bedeutet, dass es auf komplexe Fragen zu unserer Gegenwart und Zukunft keine einfachen Antworten geben kann. Die Geduld, die eine intensive sachorientierte Durchdringung eines Problems erfordert, scheint vielen inzwischen jedoch zu fehlen. Das hat man auch während der jüngsten Krise rund um die Corona-Pandemie gesehen. Anfangs schien es, dass die Krise die Polarisierung im Land schwächen würde, da die Menschen nun begreifen würden, dass sie alle in einem Boot sitzen und auf Solidarität und Vernunft angewiesen sind. Tatsächlich gewannen die Parteien der Mitte wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung, als Krisenmanager, die das Schiff Deutschland auf Sicht durch unbekannte Gewässer lenken. In Umfragen büßten die Oppositionsparteien Zustimmung ein – keines ihrer Themen kam gegen Corona an. Doch je länger die Krise andauerte, und je länger die Menschen zuhause bleiben mussten, desto mehr Gehör fanden Fake News und Verschwörungstheorien. Die realen Ängste vor der Seuche haben alte, zum Teil versteckte Ängste wieder aktiviert. Angst und Hilflosigkeit erzeugen Wut, und Wut lässt sich am leichtesten kanalisieren, wenn man sie gegen jemanden oder etwas richten kann. Deshalb suchen die Wütenden nach Sündenböcken, auf die sie die eigenen Ängste projizieren können. »Die da oben«, die Chinesen, Bill Gates, ja sogar die Flüchtlinge dienten als Projektionsfläche, als Verantwortliche für die »Chinesische Seuche«, ein Begriff, mit dem Donald Trump eine gemeinsame Erklärung der G7-Außenminister zum Umgang mit der Pandemie torpedierte. Der Spiegel sah darin einen weiteren Beleg für Trumps Kampf gegen den Multilateralismus und prognostizierte düster: »Corona vernichtet die letzten Reste der bestehenden Weltordnung.«1
Die Kanzlerin hat bereits mehrfach gefordert, Europa müsse lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Deutschlands Rolle dabei zu definieren, fällt den Verantwortlichen jedoch häufig schwer. Weil man glaubt, im Blick in den Rückspiegel den Weg in die Zukunft sehen zu können. Man fürchtet sich davor, eine klare Führungsposition zu übernehmen, obwohl man sich als demokratisch gefestigtes Mitglied der westlichen Wertegemeinschaft erwiesen hat. Es scheint, als traue man sich selbst nicht über den Weg.
Dieses fehlende Selbst-Bewusstsein hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass den Deutschen nach wie vor drei Säulen für eine gefestigte, gemeinsame Identität fehlen: Ein Gründungsmythos für die Nation, eine gelebte Erinnerungskultur und ein klares Bekenntnis zu den Spielregeln, die das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft regeln. Weder die Varus-Schlacht im Jahre 9 n. Chr. noch die Gründung des Heiligen Römischen Reichs im Spätmittelalter oder die des Deutschen Reichs zu Bismarcks Zeiten taugen heute als identitätsstiftende Gründungsmythen. Viele sagen, die Verabschiedung des Grundgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Geburtsstunde der neuen deutschen Identität. In der Tat ist unsere Verfassung eine der besten und modernsten der Welt. Doch das Grundgesetz kam als Reaktion auf die Katastrophe des Dritten Reiches. Es regelt die Beziehung zwischen den Bürgern und dem Staat, nicht aber unter den Bürgern selbst.
Abgesehen davon lässt sich die Frage stellen, ob das Ergebnis eines Traumas identitätsstiftend sein kann? Manchmal hat man tatsächlich den Eindruck, als sei dieses Trauma selbst, die Katastrophe des Dritten Reiches, der einzige verbliebene, traumatisch-belastete Gründungsmythos des Landes. Auf allen Seiten ist eine starke Fixierung auf das historische Trauma Deutschlands zu beobachten. Wenn man von einem SPD-Politiker wie Heiko Maas hört, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen, wenn man Parolen wie: »Nie wieder Krieg« oder sogar: »Nie wieder Deutschland« hört oder einordnende Sätze wie: »In Anbetracht unserer Geschichte …«, dann merkt man, dass die Guten gut sein wollen, indem sie sich auf das Böse beziehen bzw. davon abgrenzen. Sie konstruieren eine auf Schuld basierende Identität, in der das Gute nur durch Verdammung des Bösen zur Geltung kommen kann.
Auf der anderen Seite gibt es die von der AfD angeführten Diskussionen über die jüngere Vergangenheit, in denen man erkennt, dass es Teile dieser Gesellschaft gibt, die ihre Identität auf der Befreiung von Schuld errichten, auf der Relativierung oder Verklärung der Geschichte. Man denke nur an Alexander Gaulands »Vogelschiss der Geschichte« oder Björn Höckes »Denkmal der Schande«. Während die einen über solche Äußerungen jubeln, reagiert das Mitte-links-Lager auf solche Aussagen eher verkrampft. Es wird nicht sachlich argumentiert, sondern abgebügelt. Doch ein »So etwas darf man nicht sagen« wird auf der Gegenseite nur noch stärker ein »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen« hervorrufen. Dass der Impuls der Relativierung dadurch nicht verschwindet, der Unwille, auch heute noch Verantwortung für die Vergangenheit zu übernehmen, lässt sich am Erfolg der Partei nicht zuletzt bei den Wahlen in Thüringen beobachten.
So oder so scheint es tatsächlich so zu sein, dass Deutschland nach wie vor mehr von der Vergangenheit regiert wird. Indem man sich auf sie bezieht, sich von ihr loszusagen versucht oder sich von ihr abgrenzt. Was bedeutet das für die Gegenwart?
Der Umgang mit der Flüchtlingskrise, mit den Themen Islam, Integration, Antisemitismus, Rechtsruck und dem Aufstieg der AfD ist kaum pragmatisch und zukunftsorientiert, sondern ideologisch eingefärbt, angst- und vergangenheitsgesteuert. Man geht mit Deutschland um wie mit einem trockenen Alkoholiker, der jederzeit rückfällig werden kann. Die wichtigsten Debatten im Lande stehen, soweit sie öffentlich ausgetragen werden, im Schatten des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte. Das ist verständlich, aber wem hilft das eigentlich? Haben wir deshalb weniger Rechtsradikalismus? Nein. Haben wir weniger Rassismus und Antisemitismus? Nein. Sind Demokratie und Freiheit deshalb fester in unseren Herzen verankert, als anderswo? Nicht unbedingt.
Der lange Schatten führt meines Erachtens dazu, dass eine gefestigte Identität verhindert wird. Eine Identität, die sich selbstbewusst gegen jede Form von Unfreiheit, Zensur, Erpressung und Demokratiefeindlichkeit behauptet. Stattdessen gibt es eine Art von Negatividentität, geboren aus dem Impuls des »Nie wieder«. Und diese Form der Identität ist anfällig für ideologische Einflussnahme, weil die Notwendigkeit beispielsweise für Toleranz und Offenheit nicht aus sich selbst heraus erkannt wird. Die einen hegen ein fragwürdiges Verständnis von Toleranz, das das eigene Nationalbewusstsein als »völkisch« und »identitär« zurückweist, während importierte Nationalismen und tribale religiöse Strukturen im Namen der Vielfalt und Toleranz nicht nur akzeptiert, sondern manchmal beinahe hofiert werden. Die anderen weisen jede Art von Vielfalt zurück und fürchten um das »Wohl des deutschen Volkskörpers«. Der Migrant wird so ebenso zur Zielscheibe wie jeder, der sich für ihn einsetzt.
Und genau hier zeigt sich, dass es fatal sein kann, eine moderne deutsche Identität auf den Trümmern des Dritten Reiches zu errichten. So hat die linke Übertoleranz mit neuen Minderheiten dazu geführt, dass sogar antisemitische Tendenzen in den eigenen Reihen verharmlost werden. Und dass Minderheiten per se nur Opfer sein können. Umgekehrt haben Migration und Flüchtlingsströme den rechten Rand gestärkt, was eine Gefahr sowohl für das jüdische Leben in Deutschland als auch für Migranten insgesamt darstellt. Weder das eine noch das andere ist Zeichen von Pluralismus und Toleranz. Die Polarisierung befördert einerseits Selbstaufgabe und andererseits kann sie als Anstiftung zur Radikalisierung von Migranten und Alteingesessenen zugleich verstanden werden.
Ein Land, das sich seiner Identität und Werte nicht sicher ist, kann weder dem eigenen Volk ein stabiles Selbstwertgefühl geben, noch kann es Einwanderern eine attraktive Identität anbieten oder eine selbstbewusste Rolle in der Staatengemeinschaft übernehmen. Es kann weder das eigene Volk auf den Wandel vorbereiten noch kann es neue Bürger wirklich integrieren. Wenn klare gemeinsame Werte und Spielregeln fehlen, entsteht ein Vakuum, das extremistische Kräfte von links wie von rechts zu füllen versuchen. Und die Mitte schweigt verunsichert.
Aber gibt es nicht vielleicht doch einen positiven Gründungsmythos, zumindest für die deutsche Demokratie? Das Hambacher Schloss im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße könnte ein Symbolort für diesen Mythos sein. Hier war mit dem Hambacher Fest 1832 die erste deutsche Demokratiebewegung entstanden, die für Freiheit und Einheit plädierte. Auch in den Revolutionen von 1848/1849 lassen sich neue Ströme der deutschen Demokratie finden. Das Grundgesetz der Bundesrepublik basiert auf dem Verfassungsentwurf, der damals in der Frankfurter Paulskirche ausgearbeitet wurde. Ebenso war die Weimarer Republik getragen von einem liberalen, demokratischen Geist, der jedoch gegen innere Feinde und äußere Feindbilder nicht ankam.
In den Gedanken und Werken deutscher Philosophen, Literaten und Staatstheoretiker war der Ruf nach Freiheit immer da. In der 68er-Bewegung und, Jahrzehnte später, bei den Montagsdemonstrationen 1989 in Leipzig und anderen Orten der damaligen DDR war dieser Geist allgegenwärtig. Wo ist dieser Geist heute geblieben, wo man so dringend mehr Demokratie und Freiheit braucht? Warum schweigt die bürgerliche Mitte und lässt die radikalen Ränder den Diskurs bestimmen? Wie konnte es zu einer solchen Entpolitisierung dieses Teils der Bevölkerung kommen?
Dabei waren es gerade »Rebellen« aus dem bürgerlichen Lager, die sich in der Vergangenheit für Freiheit und Demokratie eingesetzt haben. Man denke an den Aufstand der Bürger von Bamberg gegen die Kirche im 14. Jahrhundert und dem daraus resultierenden Bau eines Rathauses mitten im Fluss, nachdem der Erzbischof sich geweigert hatte, ein Stück Land zur Verfügung zu stellen. Man denke an Martin Luthers Rede im Rathaus von Worms, den Widerstand der Geschwister Scholl, des Kreisauer Kreises und der »Verschwörer« des 20. Juli um Stauffenberg. Genau in ihrem rebellischen und freiheitlichen Geist liegt die Hoffnung für Deutschland. Menschen wie sie haben ihre Beziehung zur Freiheit reflektiert, diese nicht als selbstverständlich betrachtet und sich gegen Einschränkungen zur Wehr gesetzt.
Interessant ist dabei, dass Deutschland in seiner Geschichte fast immer der Getriebene war, nicht der Treiber. Fast immer kam die Wende von außen, ob durch die Römer, Napoleon oder die Alliierten. Oft war der Krieg der Motor, das Ausbluten Anlass zum Umdenken. Und immer schärfte Deutschland die Konturen seiner Identität durch eine Bedrohung, durch die Abgrenzung von einem Feind. Nun lebt Deutschland seit 75 Jahren in dauerhaftem Frieden mit seinen Nachbarn und seit sechzig Jahren in Wohlstand. Genug Zeit eigentlich, um über ein neues nationales Bewusstsein nachzudenken und eine fest verankerte demokratische Kultur zu entwickeln, zumal ja schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts freiheitliche Bewegungen das politische Leben in Deutschland mitgeprägt haben. Doch der Prozess der Demokratisierung nach dem Krieg wurde offenbar nicht ausreichend mit eigenen Ideen und Werten gefüttert. Der politische und wirtschaftliche Nutzen der Demokratie scheint im Rückblick wichtiger gewesen zu sein als die Bedeutung der freiheitlichen Prinzipien für das Individuum. Dazu kommt, dass die alten Geister, die einst gerufen wurden, auch heute nicht so recht weichen wollen. Statt den Kampf gegen diese antidemokratischen Kräfte zum Anlass zu nehmen, um die Demokratie weiterzudenken, ruft diese Auseinandersetzung eher Angst und Selbstzweifel hervor. Und so droht das Land eine goldene Chance zu verspielen, sich selbst aktiv zu verändern, bevor die nächste Veränderung von außen kommt – durch künstliche Intelligenz etwa, neue Migrationswellen, ausgelöst durch Kriege und den Klimawandel oder durch das neue Abgleiten mancher Länder inmitten der Europäischen Union in Nationalismus und Protektionismus.
Die Demokratie erlebt nicht nur in Deutschland eine Zerreißprobe. Es ist eine globale Entwicklung, in Teilen sicher eine Reaktion auf die Globalisierung, aber nicht nur. Es braucht internationale und nationale Konzepte zugleich, um nicht in eine langfristige Demokratiekrise zu stürzen. Oft wird das Wachsen der politischen Ränder und deren Misstrauen gegenüber Demokratie und Pluralismus als Ausdruck dieser Krise gesehen. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Die Krise der Demokratie ist in erster Linie eine Krise der Mitte, die immer unmündiger, unpolitischer, angstgesteuerter und somit erpressbarer wird. Sie wird zum Getriebenen äußerer und innerer Entwicklungen, gibt das Heft des Handelns aus der Hand. Ihr Glaube an die Freiheit schwindet und somit auch ihr Glaube an sich selbst.
Das ist aktuell kein rein deutsches Phänomen, auch in vielen etablierten Demokratien wie in Frankreich und den USA erodiert die Mitte im Zuge der Globalisierung und fühlt sich machtlos gegenüber nationalen und internationalen Entwicklungen. Doch da, wo die Demokratie eine lange Tradition hat, verfügt die Bevölkerung über eine Art Rückversicherung: einen Gründungsmythos, ein Nationalbewusstsein und den Glauben an gemeinsame Werte. Überspitzt könnte man sagen, dass die Franzosen auf eine lange Tradition der »Selbstermächtigung« zurückblicken: Sie haben die Monarchie mit dem Sturm auf die Bastille gestürzt, und sie gehen auch heute noch häufiger auf die Barrikaden, wenn sie mit einer Entscheidung aus dem Élysée-Palast nicht einverstanden sind. Der deutsche Michel hingegen war eher Untertan. Er beugte sich Napoleon, den Reichsfürsten, dem deutschen Kaiser, Hitler oder den Alliierten. Als Richard von Weizsäcker 1985 in seiner Rede anlässlich des vierzigsten Jahrestages des Kriegsendes am 8. Mai von einem »Tag der Befreiung« sprach, stieß das nicht überall im Land auf Zustimmung.
Deutschland war selbst häufig weniger Motor von Umwälzungen als Stütze der jeweiligen Herrschaftsstruktur. Natürlich gab es auch hierzulande immer Gegenbewegungen. Einige dieser »Rebellen« habe ich bereits erwähnt, dazu kommen Philosophen wie Horkheimer, Marcuse und Fromm, die schon in den 1920er-Jahren über Freiheit, Autorität und Familie revolutionäre Gedanken veröffentlicht haben, um nur einige Beispiele zu nennen. Es gab die Anarchisten, die Künstler und Schriftsteller, die sich quergestellt haben. Doch sie konnten die Herrschaftstreue gewisser Schichten nicht wirklich durchbrechen. Selbst nach dem Krieg und dem Wirtschaftswunder versteckte sich das Bürgertum weitgehend hinter der starken politischen Führung und den funktionierenden Institutionen und war mehr mit Besitzstandwahrung beschäftigt, als mit gesellschaftlicher Mitgestaltung. Die neuen Entwicklungen und Herausforderungen in Deutschland, in Europa und in der Welt lassen es aber nicht länger zu, dass die Mitte sich versteckt.
Dieses Buch ist ein Appell an die Mitte, mehr zu tun, um die Demokratie und die Freiheit zu verteidigen. Sie hat auf den Gebieten der Wirtschaft, der Bildung, der Kunst und Kultur viel für dieses Land getan. Nun ist die Mitte aufgefordert, an einem neuen Gesellschaftsvertrag mitzuwirken. Einem Gesellschaftsvertrag nicht zwischen Staat und Bürgern, sondern zwischen den Bürgern selbst. Dieser Vertrag kann nur nach einer offenen und mutigen Wertedebatte geschlossen werden, die von der Zivilgesellschaft geführt wird. Es spielt dabei keine Rolle, ob wir das Ergebnis mit Leitkultur, Leitwerten oder einem anderen Begriff versehen. Viel wichtiger ist, dass diese Debatte endlich geführt wird. Sie kann zum Beginn eines Selbstverständigungsprozesses einer pluralistischen Gesellschaft werden, zur Grundlage einer gemeinsamen Identität und eines gemeinsamen Bewusstseins für das, was dieses Land ausmacht. Intellektuelle und Journalisten, Arbeiter und Migranten, Liberale und Konservative, Studenten und Professoren, Fromme und Religionskritiker müssten daran beteiligt sein. Das wird nicht leicht werden, denn viele widersprüchliche Positionen und Emotionen müssen zusammengebracht werden. Doch ohne diese Debatte und die daraus resultierenden verbindlichen Regeln sind die nationalen und globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht mehr zu meistern.
Kapitel 1
Wer sind wir? Fluch und Segen einer gemeinsamen Identität
Moderne Identitäten in einer pluralistischen Gesellschaft müssen einen Spagat bewältigen zwischen der Bewahrung der eigenen Traditionen und der Befreiung von den Zwängen, die aus eben diesen Traditionen entstehen. Die modernen deutschen Identitäten vereinen viele widersprüchliche und konfliktbeladene Elemente, die die Träger dieser Identitäten mehr belasten als beglücken. Die eine Identität setzt auf Rückzug, Homogenität und Nationalstolz. Die andere auf Öffnung, Vielfalt und Erinnerungskultur. Die einen berufen sich auf alte Reiche und Mythen und wünschen sich eine Rückkehr in jene Zeiten, wo man noch »unter sich« war. Die anderen schärfen ihre Identität durch die Ablehnung dieser alten Mythen. Beide Identitäten fußen auf der Abgrenzung von und der Gegnerschaft zur jeweils anderen. Beide sind vergangenheitsbezogen. Die einen verklären und relativieren die eigene Vergangenheit und wollen sich von Schuld befreien, die anderen agieren genau aus diesem Schuldbewusstsein heraus. Die Vergangenheit wird zum Kompass für das Handeln der Gegenwart.
Dazu kommen Migranten mit eigenen Traditionen und Konzepten von Identität, die teils ebenfalls auf alten Mythen und Reichsfantasien gründen. Interessanterweise finden konservative Migranten, die für Rückzug und Besinnung auf alte Traditionen stehen, Verbündete nicht unter rechtskonservativen Deutschen, sondern unter den weltoffenen Linksliberalen, die nicht viel von eigenen Traditionen und alten Reichen halten. Sie, die früher von der Idee des Klassenkampfs gelebt haben, führen den Kampf heute entlang der Identitäten. Sie kämpfen nicht länger gegen die Bourgeoisie, sondern an der Seite von Migranten gegen »alte weiße Männer«, die der Migration skeptisch gegenüberstehen. Die Rechten geben sich dagegen bürgerlich und freiheitlich, doch die Freiheit wollen sie sich selbst vorbehalten, Andersdenkende oder -lebende ausgrenzen. Ihr »Ethnopluralismus« meint letztlich nichts anderes als »Deutschland den Deutschen«.
Und so wird das Land zum Austragungsort eines gesinnungsethischen Ringens von unterschiedlichen Identitätskonzepten, die sich jede auf ihre Weise gegen die Moderne, die Aufklärung und die offene Gesellschaft richten. Denn je mehr sich das Land öffnet, desto mehr ziehen sich diejenigen zurück, die Angst vor der Freiheit, vor Relativismus und Ambivalenz haben. Und je mehr sich das Land öffnet für Gruppen, die mit dem westlichen Freiheitsbegriff nichts anfangen können, umso gravierender sind die Folgen, wenn wir nicht über einen gefestigten Wertekanon verfügen, sondern bereit sind, Teile davon im Namen der Toleranz preiszugeben.
Wenn die Mitte sich aus der Werte- und Identitätsdebatte zurückzieht, bestimmen die lauten Stimmen von rechts und links den Diskurs. Natürlich ist das Thema Identität konfliktbeladen und birgt Potenzial für emotionale und politische Eruptionen. Doch es ist ein zu wichtiges Thema, um es der Rückzugspolitik der Nationalisten oder der Multikulturalismus-Doktrin der Linken zu überlassen. Gleichwohl gehören beide Seiten zur unbedingt notwendigen Debatte dazu. Ein offener Dialog bedeutet, dass keiner ausgeschlossen werden darf. Es bedeutet aber auch, dass es einer aktiven Beteiligung der Mitte bedarf.
Aus meinem eigenen Ringen mit Identitätsfindung kann ich vier Dimensionen ableiten, die für unser Thema relevant sind: Orientierung, Geborgenheit, Abgrenzung und Abwehr.
Zur Orientierung braucht man eine Kontinuität in seiner Umgebung, die etwa durch eine gemeinsame Sprache, Rituale, Werte, einen Verhaltenskodex und Ähnliches bestimmt wird. Diese Dimension ist die Voraussetzung dafür, dass man seine Umgebung verstehen kann. Würde man jeden Tag mit einer neuen Sprache oder neuen Spielregeln konfrontiert, entstünde Verwirrung und Unsicherheit.
Geht es in der ersten Dimension darum, die eigene Umgebung zu verstehen und daraus Kriterien für das eigene Handeln abzuleiten, ist die zweite Dimension der Identität dafür zuständig, das Gefühl, verstanden und akzeptiert zu werden, zu vermitteln. Hier spielen die Emotionen eine entscheidende Rolle. Es geht um Geborgenheit, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, um gemeinsame Erfahrungen und Erinnerungen. Aber auch um Glauben und Aberglauben, um Gerüche und Klänge, Temperaturen und Temperamente.