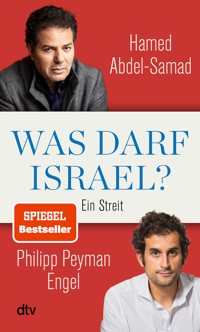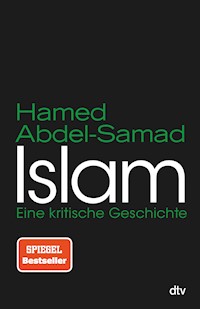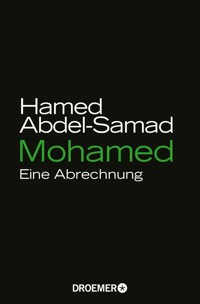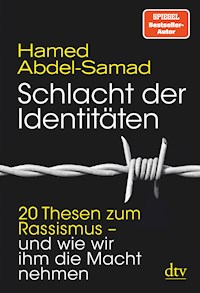
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Kampf gegen den Rassismus ist eine Menschheitsaufgabe Hamed Abdel-Samad hat Rassismus erlebt: In Ägypten wurde er als hellhäutiger Kreuzritterbastard denunziert, in Deutschland ist seine Haut manchen zu dunkel, sein Name anderen zu muslimisch. Dieses erfahrungssatte Buch ist kein Bericht der Betroffenheit. Es ist die Analyse eines durch Globalisierung, Migration und Vorfälle in den USA auch hierzulande angeheizten Themas. Die Radikalität der Debatte, die in Deutschland weit über das Thema Rassismus hinaus Fragen von Identität, Zugehörigkeit, Rederecht und Redeverbot behandelt, droht die Gesellschaft tief zu spalten. Abdel-Samad sucht die Auseinandersetzung zu rationalisieren und zeigt im Individualismus einen Ausweg aus der zwanghaft identitätsfixierten Zugehörigkeitsdebatte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hamed Abdel-Samad
Schlacht der Identitäten
20 Thesen zum Rassismus – und wie wir ihm die Macht nehmen
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
»Rassismus bedeutet die Überzeugung, dass ein Beweggrund wie Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft die Missachtung einer Person oder Personengruppe oder das Gefühl der Überlegenheit gegenüber einer Person oder Personengruppe rechtfertigt.«
Begriffsdefinition der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz
Einführung
Der Kampf gegen Rassismus sollte eine Gesellschaft eigentlich einen, nicht spalten. Denn diese menschliche Krankheit ist nicht nur für die Opfer von Rassismus, sondern auch für die Rassisten selbst und vor allem für die Gesamtgesellschaft extrem schädlich. Die Opfer verlieren durch rassistische und diskriminierende Erfahrungen oft das Vertrauen in das Gemeinwesen, in ihre Mitmenschen und – was noch schlimmer wiegen dürfte – sie verlieren das Vertrauen in sich selbst. Wenn Menschen in der Schule, im Alltag oder im Berufsleben nicht nach ihren Talenten und Fähigkeiten beurteilt werden, sondern nach ihrer Hautfarbe, ihrem kulturellen Hintergrund, ihrer Sexualität oder ihrer Religion, dann verlieren am Ende wir alle. Die Rassisten selbst berauben sich in ihrem Furor der Möglichkeit, am Wissen der anderen teilzuhaben und sich für deren Erfahrungsschatz zu öffnen. So schneiden sie sich ein Stück weit selbst von der Vielfalt dieser Welt ab und bleiben sowohl menschlich als auch geistig arm. Und eine Gesellschaft schließlich, die das Rassismusproblem nicht in den Griff bekommt, droht wie ein Körper zu werden, dessen Organe nicht mehr harmonisch zusammenarbeiten, sondern einander gegenseitig blockieren. So schwächt der Körper sich selbst und läuft Gefahr, sich mit der Zeit Stück für Stück von innen heraus zu zersetzen.
Rassismus war in Deutschland lange kein breit diskutiertes Thema, obwohl es ihn natürlich auch bei uns in verschiedenen Ausprägungen gab und gibt. Erst die Vorfälle in den USA im Jahr 2020 – die tödlichen Schüsse auf Breonna Taylor und Daniel Prude im März, auf Rayshard Brooks im Mai und Jacob Blake im August und vor allem der Erstickungstod von George Floyd durch Polizeigewalt, der die »Black Lives Matter«-Bewegung groß gemacht hat – brachte Rassismus auch bei uns auf die mediale und politische Agenda. Seither wird intensiv über Polizeigewalt und institutionellen Rassismus diskutiert. Menschen mit schwarzer Hautfarbe werden in TV-Sendungen eingeladen und von Zeitungen interviewt, um von ihren Rassismuserfahrungen zu berichten.
Doch die Art und Weise, wie wir in Deutschland über das Thema Rassismus diskutieren, legt – wie schon bei den Themen Migration und Integration – offen, dass in unserem Land etwa schiefläuft. Und zwar nicht nur in Bezug auf unsere Streitkultur. Die längst fällige Debatte wird ideologisch aufgeladen und emotional geführt, von den unterschiedlichen Lagern gekapert, instrumentalisiert oder relativiert. Hier Moralismus und Betroffenheitsrhetorik, dort Abwehr und Leugnen. Man bleibt nicht auf der Sachebene, nicht bei der wissenschaftlichen Definition von Rassismus, sondern verengt den Begriff auf eine Weise, wonach Rassismus offenbar nur ein Privileg des »weißen Mannes« zu sein scheint. Nach dieser ideologischen Ausrichtung des Begriffs gilt bereits die harmlose Frage nach der Herkunft eines Menschen als rassistisch und damit als indiskutabel.
Mit einer Debatte, in der nur vorgeworfen und verteidigt wird, schützt man weder die Opfer von Rassismus noch erreicht man die Rassisten selbst. Eine solche Debatte wird letztlich nur zu einem Selbstbedienungsladen der Ideologen von links wie rechts.
Was als gut gemeinter Weg gedacht war, um die Bevölkerung für die Befindlichkeit der Opfer von Rassismus zu sensibilisieren und den Opfern ein Forum zu bieten, endete leider in vielen Fällen genau damit. Der Leser oder Fernsehzuschauer verspürte wahlweise Schuld oder Mitleid, oder wies die Tatsache, dass wir ein Rassismusproblem haben, vehement zurück. Doch weder Schuld noch Mitleid noch Leugnen helfen irgendjemandem. Schuldgefühle und Betroffenheit täuschen manchmal sogar vor, man habe dadurch bereits seinen Beitrag geleistet. Solidaritätsbekundungen, Sonntagsreden und Lichterketten reichen jedoch längst nicht mehr aus. Wir brauchen eine Debatte, die in die Tiefe geht. Doch diese wird – der vergleichsweise großen Präsenz des Themas in Politik und Medien zum Trotz – noch immer nicht geführt. Das hat auch damit zu tun, dass Antirassismus ideologisch oft mit Anti-Amerikanismus und Anti-Kapitalismus verflochten ist; und nicht selten wird der Rassismusvorwurf benutzt, um alte Rechnungen zu begleichen. Die Leidtragenden sind auch hier die Opfer von Rassismus, die ein zweites Mal zum Opfer gemacht werden: Weil ihnen keine Instrumente an die Hand gegeben werden, die sie selbst ermächtigen würden. Oder, wie eine afroamerikanische Freundin aus den USA einmal zu mir sagte: »Mir ist ein Trump-Anhänger, der mich ›Nigger‹ nennt, lieber, als ein Demokrat, der mich paternalistisch wie ein kleines Kind behandelt, das immer einen weißen Anwalt braucht, der seine Rechte sichert und verteidigt.«
Berichte von Betroffenen sind wichtig, weil sie uns zeigen, was Rassismus bei den Opfern und in der Gesellschaft insgesamt anrichtet. Doch noch wertvoller könnten diese Berichte sein, wenn statt des Reflexes von Anklage und Abwehr bzw. Relativierung eine Reflexion in Gang käme. Anklagen und moralische Appelle allein führen nicht zu einem Umdenken bei den Tätern und schaffen auch keinen Frieden für die Opfer. Zielführend sind Anklagen ebenfalls nicht, wenn einzelne Opfer oder Aktivisten als Vertreter aller Schwarzen, aller Muslime, aller Migranten oder aller Flüchtlinge auftreten, und ihre subjektiven Erfahrungen für allgemeingültig erklären, um »die Gesellschaft«, »den weißen Mann« pauschal zu verurteilen. Rassismus ist ein Menschheitsproblem, das nur gemeinsam gelöst werden kann. Doch wenn Antirassisten meinen, nur People of Color (PoC) dürften über Rassismus reden, weil nur sie davon betroffen seien, kommt man nicht weiter.
Viele, die sich als Kämpfer gegen Rassismus inszenieren, bedienen sich letztlich der gleichen Mittel wie die Rassisten selbst: Sie unterteilen die Welt in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse, sie betrachten Menschen nicht als Individuen, sondern als Vertreter von Ethnien und Gruppen. Sie polarisieren, kategorisieren und ordnen ein. Sie vereinfachen, indem sie die Gesellschaft spalten: Wer nicht für uns ist, muss gegen uns sein. Wenn Debatten aber nur eindimensional geführt werden, wenn es nur darum geht, die eigene Ideologie bestätigt zu sehen oder sie anderen überzustülpen, gelangen wir nicht zum Kern des Problems. Wir werden der Komplexität des Themas nicht gerecht und bedienen die gefährliche Sehnsucht nach einfachen Antworten. Und irgendwann wird der Druck, sich zu einer Seite bekennen zu müssen, so groß, dass gar kein Diskurs mehr möglich ist.
Die verkrampfte Debatte über Rassismus ist auch ein Symptom für die konkurrierenden Identitäten und Utopien in dieser Gesellschaft. Sowohl bei Einheimischen als auch bei Zugewanderten ist die Sehnsucht nach einer geschlossenen, homogenen und von fremden Einflüssen weitgehend freien Identität inzwischen deutlich stärker ausgeprägt als noch vor ein paar Jahren. Der schnelle Wandel durch Globalisierung und Digitalisierung führt bei vielen Menschen zu einem Gefühl der Entfremdung und Entwurzelung. Bei manchen führt das zu einer Flucht in identitäre Utopien, die es in der Vergangenheit nie gab und die es auch in der Zukunft nicht geben wird. Diese fatale Form der Identitätshygiene füttert die Ängste vor anderen Identitäten, die die eigene vermeintlich schwächen oder unterwandern wollen. Demgegenüber steht die Utopie einer offenen, bunten Gesellschaft, die jedoch nicht verordnet werden kann, sondern sich behutsam entwickeln muss. Und die voraussetzt, dass wir den anderen als Individuum wahrnehmen, statt ihn auf bestimmte Attribute zu reduzieren.
Genau das aber lässt sich bei der Rassismusdebatte beobachten: Sie gerät sofort in diesen fatalen Identitätskampf und wird von der Öffnungspolitik der Linken und der Angst vor Unterwanderung oder gar »Umvolkung« der Rechten in die Zange genommen. Dabei ist Rassismus ein viel zu wichtiges Thema, um es den ideologischen Grabenkämpfen zwischen rechts und links zu überlassen. Denn das führt letztlich auch dazu, dass diejenigen schweigen werden, die sich nicht auf die eine oder die andere Seite schlagen wollen. Und darin liegt eine große Gefahr für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und den Fortbestand unserer Demokratie.
Rassismus betrifft uns alle, er ist wie eine chronische Krankheit, die sich in der DNA der Menschheit seit Jahrtausenden festgesetzt hat. Die Entstehung und den Verlauf einer Krankheit zu verstehen, kann uns zwar nicht immer helfen, diese auch zu heilen, aber es kann uns Hinweise liefern, wie wir mit ihr leben können, ohne dass sie unser Leben dominiert oder den gesellschaftlichen Frieden bedroht. In diesem Buch will ich daher eine Art Weltreise meiner Rassismuserfahrungen nachskizzieren, ohne daraus einen Betroffenheitsbericht zu machen. Ich will weder klagen noch anklagen noch emotionale Apelle in die Welt senden, mit denen sich Rassisten ohnehin nie wirklich erreichen lassen. Ich will stattdessen versuchen, das Phänomen in seiner Vielschichtigkeit zu dekonstruieren, um es zu verstehen. Das Buch richtet sich an Opfer von Rassismus, aber auch an jene Menschen, die sich für Antirassisten halten, ohne selbst frei von Rassismen zu sein. Es ist insofern auch eine Einladung zur Reflexion und zur Überprüfung des eigenen Handelns und Denkens.
TEIL I Rassismus im Spiegel von Geschichte und Gegenwart
These 1 Rassismus ist eine anthropologische Konstante
Der Mensch begann seine Karriere auf diesem Planeten in einer sehr feindseligen Umgebung, in der die Sicherung der Nahrung – und damit sein Überleben – immer mit einem Kampf verbunden war. Einem Kampf nicht nur gegen Naturgewalten und wilde Tiere, sondern auch gegen andere Angehörige der menschlichen Spezies, die ihm die knappen Ressourcen streitig machen wollten.
Dieser existenzielle Kampf hatte einen wichtigen Motor: Angst. Und diese Angst veranlasste den Menschen, sich in Gruppen zu organisieren. Ein enger Zusammenhalt innerhalb der eigenen Sippe, verbunden mit einer Arbeitsteilung etwa bei der Jagd, versprach deutlich bessere Überlebenschancen für alle, die dieser Gruppe angehörten.
Die archaische Sippenbildung der frühen Menschheitsgeschichte folgte schon damals dem Prinzip der Abgrenzung: Wir gegen die Anderen. Der Andere trat nicht als Freund und Helfer in Erscheinung, sondern als Bedrohung, als Konkurrent um Nahrung, Land und andere Ressourcen. Je größer diese Bedrohung, je härter der Kampf, umso größer wurde die Angst, umso wichtiger die Schutzfunktion der eigenen Gruppe.
So gesehen könnte man auch sagen, dass die Wurzel für die Entstehung von Rassismus nicht Ausdruck der Überlegenheit einer Gruppe oder einer Ethnie war, sondern existentielle Angst und Unsicherheit.
Die eigene Gruppe nahm jedoch nicht nur Ängste, sie wurde auch zum Quell anderer Ängste. Denn die Gruppe bestimmte, wer man war, sie legte Merkmale für die Zugehörigkeit fest und definierte sich oft durch Feindschaft zu einer anderen Gruppe. Die Konturen der eigenen Identität wurden erst durch die Abgrenzung zu anderen geschärft.
Die Begegnung mit anderen Kulturen verlief fast immer asymmetrisch. Mal war man der Eroberer, mal der Eroberte. Der Mächtige bestimmte die Spielregeln und ging selten fair mit den Unterlegenen um. Er kolonialisierte, tötete, versklavte und beutete die Ressourcen der eroberten Landstriche aus. Dieses Gebaren war kein Privileg des weißen Mannes, alle Hochkulturen in allen Weltgegenden verfuhren nach diesem Muster.
Die Schwachen hatten Angst vor den Stärkeren, aber auch die Starken waren nicht frei von Angst. Sie fürchteten die Rache der Unterjochten. Ein Teufelskreis aus Angst, Hass und Aggression, der eine lange Geschichte von Unterdrückung und gegenseitigem Misstrauen in Gang gesetzt hat, die bis heute die Beziehung der unterschiedlichen Kulturen, Ethnien und Religionen zueinander prägt. Viele alte Verletzungen, Vorurteile und sogar Hass gegenüber bestimmten Gruppen haben die zivilisatorische Weiterentwicklung des Menschen überdauert und sind heute in jedem gesellschaftlichen System der Welt zu Hause. Das habe ich in Ägypten, in den Golfstaaten, in Japan, in den USA und auch in Deutschland erlebt. Diese Elemente aus einem System zu entfernen ist beinahe unmöglich, denn sie sitzen oft ebenso tief wie unsere unbewussten Ängste.
Unsere Angst vor dem Fremden, dem anderen, reicht zurück bis zu den Anfängen. Unser Gehirn verfügt immer noch über ein altes, fremdenfeindliches Angstsystem, das eigentlich durch das intelligente Vernunftsystem kontrolliert wird, bei einer als groß empfundenen Bedrohung aber sofort aktiviert wird. Das Angstsystem, erklärte der Psychiater Borwin Bandelow in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, »ist sehr einfach gestrickt. In etwa wie das eines Huhns.« Es hat dem Menschen einerseits beim Überleben geholfen, kann ihn aber andererseits auch dazu verleiten, selbst irrationalen Ängsten nachzugeben. Es kann allzu leicht getriggert werden, auch wenn der Verstand weiß, dass keine wirkliche Bedrohung gegeben ist.
In den vergangenen Jahrtausenden machte der Mensch kulturelle und zivilisatorische Quantensprünge. Er schuf beeindruckende Bauwerke und Kunst, brachte große Denker und Forscher hervor, er machte sich die Natur untertan, brachte Stahlkolosse zum Schwimmen und erreichte den Mond. Doch seine Triebe und Ängste blieben archaisch. Und das primitive Verständnis von Identität als Schutzschild gegen »die Anderen« blieb bestehen und mit ihm das Misstrauen gegenüber dem Fremden.
Wut, Hass und Aggression konnten zwar durch Gesetze, Spiritualität, Ethik, Musik, Kunst und Empathie gezügelt werden, doch wirklich davon befreien konnte sich der Mensch bis heute nicht. Das Streben nach Homogenität und die Abgrenzung zu anderen waren von Anfang an Bestandteil jeder Gesellschaft, auch, weil sie damals ihren Fortbestand sicherten.
These 2 Rassismus ist (k)ein Privileg der Weißen
Die amerikanische Soziologin und Anti-Diskriminierungsaktivistin Robin DiAngelo geht davon aus, dass jeder weiße Mensch – bewusst oder unbewusst – ein Rassist ist. In einem Interview mit Spiegel-Online am 20. Juni 2020 begründete sie ihre These so: »Jeder Weiße ist Rassist durch die Sozialisation in einer rassistischen Kultur.« Daran könnten die Weißen auch nichts ändern, selbst wenn sie es wollten. Und selbst wenn sie glaubten, es ändern zu wollen, wollten sie es im Grunde doch nicht. Denn in Europa und den USA lebten sie in Gesellschaften, zu deren Grundlage es gehöre, dass Weiße privilegiert seien.
In diesem Interview, aber auch in ihrem Buch »White Fragility« rückt sie das Weiß-Sein in die Nähe einer Art Erbsünde, vor der es kaum ein Entrinnen gibt. Es sei denn, Weiße würden lernen, anders über Rassismus zu denken. Nicht mehr nur als individuelle, aktive und bewusste Handlung einer einzelnen Person, sondern als internalisierte Haltung, die in jedem weißen Menschen stecke.
Auch wenn DiAngelo mit ihrer Forderung nach einem neuen Nachdenken über Rassismus zweifelsohne recht hat, bedient sie sich doch einer Definition von Rassismus, die von der Forschung nicht ohne Grund angezweifelt wird: Ich meine einen biologistisch determinierten Rassismusbegriff, der davon ausgeht, dass Weiße diskriminieren und farbige Menschen diskriminiert werden.
Diese Definition reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert, als man begann, Menschen in »Rassen« einzuteilen. Später entwickelte sich daraus in Europa eine pseudowissenschaftliche Rassenlehre, mit verheerenden Konsequenzen vor allem durch die Kolonialisierung und später den Holocaust.
Folgt man dieser biologistischen Theorie, so wird aus Rassismus ein Phänomen, das vornehmlich auf Europa und die USA beschränkt ist und das vornehmlich People of Color zu Opfern macht, Weiße zu Tätern. Andere Formen der Ausgrenzung – kulturelle, religiöse oder sexuelle Diskriminierung etwa – lassen sich zudem so nicht erfassen.
Hinzu kommt, dass hinter den Thesen von DiAngelo ein fatales Denkmuster steckt, das man oft in linksliberalen Milieus antrifft. Der Glaube, Misstrauen und Vorurteile gegenüber Minderheiten abbauen zu können, indem man sich selbst und der eigenen Kultur mit Misstrauen und Vorurteilen begegnet. Über sich selbst und die Gesellschaft nachzudenken, ist nie verkehrt. Doch oft genug folgt darauf Selbstgeißelung und ein Verharren in einem Schuldkomplex. Wie aber kann man andere lieben, wenn man sich selbst hasst? Wie kann man die Arme für andere öffnen, wenn man selbst schuldbeladen und gebeugt durchs Leben geht?
Es gibt im Westen ein Ethos der Schuld und eine Identitätspolitik, die Toleranz gegenüber den »Fremden« verlangt, aber mit sich selbst hart ins Gericht geht. Der »privilegierte weiße Mann« muss sich ständig rechtfertigen und zurücknehmen. Tut er das nicht, steht er schnell auf der falschen Seite. Und dort wird er möglicherweise mit offenen Armen von den White Supremacists aufgenommen, mit denen er früher nichts am Hut hatte, die aber nun seinen Kampf um die Zurückeroberung der Heimat führen.
DiAngelo sieht den Motor des Denkens und Handelns in der Herkunft und Hautfarbe. Ist nicht genau das eine Form von Rassismus? Und wem hilft es, wenn Rassismus nun in die andere Richtung ausschlägt, indem Weiße unter Generalverdacht gestellt werden? Das Problem lässt sich nicht dadurch lösen, dass ein weiteres Mal ab- und damit ausgegrenzt wird.