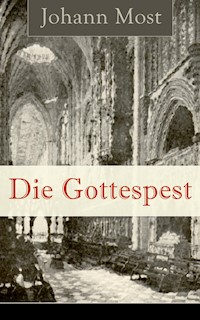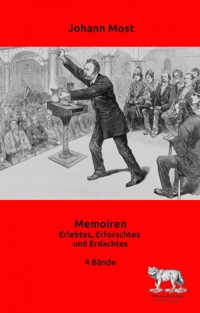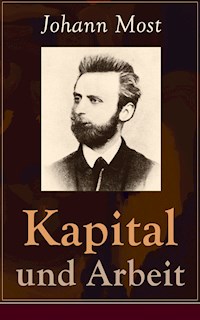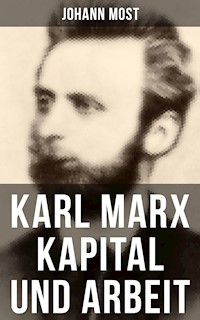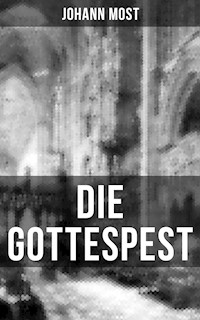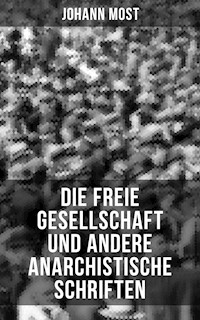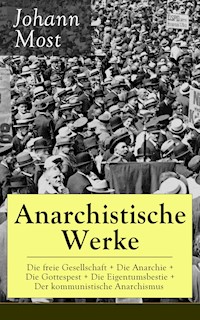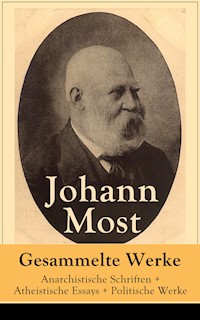Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Johann Mosts Werk 'Ausgewählte anarchistische, atheistische und politische Schriften und Beiträge' werden die Leser in die radikale Welt des späten 19. Jahrhunderts eingeführt, in der politische Ideologien auf brandheiße Weise diskutiert werden. Mosts literarischer Stil ist geprägt von scharfer Polemik und provokativen Themen, die die Leser zum Nachdenken anregen. In diesem Buch werden verschiedene Themen wie Anarchismus, Atheismus und politische Aktivismus behandelt, wobei Mosts leidenschaftliche Überzeugungen klar zum Ausdruck kommen. Seine Schriften sind ein wichtiger Bestandteil der politischen und sozialen Geschichte dieser Zeit und bieten einzigartige Einblicke in die Ideen und Ideale der damaligen Gesellschaft. Der Autor selbst war ein bedeutender Anarchist und politischer Aktivist, der durch seine Schriften und Reden weitreichenden Einfluss ausübte. Johann Most war bekannt für seine provokanten Ansichten und seine kompromisslose Haltung gegenüber autoritären Regimen und sozialen Ungerechtigkeiten. Seine Schriften sind auch heute noch relevant und können den Lesern wertvolle Einblicke in die Geschichte und Ideologie des Anarchismus bieten. Dieses Buch ist für diejenigen Leser empfohlen, die an politischer Philosophie, sozialem Aktivismus und historischen Ideen interessiert sind, und die bereit sind, sich mit kontroversen Themen auseinanderzusetzen, die auch heute noch relevant sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ausgewählte anarchistische, atheistische und politische Schriften und Beiträge
Inhaltsverzeichnis
Die Gottlosigkeit
I. – Vom Glauben.
Ueber Gott wird vieles geglaubt, während man thatsächlich nichts über ihn weiss. Denn der Glaube ist eine Negation des Wissens; man glaubt nur, was man nicht weiss; was man weiss, das braucht man nicht mehr zu glauben.
Man kann etwas vermuthen, man kann etwas für möglich halten; aber etwas zu glauben, ist absurd. Das Wissen ist positiv, der Glaube illusorisch. Der Glaube ist Wahnsinn; denn der Gläubige erklärt, ein eingebildetes Etwas nicht zu wissen, und dennoch behandelt er diese Einbildung für eine Thatsache. Wenn Einer sagt: »Ich glaube an Gott,« so besagt dies, dass er nicht weiss, ob es einen Gott giebt, dass er aber trotzdem von dessen Existenz »überzeugt« ist, wodurch weiss er nicht. Er behauptet wohl, er »fühle« die Existenz Gottes, in der That aber ist dieses »Fühlen« nur eine Täuschung; er glaubt einfach an Gott, und das genügt ihm.
Es giebt zwar auch Leute, die nicht nur sagen, sie glauben an Gott, sondern die geradezu behaupten, dass sie mit Gott in direktem Verkehr stehen. In diesem Falle handelt es sich entweder um Hallucination oder Hallunkination.
Der Glaube ermöglicht, ja er bedingt eine unzählbare Menge von Vorstellungen von Gott. Diese haben wohl das gemein, dass sie unter Gott ein Wesen verstehen, welches mächtiger ist, als die Menschen, und diese beherrscht. Diese Vorstellungen von einer höhern Macht steigern bis zum Glauben an eine Allmacht, und variiren in’s Grauenhafte. Es ist deshalb auch nicht möglich, eine exakte Definition des Begriffes Gott zu geben, wohl aber ist zu beweisen, dass der Herrgottsglaube nichts anderes als Wahnsinn ist.
Alle die verschiedenen Götter zu behandeln, wäre; wenn nicht unmöglich, mindestens eine überflüssige Arbeit; es mag genügen, die hauptsächlichsten Gottesideen herunterzureissen, was in Nachstehendem geschehen soll.
II. – Kein allmächtiger und allguetiger Gott.
Wenn ein allmächtiger und allgütiger Gott existiren würde, und wenn er wünschte, dass wir ihn kennen (dies erfordert doch die Allgütigkeit), warum lässt er sich nicht wahrnehmen? Wenn er doch allgütig ist, warum lässt er uns in Unkenntniss von seiner Existenz? Es wäre doch von grosser Wichtigkeit, zu wissen, dass ein allgütiger Herrgott existirt! Da er ja allgütig wäre, so wäre doch nicht zu befürchten, dass uns sein Erscheinen in Furcht und Schrecken setzen würde. (Oder sollte etwa das göttlich Gute ein menschlich Böses sein?) Und da er ja allmächtig wäre, so könnte er sich und uns leicht gegen mögliche Unfälle schützen.
Da sich aber kein Herrgott kundgiebt, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass es keinen allgütigen und allmächtigen Gott giebt.
Dieses eine Argument beweist schon hinlänglich, dass es keinen allgütigen und allmächtigen Gott giebt; weitere Argumente sind daher überflüssig.
III. – Kein allmächtiger und allweiser Gott.
Wenn ein allweiser und allmächtiger Gott existirt, und die Welt erschaffen hat, wie konnte er dann so viele unweise Wesen schaffen? Wie kann ein Allweiser etwas Unweises schaffen? Ist vielleicht seine Weisheit so weise, dass er es für weise hält, sie nicht weiter zu pflanzen? Oder wollen etwa die Herren Gläubigen behaupten, dass alles weise sei in dieser Welt?
Hieraus geht hervor, dass es keinen allweisen und allmächtigen Gott giebt.
IV. – Kein allmächtiger und allgerechter Gott.
Wenn Gott der Allgerechte und Allmächtige existirt, folglich allwissend ist, und daher unsere ganze Misere kennt, und sie tilgen kann, warum thut er es nicht? Warum lässt der allgerechte und allmächtige Gott der Ungerechtigkeit freien Lauf; warum lässt er ruhig den Tyrannen das hilflose Kind ermorden; warum lässt er den Schwachen untergehen, und den Starken triumphiren? Wie kann man aus solchen Thatsachen auf die Existenz eines allgerechten und allmächtigen Gottes schliessen?
* * * * * *
Wenn dennoch ein allmächtiger Gott existiren würde, so wäre er das vollendetste Scheusal; denn es geschehen Gräuelthaten ohne irgend ein »Halt!« von seiner Seite, Millionen. Wesen seufzen in der Sklaverei, ohne dass er sie erlöst, Millionen werden von rasenden Barbaren erwürgt, und der allmächtige Gott – das Scheusal – sieht ruhig zu, ohne ein Wort zu sagen.
Nicht nur dies! Wenn ein allmächtiger Gott existirt, so ist er der Urheber von allem Elend, denn nichts kann ja ohne ihn geschehen.
Ein solcher Gott wäre zwar nach christlichen Begriffen eigentlich gar kein richtiger Gott, denn es würde ihm die Allgütigkeit und Allgerechtigkeit mangeln. Nun aber frägt es sich, ob überhaupt eine Allmacht existirt.
V. – Kein allmächtiger Gott.
Würde Gott der Allmächtige existiren, so wäre es nöthig – wie Bakounin1 sagt, – ihn abzuschaffen; denn er könnte, wie wir soeben gesehen haben, nur Tyrann sein. Da er aber der Allmächtige wäre, so wäre jeder Befreiungsversuch unnütz. Selbst wenn der Allmächtige seine Vernichtung selber wollte, wäre eine Befreiung unmöglich; denn da der Allmächtige Alles ist, die Ursache, der Wille des Lebens, so wäre die Vernichtung von ihm geradezu die Vernichtung von Allem – also auch von uns.
* * * * * *
Wenn Gott der Allmächtige wäre, so wäre es nie möglich, dass der Mensch frei wäre. Denn da dieser Gott eben allmächtig wäre, könnte der Mensch nur Sklave sein. Nein, wenn der Allmächtige existirte, so könnte der Mensch nicht einmal Sklave sein, er wäre ein Ding ohne irgend welche Macht und Eigenschaft, was nach gesundem Verstande nichts ist. Der Mensch aber ist etwas, folglich giebt es keinen allmächtigen Gott.
Wenn aber Gott der Allmächtige existiren würde, so hätte der Mensch keinen freien Willen. Unzählige Fälle beweisen aber, dass der Mensch einen bis zu hohem Grade entwickelten freien Willen hat, folglich giebt es keinen allmächtigen Gott.
VI. – Kein allgegenwärtiger Gott
Wenn Gott der Allgegenwärtige existirt, und folglich überall ist, so müssten wir ihn sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen; wenn er überall ist, so muss er auch vor unsern Augen, auf unserer Zunge, etc. sein, so muss er auch da sein, wo wir ihn wahrnehmen können. Da dies aber nicht der Fall ist, so ist der allgegenwärtige Gott nicht überall, und folglich überhaupt nicht. Er ist eben unsichtbar, unhörbar, unriechbar, unschmeckbar und unfühlbar.
Und nun, wie kann man die Existenz eines Wesens behaupten, welches wir gar nicht wahrnehmen können? Man wird sagen, der Allgegenwärtige sei etwas immaterielles, etwas geistiges. Angenommen, nicht zugegeben, dies wäre wahr, wie kann dann Jemand einen Beweis von seiner Existenz haben?
Die Absurdität der Idee von einem allgegenwärtigen, unwahrnehmbaren Gott liegt auf der Hand, wenn man nur einen Augenblick darüber nachdenkt. Dieser Geist, der keinen Raum einnimmt, soll trotzdem überall sein!
Da bei der Existenz eines allgegenwärtigen Gottes keine Stelle sein kann, wo er nicht wäre, so ist er in Folge dessen Alles. Ja, dieser allgegenwärtige Gott ist Alles, also auch eine bunte Blume, ein Brüllaffe, ein duftender Jauchetrog, etc.; und dennoch können wir ihn weder sehen, hören, riechen, schmecken, noch fühlen! Dies ist allerdings komisch; und um dies zu begreifen braucht es wirklich keinen Verstand, aber eine gute Portion Glaube.
Sodann, wer kann sich etwas immaterielles auch nur denken? Immateriell! »etwas,« das aus nichts besteht! Hierüber soll man aber ja nicht nachdenken, dies muss geglaubt werden.
VII. – Vom Gott der Pantheisten.
Der Gott der Pantheisten ist total unbrauchbar. Ihr Gott ist die Welt, die Natur, folglich wäre der Mensch auch ein Stück Gott, und in Konsequenz wäre der Gott der Pantheisten nicht persönlich – ein ganz kurioser Gott. Er ist ein Wesen, ähnlich dem Staat oder der »Gesellschaft.« Er wäre allmächtig, wenn er nur – eine Person wäre. Er ist aber, gleich dem Staat, überall wo man – ihn anerkennt; er selbst ist handlungsunfähig, seine Geschäfte müssen von Repräsentanten besorgt werden, weil er eben ein nebelhaftes Hirngespinnst, ein Spuk ist. Er ist (wie Heine2 sagt) »ein armes, träumerisches Wesen, ist mit der Welt verwebt und verwachsen, gleichsam in ihr eingekerkert, und gähnt dich an, willenlos und ohnmächtig.«
Ihr Pantheisten, nennt doch die Natur einfach Natur; nennt doch die Welt einfach Welt! Warum sollen denn Dinge, die schon einen Namen haben, mit einem andern Namen belegt werden, der nur zu deutlich ausdrückt, was er eigentlich meint?!
VIII. – Von der Bibel
Die Bibel hat mit dem Herrgott eigentlich gar nichts zu thun. Sie ist ein Buch, voll von Scheusslichkeiten, Absurditäten und Widersprüchen. Die Schöpfungs-Geschichte ist z. B. ein handgreiflicher Schwindel, und zudem im Widerspruch mit sich selbst; erzählt da die Bibel das eine Mal, dass der Mensch vor den Thieren, das andere Mal nach den Thieren gemacht wurde.
Solche Widersprüche sind in der »heiligen Schrift« nichts Seltenes. – Wie kann der Bibelberichterstatter überhaupt wissen, dass und wie der liebe Herrgott die Welt erschaffen hat? – Immerhin wird es genügen, darauf hinzuweisen, dass die Bibel ein Produkt von Menschenhänden ist, nichts anderes sein kann, und dass nichts für ihren hingelogenen göttlichen Ursprung zeugt. Und nichts in ihr zeugt für die unbewiesene Existenz Gottes. Was wir in ihr finden, ist, dass der Mensch nicht ein Produkt des Herrgotts, sondern dass die Herrgotts-Idee ein Produkt von Menschen ist.
IX. – Vom Gott der Christen.
Den Gott der Christen zu beschreiben, ist total unmöglich, denn die Meinungen der Christen über ihren Herrgott weichen meilenweit von einander. Die beste Beschreibung des Gottes der Christen ist wohl diejenige, welche ihn für unbestimmbar erklärt. Etwas Unbestimmbares kann aber nicht kritisirt werden. Und that- sächlich ist der Herrgott der Christen unbestimmbar, – oder man müsste irgend einer Sekte glauben.
X. – Von der unsterblichen Seele.
Von den Religions-Schwindlern wurde auch die kollossale Lüge verbreitet, dass dem Menschen eine unsterbliche Seele innewohne. Die Erfahrung hat aber noch nicht konstatirt, dass ein solches Ding, wie eine Seele, existirt, sondern, dass die sogenannten geistigen Funktionen eben nichts anderes als physische Funktionen sind. Doch!
Was beweist die Wissenschaft den Gläubigen?! Sie glauben ja, folglich lassen sie sich nicht durch Beweise überzeugen.
Die Christenheit erkennt nur den Menschen, nicht aber den Thieren, eine unsterbliche Seele zu. In diesem Wahnsinn waren die alten Egypter doch konsequenter; sie glaubten, – wie uns berichtet wird, – dass auch Thiere eine Seele haben können, dass nach dem Tode eines Menschen seine Seele eine Wanderung vornehme, und ihren Sitz oft in Katzen, Hunden oder Krokodilen habe. Dies ist ja ein hochkomischer Wahnsinn, wenn man genügend kühles Blut besitz, und unter der Tollheit nicht zu sehr zu leiden hat.
XI. – Wer hat die Welt geschaffen?
Schon oft ist die Frage gestellt worden: Wer hat die Welt geschaffen? Die Gläubigen sagen, es wäre Gott gewesen; andere, ungläubige Gläubige, sagen, die Welt hätte weder Anfang noch Ende. Nun kann ich mir allerdings die Welt ohne Anfang und Ende nicht vorstellen, aber ebensowenig mit Anfang und Ende. Dieses- Nichtwissen ist mir aber absolut kein Beweis für die Existenz Gottes; denn deshalb, weil ich etwas nicht verstehen kann, etwas zu glauben, ist eine Manifestation des offenen Blödsinns. Gerade dann, wenn man etwas nicht begriffen hat, heisst es erst recht, die Sache zu prüfen und wieder zu prüfen, nicht aber die Flinte in’s Korn zu werfen. Noch immer besser als sich dem blöden Glauben zu ergeben wäre es, einen Strich durch die Frage zu machen und nicht mehr darüber nachzugrübeln. Uebrigens was ficht mich das an, wer die Welt erschaffen haben mag. Da sie nun einmal da ist, nehme ich sie wie sie ist, und suche sie so viel und so gut wie möglich zu geniessen. Denjenigen aber, welcher sagt, dass Gott die Welt erschaffen hätte, will ich die Frage stellen : Von wem wurde Gott erschaffen? Hier haben wir wieder die selbe Frage wie oben: die Frage des Ursprungs der ersten Ursache. Und so fällt die ganze Gottesphrase wieder in den Sand. –
Nach Corvin3 kann es nur eine Weltursache, nur einen Gott geben. Sodann sagt er: »Die sogenannten Gottesleugner verneinen nicht eigentlich das Vorhandensein Gottes, was eine absolute Dummheit wäre, sondern erklären sich nur gegen die Vorstellung von einem persönlichen Gott.« Dies ist einfach Kohl.
Corvin bezeichnet mit dem Namen Gott »die von Jedem geahnte, wenn auch nicht begriffene Macht, welcher er den Ursprung und die Erhaltung alles Bestehenden, der Welt, zuschreibt.«
Corvin richtet sich aber selbst, wenn er sagt: »Jeder Mensch, der überhaupt eines Gedankens fähig ist, macht sich indessen von diesem Wesen eine Vorstellung, welche dem Grade der Ausbildung der ihm mit der Geburt gegebenen Vernunft angemessen ist. DieseVorstellung ist sein Gott, und somit jeder Mensch der Schöpfer seines Gottes.« Dieser letzte Satz genügt. Diese Vorstellung hat also – die Welt erschaffen! Kommentar überflüssig.
XII. – Von den Bestrafern der »Gotteslästerer.«
Eine elende Tyrannenklasse bilden die Gotteslügner, welche die »Gotteslästerer« bestrafen. Wenn doch ein allmächtiger Gott lebt, so kann er doch die »Gotteslästerer« selbst bestrafen. Was haben sich die Gläubigen in die Angelegenheit des »Lästerers« einzumischen? Warum lassen sie der Sache nicht freien Lauf, warum lassen sie Gott nicht selbst die Bestrafung vornehmen, was doch eine viel bessere Wirkung auf den Ungläubigen haben würde, und ihm zugleich die Existenz Gottes beweisen würde?!? Diese Statthalter Gottes werden vielleicht sagen, sie wären von ihm beauftragt, aber – soweit sie nicht Verrückte sind – wissen sie nur zu gut, dass kein Gott existirt, darum maassen sie sich eine vorgelogene Autorität an, um die Atheisten zu bekämpfen. – Doch wenn der Allmächtige in Wirklichkeit wäre, so wäre diese Autorität wirklich auch sein Werk, und ebenfalls sein Werk wäre die gegen ihn begangene Lästerung. Warum will er nun, dass ihn die Einen lästern, um dann von den Andern bestraft zu werden? Wozu diese Komödie? Ein Allmächtiger kann doch nicht etwa verrückt werden, – sonst wäre es ja mit seiner Allmacht aus.
In Wirklichkeit aber ist die Sache einfach diese: einen Herrgott giebt es nicht, und die Bestrafer der sogenannten Gotteslästerer sind verrückte oder bewusste Tyrannen.
XIII. – Tugend und Suende.
Alle Tyrannen sagen – selbst wenn sie nichts glauben – dass der Glaube zur Aufrechterhaltung der sogenannten Ordnung nöthig sei. Nichts ist richtiger denn dies! So bald diese fixe Idee fällt, so bald fällt auch die Unterscheidung von Tugend und Sünde und deren Substitute, denn jene ist ihre Basis: vom göttlichen Schwindel kommen Tugend und Sünde. Wenn nun der Ursprung wegfällt, und das Nebelprodukt in der Luft hängt, wird sich der Mensch fragen: Warum sollte eine Handlung tugendhaft oder sündhaft sein? Endlich, wenn das Hirngespinnst Gott sich als nichts erweist, wird der Mensch erkennen, dass eine Handlung an sich weder Tugend noch Sünde ist. Die Phrase von einem sittlichen Weltzweck ist ähnlich einer Seifenblase, welche am Interessenkampf sanft auffliegt und zerplatzt.
Die religiösen Schwindler sagen, dass der allgütige und allmächtige Gott die Menschen belohne und bestrafe. Wie kann man aber annehmen, dass der Allgütige die Menschen belohne oder bestrafe, die ER doch tugend- oder sündhaft gemacht hat; denn Alles soll ja nur durch ihn geschehen, Alles sei sein Werk. Wir haben aber gesehen, dass es keinen Allgerechten, noch Allmächtigen giebt, folglich liegt der Schwindel, von Hölle und Himmel klar auf der Hand. Wir haben weder Gott noch den Teufel, weder Himmel noch Hölle gesehen. Der grösste Schwindel aber ist wohl derjenige von der Fortdauer des individuellen Lebens nach dem Tode. Ein solcher Spuk muss geglaubt werden, einen solchen Sparren schafft sich nur ein Dummkopf an.
»Wir sind allzumal vollkommen, (sagt Stirner4 und auf der ganzen Erde ist nicht Ein Mensch, der ein Sünder wäre! Es giebt Wahnsinnige, die sich einbilden, Gott Vater, Gott Sohn oder der der Mann im Monde zu sein, und so wimmelt es auch von Narren, die sich Sünder zu sein dünken; aber wie jene nicht der Mann im Monde sind, so sind diese – keine Sünder. Ihre Sünde ist eingebildet.
»Aber, wirft man verfänglicherweise ein, so ist doch ihr Wahnsinn oder ihre Besessenheit wenigstens ihre Sünde. Ihre Besessenheit ist nichts als das, was sie – zu stande bringen konnten, das Resultat ihrer Entwicklung, wie Luther’s Bibelgläubigkeit eben Alles war, was er herauszubringen – vermochte. Der Eine bringt sich mit seiner Entwicklung in’s Narrenhaus, der Andere bringt sich damit in’s Pantheon und um die – Walhalla
»... Du hast den Sünder im Kopf mitgebracht darum fandest Du ihn, darum schobst Du ihn überall unter. Nenne die Menschen nicht Sünder, so sind sie’s nicht: Du allein bist der Schöpfer der Sünden: Du, der Du die Menschen zu lieben wähnst, Du gerade wirfst sie in den Koth der Sünde, Du gerade scheidest sie in Lasterhafte und Tugendhafte, in Menschen und Unmenschen, Du gerade besudelst sie mit dem Geifer Deiner Besessenheit; denn Du liebst nicht die Menschen, sondern den Menschen. Ich aber sage Dir, Du hast niemals einen Sünder gesehen, Du hast ihn nur – geträumt.«
Sündigen kann man nur gegen etwas Heiliges. Sobald nun die Entheiligung vollzogen ist, kann auch nicht mehr gesündigt werden, gerade wie nicht mehr gestohlen werden kann, sobald kein Eigenthum mehr vorhanden ist. Entheiligt das Heilige, und Tugend und Sünde haben keinen Sinn mehr.
Nicht besser als die Sünde ist die Tugend, auch sie ist eingebildet, auch sie ist ein Sparren. Die Tugend ist Gott wohlgefällig; da es aber keinen Herrgott giebt, so kann auch nichts gottwohlgefällig sein, folglich giebt es keine Tugend, Wie es keine Sünder giebt, so giebt es auch keine Tugendhafte.
XIV. – Zu was die Religion dient.
Zu was der ganze Gottes-Schwindel dient, ist klar, nämlich zur Ausbeutung der grossen Volksmasse. So lange der arme Teufel auf ein besseres Loos im Himmel hofft, wird er sich eher dazu bestimmen lassen, hier auf Erden im Elend zu leben. Die Pfaffen, die bekannter- maassen Heuchler sind und waren, sind jedoch als Leute bekannt, die ihren Leib stets gut gepflegt haben. Aber nicht nur den Pfaffen, sondern auch allen andern Gottesgnädlingen, als Kaisern, Königen, Regierern, Land-Lords, Kapitalisten, Rentiers, etc., dient der ReligionsSchwindel als famoses Mittel, um die Volksmassen einzuschläfern und darauf zu betrügen und zu bestehlen. Muss da nicht jeder Tyrann sagen, dass es einen Gott geben muss? Ja, die Religion ist das Sicherheits-Ventil, durch welches die zur Sklaverei überflüssige menschliche Intelligenz zum Teufel geht; und es muss eine Religion geben, – wenn eine Minderheit über eine Mehrheit herrschen soll.
Die Religion sucht mich zu vernichten, sie sucht mich zu ihrem Sklaven zu machen; sie will mir eine Bestimmung geben. Die Religion verlangt, dass ich einem »höhern« Wesen diene, und sucht mich daher zu verhindern, mir zu dienen. Sie verlangt von mir, dass ich mich für ein sog. »höheres Wesen« begeistere, hingebe, aufopfere. Dieses »höhere Wesen« soll für mich Alles sein, folglich sollte ich mir nichts sein. Ich aber bin mir selber Alles, und bin für nichts bestimmt. Diejenigen die dumm genug sind, zu glauben, sie wären für etwas »Höheres« bestimmt, werden dann schon von der Pfaffensippschaft derart gelenkt, dass der Dienst für das »höhere Wesen« auf die Pfaffenmühle fliesst.
Einem »höhern Wesen« zu dienen, ist die Essenz der Religion. Wie sich dieses »höhere Wesen« auch nenne, wer es auch sei, das ändert nichts an der Sache; es zu verehren, oder ihm zu dienen, ist und bleibt Götzendienst. Einem Atheisten geht nichts über sich. Wer einen »Höhern« anerkennt, ist religiös.
Jede Religion ist auf der Idee des Opfers basirt. Sie ist folglich grausam, ungerecht, herrisch, sie raubt mir meine Freiheit und Selbstangehörigkeit.
Die Religion will mir eine Obrigkeit geben, sei es nun eine weltliche oder eine spukliche; obrigkeitslos zu werden bestrebt sich der Atheist. Die Religion will mich unterordnen; sich zu empören bestrebt sich der Atheist. Die Religion will mir einen Herren vorsetzen; herrenlos zu werden ist das Ziel des Atheisten. Die -allgemeine Versklavung ist das Endziel der Religion^ die Entgötterung jedes Spuks, die Sprengung aller Ketten ist das Endziel des Atheisten. Wähle denn, ob du ein Knecht oder ein Herr sein willst. Davon hängt es ab, ob du einen Höhern anerkennen, oder ob du dir selbst der Höchste sein willst.
XV. – Schluss.
Es ist nicht wunderbar, dass der Gottes-Schwindel eine so ausgedehnte Verbreitung fand. Nachdem die Religion durch die Schwäche und Furcht der Menschen entstanden war, wurde sie von jenen, welche ein Interesse an ihr hatten, den Pfaffen und andern Schwindlern, mit allen möglichen Mitteln fortgepflanzt. Die Herrgotts-Schwindler erlaubten keine Kritik; sie scheuten die Logik; sie kämpften per Intrigue, sie torturirten die Ungläubigen geheim, sie stahlen im Namen Gottes – kurzum, ihre ganze Kampfweise beruhte auf Heuchelei. Der Scheiterhaufen und die Tortur mittelst dem Rad, der Daumschraube, dem spanischen Stiefel, dem Folterstuhl, etc. sind stumme und doch beredte Zeuge für die grausame Tyrannei der Pfaffenbrut. Nachdem das von verhältnissmässig wenigen Heuchlern regierte und idiotisirte Volk in der Barbarei dahinsiechte, war es da nicht begreiflich. dass die Gottespest triumphiren musste, so lange nur vereinzelte Atheisten auftraten, welche sogleich mit allen Mitteln ruinirt wurden? Solange nicht eine beträchtliche Menschemenge zum Bewusstsein kam, ward jedes öffentliche atheistische Auftreten von den Pfaffen mit Gift, Scheiterhaufen und andern Mitteln verunmöglicht.
Dass die Geschichte der Religions-Männer keinen Beweis für die Existenz Gottes liefert, ist klar; gegentheils, sie spricht für seine Nichtexistenz. Tyrannei in allen Formen, das ist die Frucht der Religion. Die Thaten der Religions-Leute haben – allgemein gesprochen – der von ihnen gepredigten Religion mit Fäusten in’s Gesicht geschlagen.
Wie lange blieben die Pfaffen wirkliche Diener Gottes? Bis die Zeit kam, Herren der Gläubigen zu werden.
Und dadurch, dass sie sich aus der Dienerschaft Gottes zu Ausbeutern emporrichteten, traten sie selbst die Religion mit Füssen. Sie thaten und thun gerade das Gegentheil von dem, was sie predigen; anstatt sich zu unterwerfen, empören sie sich; anstatt Diener zu sein, werden sie Herren. So traurig auch die Geschichte des Pfaffenthums ist, so liefert sie doch den unumstösslichen Beweis von der Existenz der empörenden Tendenz der Menschen. Kein Gläubiger wäre zu bekehren, wenn in ihm nicht schon ungläubige Keime vorhanden wären. Diese Neigung zur Ungläubigkeit ist aber trotz aller Pfaffen in den meisten Menschen noch vorhanden, so dass immerhin noch eine Aussicht auf Erfolg im Kampf gegen die Religionspest besteht. Jeder Mensch hat seit seiner Geburt ein Forschungs-Bestreben, er sucht die Dinge zu erkennen, sich dieselben zu erklären. Und dies ist gerade von der Religion verboten; sie verlangt einen Glauben, und wo dieser anfängt, ist alle Kritik zum Teufel. Wer sich dem Glaube ergiebt, der opfert seinen Verstand und seine Eigenheit, der wird ein Idealist, ein besessener Verächter des Materialismus.
Frägt man nach der Basis der Religionspest, so ist die Frage nunmehr leicht zu beantworten: es ist die Krankheit des Denkapparates; gerade wie es Leute giebt, welche an Verfolgungs-Wahn leiden, so giebt es auch Leute, welche an religiösem Wahn leiden. Und fragt man nach der Ursache dieses Wahnsinns, so giebt er hiefür nur eine Erklärung: nämlich die Pfaffen im Bunde mit der Noth. »Noth lehrt beten,« sagt das Sprichwort; und thatsächlich ist die Noth die beste Begründerin der Religion, wie auch die Religion die beste Begründerin der Noth ist. Hieraus folgt, dass bessere materielle Verhältnisse ein gutes Rezept gegen den religiösen Wahnsinn wären. Man kann sich hiervon leicht überzeugen, wenn man einen Blick auf die reichen Klassen der Christenheit wirft. Die Mehrheit derselben glaubt offenbar nicht an ihre Religion, denn ihre Handlungen stehen mit derselben meistens im Widerspruch- Dies lässt sich doch nur so erklären, dass die reichen Klassen infolge ihrer Wohlhabenheit, infolge eines besseren und gesunderen Lebens die Religion losgeworden sind. Das Anklammern an die Herrgotts-Idee geschieht einerseits aus hypnotischen Motiven, anderseits aus Furcht, Schwachheit, Mangel an Selbstvertrauen, geistigem Bankerott. Wenn Einer sich selbst verloren, oder sich nie gefunden hat, ergiebt er sich seinem Spuk. Die Religion ist folglich Gedanken-Herrschaft; der Religiöse ist von seiner Idee besessen.
Trotzdem der an religiösem Wahnsinn Siechende sich für gesund erklärt, ist er dennoch leidend, von Schmerzen beschwert, melancholisch, dünkelhaft gross, etc. Indern er für seine absolute, reine, fixe Idee lebt; verliert er sich selbst, verachtet und verzichtet auf die weltlichen Freuden (d. h. soweit dies möglich ist), er ist ja über das Weltliche, über das Sinnliche erhaben, er beschäftigt sich nur noch mit dem reinen, absoluten Geistigen, dem Spuck; daher nimmt er auch seine geknechtete Natur nicht richtig wahr; weil sein Körper-System krankt, wähnt er, die Welt sei krank, eitel, etc.
Endnoten.
1 Bakounin : Gott und der Staat
2 Heinrich Heine: im Nachwort zum »Romanzero.«
3 Corvin: Pfaffenspiegel; historische Denkmale des Fanatismus in der römisch-katholischen Kirche. – Rudolstadt, A. Book.
4 Max Stirner: Der Einzige und sein Eigenthum.
Kapital und Arbeit
Vorwort
Schon seit dem Entstehen der kapitalistischen Produktionsweise zeigt sich ein Streben, dieselbe wieder zu beseitigen und an deren Stelle eine gerechtere, gemeinnützigere zu errichten. Bald da, bald dort ließen sich diesbezügliche Stimmen vernehmen, allein es waren meist einseitige Klagelieder über die bestehenden Zustände, gepaart mit phantastischen Träumereien über zukünftige Gesellschaftsgebilde, Projekte, welche sich zwar eigneten, dem armen, gequälten Volke Trost und Hoffnung einzuflößen, die aber sonst von gar keiner Bedeutung waren und daher in der Regel bald ins Reich der Vergessenheit wanderten.
Erst in der Neuzeit gewannen die Bestrebungen, welche auf eine Umgestaltung der heutigen Produktionsweise resp. der heutigen Gesellschaft abzielen, festen Grund und praktische Stützpunkte - zum Schrecken aller Volksfeinde. Hier und da treiben zwar noch etliche unklare Köpfe oder bestochene Kreaturen der Reaktion ein frevelhaftes Spiel mit dem Volke, indem sie ihm Utopien vorgaukeln, allein die Erkenntnis bricht sich unter den arbeitenden Klassen zusehends Bahn, so daß die Zeit nicht mehr allzu ferne sein dürfte, wo selbst der schlichteste Proletarier über tragikomische Wahngebilde dieser Art nur noch mitleidig die Achseln zuckt, Eine Zukunft hat eben nur der wissenschaftliche Sozialismus.
Seit dem Erscheinen des „Kapital“ von Karl Marx hat der moderne Sozialismus eine feste Grundlage, eine unbesiegbare Waffe erlangt. Dieses Werk zerstört zwar alle optimistischen Illusionen, weil es darlegt, daß keine Gesellschaft nach individuellen Plänen ausgeklügelt und gemacht werden kann; es beseelt aber andererseits jeden klardenkenden Sozialdemokraten mit der vollsten Siegeszuversicht, weil es beweist, daß der Kapitalismus die Keime des Sozialismus resp. Kommunismus in sich birgt und daß ersterer mit naturgesetzlicher Notwendigkeit und durch seine eigenen Gesetze sich zum letzteren fortentwickeln muß.
„Das Kapital“ hat bereits, obgleich erst der 1. Band erschienen ist, eine große Verbreitung erlangt, allein in die Massen des arbeitenden Volkes ist es noch nicht so recht eingedrungen. Der Preis des Werkes, obgleich derselbe nicht einmal mit dem äußeren Umfange desselben, geschweige denn mit der darin enthaltenen Riesenarbeit im Einklange steht, ist bei der jammervollen Lage, in der die Arbeiter schmachten, einer solchen Verbreitung, wie sie wünschenswert wäre, hinderlich. Außerdem steht dem Verständnis des Buches - ich, der ich selbst Proletarier bin, darf dies schon hervorheben - die Unbildung des Volkes im Wege. Es ist wahr, Marx hat sich Mühe gegeben, so populär zu schreiben, wie es die Wissenschaftlichkeil des Stoffes nur immer zuließ, allein er setzte doch eine Vorbildung voraus, die, dank der systematisch betriebenen Volksverdummung, nicht allgemein vorhanden ist.
Um nun den Arbeitern wenigstens das Wesentlichste dieses hochwichtigen Werkes zum billigen Preis und in leichtfaßlichen Formen gekleidet zugänglich zu machen, habe ich unter anderem meine Zwangsmuße dazu benutzt, das „Kapital“ auszugsweise zu popularisieren.
Vieles habe ich wörtlich oder nur mit geringen Abänderungen - hauptsächlich unter Vermeidung der nicht allgemein gebräuchlichen Fremdwörter - wiedergegeben. Manches jedoch glaubte ich nur summarisch ausführen zu sollen, und einiges, was mir unwesentlich zu sein schien, habe ich ganz übergangen. Ungern nahm ich Abstand, die zahlreichen Daten, welche die Lage der arbeitenden Klassen des näheren charakterisieren, anzuführen, allein der gedrängte Raum, welchen eine Broschüre, die agitatorisch wirken soll, nicht überschreiten darf, verpflichtete mich dazu, übrigens dürfte jeder Arbeiter aus eigener Erfahrung wissen, wie es in dieser Hinsicht steht. Eingeteilt habe ich die Arbeit mehr oder weniger willkürlich, wie es mir der größeren Leichtfaßlichkeit wegen geboten erschien.
Wenn die vorliegende Broschüre manchem die Augen öffnet, habe ich meinen beabsichtigten Zweck erreicht. Ich kann aber schließlich nicht unterlassen, jeden, der die Mittel dazu hat, zur Anschaffung des Marxschen Werkes zu ermuntern, was hiermit geschieht.
Zwickau, im Oktober 1873.
Und nun Gruß und Handschlag den Lesern!
Joh. Most
Ware und Geld
Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform.
Ein Ding, welches sich eignet, menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art zu befriedigen, als Gebrauchsgegenstand zu dienen, ist ein Gebrauchswert. Um Ware zu werden, muß es noch eine andere Eigenschaft besitzen - Tauschwert.
Der Wert der Waren, der sich in ihrem Tauschwert ausdrückt, besteht aus nichts andrem als der Arbeit, die in ihrer Erzeugung verbraucht wird oder in ihnen vergegenständlicht ist. Doch muß man sich genau klarmachen, in welchem Sinne die Arbeit die einzige Quelle des Wertes ist.
In unentwickelten Gesellschaftszuständen verrichtet derselbe Mensch abwechselnd Arbeiten sehr verschiedener Art; bald bestellt er den Acker, bald webt, bald schmiedet, bald zimmert er usw. Aber wie mannigfach seine Beschäftigungen seien, sie sind doch immer nur verschiedene nützliche Weisen, worin er sein eigenes Hirn, seine Nerven, Muskeln, Hände usw. verwendet, worin er mit einem Wort seine eigene Arbeitskraft verausgabt. Seine Arbeit bleibt stets Kraftaufwand - Arbeit schlechthin -, während die nützliche Form dieses Aufwands, die Arbeitsart, je nach der von ihm bezweckten Nutzleistung wechselt.
Mit dem gesellschaftlichen Fortschritt vermindern sich nach und nach die verschiedenen nützlichen Arbeitsarten, welche dieselbe Person der Reihe nach, verrichtet; sie verwandeln sich mehr und mehr in selbständige, nebeneinanderlaufende Berufsgeschäfte verschiedener Personen und Personengruppen. Die kapitalistische Gesellschaft aber, wo der Produzent von vornherein nicht für eigenen, sondern für fremden Bedarf, für den Markt produziert, wo sein Produkt von Haus aus bestimmt ist, die Rolle der Ware zu spielen, ihm selbst daher nur als Tauschmittel zu dienen - die kapitalistische Gesellschaft ist nur möglich, sobald sich die Produktion bereits zu einem vielgliedrigen System selbständig nebeneinander betriebener nützlicher Arbeitsarten entwickelt hat, zu einer weitverzweigten gesellschaftlichen Teilung der Arbeit.
Was aber früher für ein Individuum galt, welches abwechselnd verschiedene Arbeiten verrichtet, gilt jetzt für diese Gesellschaft mit ihrer gegliederten Arbeitsteilung. Der nützliche Charakter jeder besonderen Arbeitsart spiegelt sich wider in dem besonderen Gebrauchswert ihres Produkts, d. h. in der eigentümlichen Formveränderung, wodurch sie einen bestimmten Naturstoff einem bestimmten menschlichen Bedürfnisse dienstbar gemacht hat. Aber der selbständige Betrieb jeder dieser unendlich mannigfachen nützlichen Arbeitsarten ändert nichts daran, daß eine wie die andere Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist, und nur in dieser ihnen gemeinsamen Eigenschaft von menschlichem Kraftaufwand bilden sie den Warenwert. Der Wert der Waren besagt weiter nichts, als daß die Herstellung dieser Dinge Verausgabung menschlicher Arbeitskraft gekostet hat, und zwar der gesellschaftlichen Arbeitskraft, da bei entwickelter Teilung der Arbeit jede individuelle Arbeitskraft nur noch als ein Bestandteil der gesellschaftlichen Arbeitskraft wirkt. Jede Menge individueller Arbeit - im Sinne von Kraftaufwand - zählt daher fortan auch nur als größere oder geringere Menge von gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit, d. h. von Durchschnittsaufwand der gesellschaftlichen Arbeitskraft. Je mehr Durchschnittsarbeit in einer Ware vergegenständlicht ist, desto größer ist deren Wert.
Würde die zur Herstellung einer Ware notwendige Durchschnittsarbeit sich beständig gleichbleiben, so bliebe auch deren Wertgröße unverändert. Dies ist aber nicht der Fall, weil die Produktivkraft der Arbeit durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe der Wissenschaft und ihre technische Anwendbarkeit, die gesellschaftlichen Kombinationen des Produktionsprozesses, den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der Produktionsmittel und durch Naturverhältnisse bestimmt wird, also sehr verschiedenartig sein kann. Je größer die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels erheischte Arbeitszeit, desto kleiner die in ihm kristallisierte Arbeitsmasse, desto kleiner sein Wert. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit, desto größer die zur Herstellung eines Artikels notwendige Arbeitszeit, desto größer sein Wert. Daß hier nur von der jeweiligen gesellschaftlich normalen Produktivkraft und der ihr entsprechenden gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit die Rede ist, versteht sich von selbst. Der Handweber braucht z. B. mehr Arbeit als der Maschinenweber, um eine bestimmte Anzahl Ellen zu liefern. Er erzeugt deshalb keinen höheren Wert, sobald die Maschinenweberei einmal eingebürgert ist. Es wird dann vielmehr die ganze Arbeit, welche bei der Handweberei mehr verbraucht wird, als zur Herstellung einer gleichen Warenmenge durch die Maschinenweberei nötig wäre, nutzloser Kraftaufwand und bildet daher keinen Wert.
Dinge, welche nicht durch Arbeit entstanden sind, wie z. B. Luft, wildwachsendes Holz etc., können wohl Gebrauchswert haben, nicht aber Wert. Andererseits werden Dinge, welche die menschliche Arbeit erzeugt, nicht zu Waren, wenn sie nur zur Befriedigung von Bedürfnissen ihrer unmittelbaren Erzeuger dienen. Um Ware zu werden, muß ein Ding fremde Bedürfnisse befriedigen, also gesellschaftlichen Gebrauchswert haben.
Kehren wir jetzt zum Tauschwert zurück, also zur Form, worin sich der Wert der Waren ausdrückt. Diese Wertform entwickelt sich nach und nach aus und mit dem Produktenaustausch.
Solange die Produktion ausschließlich auf den Selbstbedarf gerichtet ist, kommt Austausch nur selten vor und nur mit Bezug auf den einen oder anderen Gegenstand, wovon die Austauschenden gerade einen Überfluß besitzen. Es werden z. B. Tierfelle gegen Salz ausgetauscht, und zwar zunächst in ganz zufälligem Verhältnisse. Bei öfterer Wiederholung des Handels wird das Austauschverhältnis schon näher bestimmt, so daß sich ein Tierfell nur gegen eine gewisse Menge Salz austauscht. Auf dieser untersten Stufe des Produktenaustausches dient jedem der Austauschenden der Artikel des andern als Äquivalent (Gleichwertiges), d. h. als ein Wertding, das als solches nicht nur mit dem von ihm produzierten Artikel austauschbar ist, sondern auch der Spiegel ist, worin der Wert seines eigenen Artikels zum Vorschein kommt.
Die nächst höhere Stufe des Austausches finden wir noch heute, z. B. bei den Jägerstammen Sibiriens, die sozusagen nur einen für den Austausch bestimmten Artikel liefern, nämlich Tierfelle. Alle fremden Waren, die man ihnen zuführt, Messer, Waffen, Branntwein, Salze etc., dienen ihnen als ebenso viele verschiedene Äquivalente ihres eigenen Artikels. Die Mannigfaltigkeit der Ausdrücke, welche der Wert der Tierfelle so erhielt, machten es zur Gewohnheit, sich ihn vom Gebrauchswert des Produkts getrennt vorzustellen, während andererseits die Notwendigkeit, denselben Wert in einer stets wachsenden Anzahl verschiedener Äquivalente zu berechnen, zur festen Bestimmung seiner Größe führte. Der Tauschwert der Tierfelle besitzt also hier schon eine viel ausgeprägtere Gestalt als bei dem früher nur vereinzelten Produktenaustausch, und diese Dinge selbst besitzen daher nun auch in ungleich höherem Grade schon den Charakter von Ware.
Wie jede Ware, kann das Geld seine eigene Wertgröße nur in anderen Waren ausdrücken. Sein eigener Wert ist bestimmt durch die zu seiner Produktion erheischte Arbeitszeit und drückt sich in dem Quantum jeder anderen Ware aus, worin gleich viel Arbeitszeit geronnen ist. Man lese die einzelnen Posten eines Preiskurantes rückwärts, und man findet die Wertgröße des Geldes in allen möglichen Waren ausgedrückt.
Vermittelst des Geldes wird der Produktenaustausch in zwei verschiedene und einander ergänzende Vorgänge zerlegt. Die Ware, deren Wert bereits in ihrem Preise ausgedrückt ist, wird in Geld verwandelt und dann wieder aus ihrer Geldgestalt in eine andere, zum Gebrauche bestimmte Ware von gleichem Preise rückverwandelt. Was aber die handelnden Personen betrifft, so veräußert ein Warenbesitzer erst seine Ware an einen Geldbesitzer, verkauft und tauscht dann mit dem gelösten Gelde Artikel eines anderen Warenbesitzers ein, er kauft. Es wird verkauft, um zu kaufen. Die Gesamtbewegung der Ware nennt man - Warenzirkulation.
Auf den ersten Blick scheint es, als ob die Menge des in einem Zeitabschnitt umlaufenden Geldes lediglich durch die Preissumme aller räumlich nebeneinander zum Verkauf gelangenden Waren bestimmt sei, allein dem ist nicht so. Werden z. B. 3 Pfd. Butter, 1 Bibel, 1 Flasche Schnaps und 1 Kriegsdenkmünze von vier verschiedenen Verkäufern an vier verschiedene Käufer gleichzeitig zu je 1 Taler entäußert, so sind in der Tat zur Bewerkstelligung dieser vier Verkäufe zusammen 4 Taler nötig. Verkauft aber der eine seine Butter und trägt den erlangten Taler zum Bibelhändler, der seinerseits wieder für 1 Taler Schnaps kauft, und schafft sich der Schnapsbrenner für diesen Taler eine Kriegsdenkmünze an, so ist zur Bewerkstelligung des Umlaufs von Waren, die zusammen einen Preis von 4 Taler haben, nur 1 Taler nötig. Wie im Kleinen, so im Großen. Die Menge des umlaufenden Geldes wird daher bestimmt durch die Preissumme der räumlich nebeneinander zum Verkauf gelangenden Waren, dividiert durch die Anzahl der gleichzeitigen Umläufe der nämlichen Geldstücke.
Zur Vereinfachung des Zirkulationsprozesses werden bestimmte Gewichtsteile der als Geld anerkannten Dinge mit eigenen Namen belegt und in festen Gestalten ausgeprägt, d. h. zu Münze gemacht.
Da sich aber Gold- oder Silbermünzen im Umlauf verschleißen, ersetzt man sie teilweis durch Metalle von niederem Wert. Die geringsten Bruchteile der kleinsten Goldmünze z. B. werden durch Marken aus Kupfer etc. (Scheidemünze) vertreten; endlich stempelt man fast wertlose Dinge zu Geld, z. B. Papierzettel, welche eine bestimmte Menge von Gold oder Silber symbolisch (sinnbildlich) darstellen. Letzteres ist ganz unmittelbar der Fall bei Staatsnoten mit Zwangskurs.
Wird Geld aus der Zirkulation herausgenommen und festgehalten, so entsteht Schatzbildung. Wer Waren verkauft, ohne neuerdings solche zu kaufen, ist Schatzbildner. Bei Völkern mit unentwickelter Produktion, z. B. bei den Chinesen, wird die Schatzbildung ebenso emsig als planlos betrieben; man vergräbt Gold und Silber.
Aber auch in Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise ist Schatzbildung notwendig. Da Masse, Preise und Umlaufsgeschwindigkeit der in Zirkulation befindlichen Waren beständigem Wechsel unterworfen sind, erfordert auch ihre Zirkulation bald weniger, bald mehr Geld. Es sind also Reservoirs (Behälter) nötig, wohin Geld aus dem Umlauf abfließt und woraus es, je nach Bedarf, wieder in Umlauf kommt. Die entwickeltste Form solcher Zufuhr- und Abzugskanäle des Geldes oder Schatzkammern sind die Banken. Als Notwendigkeit stellen sich solche Einrichtungen um so mehr heraus, je weniger in der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft der Warenumlauf: Ware-Geld-Ware sich in bezug aufs Geld in direkt greifbarer Form vollzieht. Abgesehen vom eigentlichen Kleinhandel funktioniert vielmehr das Geld vorzugsweise als bloßes Rechengeld und in letzter Instanz als Zahlungsmittel. Käufer und Verkäufer werden Schuldner und Gläubiger. Die Schuldverhältnisse werden durch Bescheinigungen festgestellt, mittelst welcher die verschiedenen, bei der Warenzirkulation beteiligten, bald kaufenden, bald verkaufenden Personen die gegenseitig sich schuldenden Summen ausgleichen. Nur die Differenzen werden von Zeit zu Zeit durch eigentliches Geld getilgt. Tritt bei diesem Verfahren eine allgemeine Stockung ein, so nennt man dies eine Geldkrise, die sich dadurch fühlbar macht, daß jedermann leibhaftiges Geld verlangt und vom ideellen nichts wissen will.
Von besonderer Wichtigkeit sind die Schatzreservoirs für den Weltverkehr, da das Weltgold in der Regel in Form von Gold- und Silberbarren auftritt.
Kapital und Arbeit
Wie wird nun Geld in Kapital verwandelt?
Von Kapital kann überhaupt nur die Rede sein in einer Gesellschaft, die Waren produziert, bei welcher Warenzirkulation besteht, die Handel treibt. Nur unter diesen historischen Voraussetzungen kann Kapital entstehen. Von der Schöpfung des modernen Welthandels, und Weltmarkts im 16. Jahrhundert datiert die moderne Lebensgeschichte des Kapitals.
Historisch tritt das Kapital dem Grundeigentum überall zunächst in der Gestalt von Geld gegenüber, von Geldvermögen, Kaufmannskapital und Wucherkapital, Geld als Geld und Geld als Kapital unterscheiden sich zunächst nur durch ihre verschiedene Zirkulationsform.
Neben der unmittelbaren Form der Warenzirkulation, verkaufen, um zu kaufen (Ware-Geld-Ware), tritt nämlich auch noch eine andere Zirkulationsform auf; kaufen, um zu verkaufen (Geld-Ware-Geld). Hier spielt nun das Geld bereits die Rolle des Kapitals. Während bei der einfachen Warenzirkulation durch Vermittelung des Geldes Ware gegen Ware ausgetauscht wird, tauscht man bei der Geldzirkulation durch Vermittelung der Ware Geld gegen Geld aus.
Wollte man auf diesem Wege Geld gegen gleich viel Geld, z. B. 100 Taler gegen 100 Taler austauschen, so wäre dies ein ganz abgeschmacktes Verfahren; es wäre viel vernünftiger, wenn die 100 Taler von vornherein festgehalten würden. Solch ein zweckloser Austausch wird aber niemals beabsichtigt, sondern man tauscht Geld gegen mehr Geld aus, man kauft, um teurer zu verkaufen.
Bei der einfachen Warenzirkulation fällt sowohl die Ware, welche zuerst, als die Ware, welche zuletzt auftritt etc., aus der Zirkulation heraus, wird konsumiert; wenn hingegen Geld den Anfangs- und Endpunkt der Zirkulation bildet, so kann das zuletzt erscheinende Geld immer wieder aufs neue dieselbe Bewegung beginnen, es bleibt überhaupt nur solange Kapital, als es dies tut. Nur der Geldbesitzer, welcher sein Geld diese Art von Umlauf durchmachen läßt, ist Kapitalist.
Der Gebrauchswert ist also nie als unmittelbarer Zweck des Kapitalisten zu behandeln. Auch nicht der einzelne Gewinn, sondern nur die rastlose Bewegung des Gewinnes. Dieser absolute Bereicherungstrieb, die leidenschaftliche Jagd auf den Tauschwert ist dem Kapitalisten mit dem Schatzbildner gemein, aber während der Schatzbildner nur der verrückte Kapitalist, ist der Kapitalist der gescheite Schatzbildner.
Am augenfälligsten tritt die Tendenz: kaufen, um teurer zu verkaufen, beim Handelskapital hervor, allein auch das industrielle Kapital hat ganz dieselbe Tendenz.
Meist wird angenommen, der Mehrwert entsteht dadurch, daß die Kapitalisten ihre Waren über deren eigentlichen Wert verkaufen. Dieselben Kapitalisten, welche verkaufen, müssen aber auch kaufen, müßten also gleichfalls Waren über deren Wert bezahlen, so daß, wenn jene Annahme richtig wäre, die Kapitalistenklasse niemals ihr Ziel erreichen könnte. Sieht man aber ab von der Klasse und betrachtet nur die einzelnen Kapitalisten, so stellt sich folgendes heraus: Ein Kapitalist kann wohl z. B. Wein zum Betrage von 40 Taler gegen Korn im Betrage von 50 Taler eintauschen, so daß er beim Verkaufe 10 Taler gewinnt, allein die Wertsumme dieser beiden Waren bleibt nach wie vor 90 Taler und ist lediglich anders verteilt. Hätte der eine dem andern direkt 10 Taler gestohlen, so stände es nicht anders. „Krieg ist Raub“, sagt Franklin, „Handel ist Prellerei“. Mehrwert entsteht also auf solche Weise nicht. Auch der Wucherer, der direkt für Geld mehr Geld eintauscht, erzeugt keinen Mehrwert. Er zieht nur vorhandenen Wert aus fremder Tasche in die seinige. Es entsteht daher, mögen sich die einzelnen Kapitalisten gegenseitig noch sosehr beschwindeln, durch Kauf und Verkauf allein keinesfalls Mehrwert. Dieser wird vielmehr außerhalb der Zirkulationssphäre geschaffen und in derselben nur realisiert, versilbert.
Geld heckt nicht, und Waren vermehren sich auch nicht von selbst, mögen sie noch sooft die Hände wechseln. Es muß also mit der Ware, nachdem sie gekauft ist und ehe sie wieder verkauft wird, etwas passieren, was deren Wert erhöht. Sie muß auf der Zwischenstation verbraucht werden.
Um aber aus dem Verbrauch einer Ware Tauschwert herauszuziehen, müßte der Geldbesitzer auf dem Markte eine Ware finden, welche die wunderbare Eigenschaft hätte, sich während ihres Verbrauchs in Wert zu verwandeln, deren Verbrauch also Wertschöpfung wäre. Und in der Tat findet der Geldbesitzer auf dem Markte solche Ware: die Arbeitskraft.
Unter Arbeitskraft oder Arbeitsvermögen verstehen wir den Inbegriff der physischen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existieren und die er in Bewegung setzt, sooft er Gebrauchswert irgendeiner Art produziert.
Damit ein Mensch seine eigene Arbeitskraft als Ware feilbiete, muß er vor allem über sie verfügen können, eine freie Person sein, und um dies zu bleiben, darf er sie stets nur zeitweise verkaufen. Verkauft er sie ein für allemal, so würde er sich aus einem Freien in einen Sklaven verwandeln, aus einem Warenbesitzer in Ware.
Ein freier Mensch ist gezwungen, seine eigene Arbeitskraft als Ware zu Markte zu führen, sobald er außerstand ist, andere Waren zu verkaufen, in denen seine Arbeit bereits vergegenständlicht ist. Will jemand seine Arbeit in Waren verkörpern, so muß er Produktionsmittel (Rohstoffe, Werkzeuge etc.) besitzen und zudem Lebensmittel, wovon er bis zum Verkauf seiner Ware zehrt. Entblößt von solchen Dingen kann er platterdings nicht produzieren und bleibt ihm zum Verkauf nur die eigene Arbeitskraft.
Zur Verwandlung von Geld in Kapital muß der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinne, daß er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, daß er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Betätigung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Mit anderen Worten: Der Arbeiter darf kein Sklave sein, darf aber auch außer seiner Arbeitskraft kein Besitztum haben, muß ein Habenichts sein, wenn ihn der Geldbesitzer genötigt finden soll, seine Arbeitskraft zu verkaufen.
Es ist dies jedenfalls kein Verhältnis, das naturgesetzlich begründet werden kann, denn die Erde erzeugt nicht auf der einen Seite Geld- und Warenbesitzer und auf der andern bloße Besitzer von Arbeitskraft. Die geschichtliche Entwicklung und eine ganze Reihe von ökonomischen und sozialen Umwälzungen haben dies Verhältnis erst geschaffen.
Die Ware Arbeitskraft besitzt wie jede andere Ware einen Wert, der bestimmt wird durch die zur Produktion - hier auch zur Reproduktion - des Artikels notwendigen Arbeitszeit. Der Wert der Arbeitskraft ist daher gleich dem Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel. Unter Erhaltung ist hier natürlich dauernde Erhaltung, welche Fortpflanzung einbegreift, zu verstehen. So wird der Tauschwert der Arbeitskraft bestimmt, ihr Gebrauchswert zeigt sich erst beim Verbrauch derselben.
Der Verzehr von Arbeitskraft, wie von jeder andern Ware, vollzieht sich außerhalb des Bereichs der Warenzirkulation, weshalb wir letztere verlassen müssen, um dem Geldbesitzer und dem Besitzer von Arbeitskraft nach der Stätte der Produktion zu folgen. Hier wird sich zeigen, nicht nur wie das Kapital produziert, sondern auch wie Kapital produziert wird.
Haben wir bisher nur freie, kurz, ebenbürtige Personen miteinander verkehren sehen, die nach Gutdünken über das Ihrige verfügen, kaufen und verkaufen, so bemerken wir schon beim Scheiden von unserem bisherigen Schauplatze und indem wir den handelnden Personen zur Produktionsstätte folgen, daß sich die Physiognomien derselben verändern. Der ehemalige Geldbesitzer schreitet voran als Kapitalist, der Arbeitskraftbesitzer folgt ihm nach als sein Arbeiter; der eine bedeutungsvoll schmunzelnd und geschäftseifrig, der andere scheu, widerstrebsam, wie jemand, der seine eigene Haut zu Markt getragen und nun nichts anderes zu erwarten hat als die - Gerberei.
Die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise
Der Verbrauch der Arbeitskraft ist die Arbeit selbst. Der Käufer der Arbeitskraft verzehrt sie, indem er ihren Verkäufer arbeiten läßt.
Der Arbeitsprozeß besteht zunächst darin, daß der Mensch Naturstoffe nach seinen Zwecken umformt. Die Naturstoffe selbst sind ursprünglich vorhanden. Alles, was der Mensch unmittelbar vom Erdganzen loslöst, sind von Natur aus vorgefundene Arbeitsgegenstände; Dinge hingegen, an denen bereits menschliche Arbeit vollzogen wurde und die nur weiterverarbeitet werden, sind Rohstoffe. Zu den ersteren gehört z. B. das Erz, welches aus seiner Ader losgebrochen wird, zu den letzteren das bereits losgebrochene Erz, welches eingeschmolzen wird. -
Arbeitsmittel sind jene Dinge, welche der Mensch zur Bearbeitung von Arbeitsgegenständen benützt. Solche Arbeitsmittel können bloßes Naturprodukt sein oder bereits menschliche Arbeit in sich bergen: allgemeines Arbeitsmittel ist und bleibt die Erde selbst.
Das Resultat des Arbeitsprozesses ist das Produkt. Produkte können in verschiedenen Formen aus dem Arbeitsprozeß hervorgehen. Sie mögen nur zur Konsumtion taugen oder nur zu Arbeitsmitteln oder nur als Rohmaterial (Halbfabrikat) verwendbar sein, das weiterer Verarbeitung bedarf, oder in verschiedener Weise dienen, wie z. B. die Traube als Konsumtionsmittel und als Rohmaterial des Weines. Sobald Produkte zur Erzeugung anderer Produkte verwendet werden, verwandeln sie sich in Produktionsmittel.
Kehren wir nun nach diesen allgemeinen Erklärungen zum kapitalistischen Produktionsprozeß zurück!
Nachdem der Geldbesitzer Produktionsmittel und Arbeitskraft gekauft hat, läßt er letztere die ersteren konsumieren, d. h. in Produkte, verwandeln. Der Arbeiter verzehrt gleichsam Produktionsmittel, indem er deren Formen ändert. Das Resultat dieses Prozesses sind die umgestalteten Produktionsmittel, in welche während ihres Formenwechsels neue Arbeit eingegangen ist, sich vergegenständlicht hat. Diese verwandelten Dinge, die Produkte, gehören aber nicht den Arbeitern, die sie erzeugt haben, sondern dem Kapitalisten. Denn er hat nicht nur die Produktionsmittel gekauft, sondern auch die Arbeitskraft und die ersteren durch Zusatz der letzteren sozusagen zur Gärung gebracht. Der Arbeiter spielt hierbei nur die Rolle eines selbsttätigen Produktionsmittels.
Der Kapitalist fabriziert Artikel nicht für eigenen Hausgebrauch, sondern für den Markt, also Waren. Aber damit allein ist ihm keineswegs gedient. Ihm gilt's, Waren zu fabrizieren, deren Wert höher ist als die Wertsumme der zu ihrer Erzeugung nötigen Produktionsmittel und Arbeitskraft, kurz, er verlangt Mehrwert.
Die Erlangung von Mehrwert ist eigentlich die einzige Triebfeder, welche den Geldbesitzer anspornt, sein Geld in Kapital zu verwandeln und zu produzieren. Sehen wir zu, wie dieses Ziel erreicht wird!
Wie schon bemerkt, wird der Wert jeder Ware durch die zu ihrer Herstellung notwendige Arbeitszeit bestimmt; wir müssen daher auch die vom Kapitalisten produzierte Ware in die darin verkörperte Arbeitszeit auflösen.
Nehmen wir an, das Rohmaterial zur Herstellung eines Artikels koste 3 Taler und das, was an Arbeitsmitteln aufgeht, koste 1 Taler; nehmen wir ferner an, diese 4 Taler repräsentierten das Wertprodukt von 2 zwölfstündigen Arbeitstagen, so ergibt sich, daß zunächst in dem fertigen Artikel 2 Arbeitstage vergegenständlicht sind. Rohmaterial und Arbeitsmittel werden aber nicht von selbst zu Ware, sondern nur durch Vermittelung von Arbeit; es ist also nachzusehen, wieviel Arbeitszeit der gedachte Produktionsprozeß beansprucht. Gesetzt, sie daure nur 6 Stunden und es seien auch gerade nur 6 Stunden nötig, um den Wert der angewandten Arbeitskraft zu ersetzen. Der Tageswert der Arbeitskraft ist bestimmt durch den Wert der zu ihrer Erzeugung resp. Erhaltung täglich verbrauchten Waren. Kostet deren Herstellung daher 6 Arbeitsstunden, so wird der Tageswert der Arbeitskraft in 6 Arbeitsstunden ersetzt und drückt sich nach unserer obigen Annahme in einem Preise von 1 Taler aus. In dem fertigen Produkt stecken also im ganzen 2½ Arbeitstage, oder sein Gesamtpreis beträgt 5 Taler; aber 5 Taler hat der Kapitalist selbst dafür gezahlt, 4 für Rohmaterial und Arbeitsmittel, 1 für Arbeitskraft. Daß bei solcher Gelegenheit kein Mehrwert herauskommen kann, liegt auf der Hand. Dem Kapitalisten paßt dies aber nicht in den Kram: Er will Mehrwert haben, sonst tut er nicht mit. Das Rohmaterial ist unerbittlich, auch die Arbeitsmittel sind es. Sie enthalten soundso viel Arbeitszeit und haben ihren bestimmten Wert, welchen der Kapitalist bezahlen muß, aber sie vermehren sich nicht. Bleibt noch die angekaufte Arbeitskraft. Der Kapitalist sieht ein, daß der Arbeiter täglich soviel Lebensmittel braucht als in 6 Arbeitsstunden herstellbar sind, d. h. Lebensmittel zum Preise von 1 Taler, somit zahlt er ihm für seine tägliche Arbeitskraft 1 Taler. Er sieht aber nicht ein, weshalb sich nun die also angekaufte Arbeitskraft auch nur 6 Stunden täglich betätigen solle, verlangt vielmehr, daß sie sich täglich 12 Stunden lang betätigen, d.h. eine Zeit hindurch, die in unserem Falle einen Wert von 2 Talern erzeugt. Das Rätsel löst sich. Wir sahen, daß innerhalb 6 Stunden für 3 Taler Rohmaterial und für 1 Taler Arbeitsmittel durch die Arbeitskraft, welche ebenfalls 1 Taler kostet, in ein Produkt verwandelt wurden, das 5 Taler wert ist bzw. 2½ Arbeitstage enthält. Ohne der Arbeitskraft gegenüber mehr als 1 Taler auszugeben, läßt nun aber der Schlaumeier von Kapitalist dieselbe nicht 6, sondern 12 Stunden lang wirken, läßt sie in dieser Zeit nicht Rohmaterial für 3, sondern für 6 Taler und nicht Arbeitsmittel für 1, sondern für 2 Taler aufzehren und erhält auf diese Weise ein Produkt, in welchem 5 Arbeitstage vergegenständlicht sind und das somit 10 Taler wert ist. Ausgegeben hat er aber nur: für Rohmaterial 6 Taler, für Arbeitsmittel 2 Taler und für Arbeitskraft 1 Taler, zusammen 9 Taler. Das fertige Produkt enthalt also jetzt einen Mehrwert von 1 Taler.
Man sieht, es kann nur dadurch Mehrwert entstehen, daß die Arbeitskraft sich in einem höheren Grade betätigt, als zum Ersatz ihres eigenen Werts notwendig ist. Deutlicher: Der Mehrwert entspringt aus unbezahlter Arbeit.
Um den Grad, in welchem die Arbeitskraft Mehrwert erzeugt, kennenzulernen, muß man das zur Produktion verwandte Kapital in zwei Teile zerlegen, wovon der eine in Rohmaterial und Arbeitsmittel, der andere in Arbeitskraft angelegt ist. Werden z. B. 5000 Taler in der Weise bei der Produktion verausgabt, daß man für 4100 Taler Rohstoffe und Arbeitsmittel und für 900 Taler Arbeitskraft verbraucht, und beträgt der Wert der fertigen Ware 5900 Taler, so scheint es, als ob ein Mehrwert von 18% erzeugt worden sei, wenn man sich nämlich einbildet, der gewonnene Mehrwert entspringe aus dem ganzen verauslagten Kapital. Für 4100 Taler Rohmaterial und Arbeitsmittel sind aber ihrem Werte nach unverändert geblieben, nur ihre Form ist eine andere geworden; die Arbeitskraft hingegen, für welche man 900 Taler vorschoß, hat während dem Verbrauch des Rohmaterials und der Arbeitsmittel denselben einen Wert von 1800 Taler zugesetzt und mithin einen Mehrwert von 900 Taler erzeugt. Der Kapitalist hat daher aus der Arbeitskraft einen Mehrwert von 100% herausgeschlagen, denn sie hat ihre Erzeugungskosten zweifach ersetzt, aber nur einfach erhalten; sie ist während einer Hälfte der Arbeitszeit umsonst verausgabt worden.
Da mögen sich die Kapitalisten und ihre Professoren drehen und wenden, wie sie wollen, von „Entbehrungslohn“, von „Risiko“ usw. usw. faseln, es ist umsonst. Arbeitsmaterial und Arbeitsmittel bleiben, was sie sind, und schaffen von selbst keine neuen Werte; es ist die Arbeitskraft und nur die Arbeitskraft, welche Mehrwert zu erzeugen vermag.
Der Arbeitstag
Unter gleichbleibenden Produktionsbedingungen ist die notwendige Arbeitszeit, welche der Arbeiter braucht, um den vom Kapitalisten ihm gezahlten Wert resp. Preis seiner Arbeitskraft zu ersetzen, eine durch diesen Wert selbst begrenzte Größe. Sie zählt z. B. 6 Stunden, wenn die Erzeugung der im Durchschnitt berechneten täglichen Lebensmittel des Arbeiters 6 Arbeitsstunden kostet. Je nachdem dann die Mehrarbeit, welche dem Kapitalisten den Mehrwert liefert, 4, 6 etc. Stunden währt, zählt der ganze Arbeitstag 10, 12 etc. Stunden. Je länger die Mehrarbeit, desto länger unter diesen Umständen der Arbeitstag.
Doch ist die Mehrarbeit und mit ihr der Arbeitstag nur innerhalb gewisser Grenzen ausdehnbar. Wie z. B. ein Pferd durchschnittlich nur 8 Stunden täglich zu arbeiten vermag, so kann auch der Mensch täglich nur eine bestimmte Zeit lang arbeiten. Es kommen dabei nicht nur physische, sondern auch moralische Bedingungen in Rechnung. Es handelt sich nicht allein darum, wieviel Zeit der Mensch braucht, um zu schlafen, zu essen, sich zu reinigen etc., sondern auch darum, welche geistigen und sozialen Bedürfnisse er befriedigen muß, was durch den allgemeinen Kulturzustand einer Gesellschaft bestimmt ist. Diese Schranken, welche dem Arbeitstage gesteckt sind, zeigen aber immerhin so große Dehnbarkeit, daß man Arbeitstage von 8, 10, 12, 14, 16, 18 und noch mehr Stunden nebeneinander antrifft.
Kürzer muß also ein Arbeitstag jedenfalls sein als ein Lebenstag von 24 Stunden, allein es fragt sich: um wieviel? Der Kapitalist hat darüber ganz eigene Ansichten. Als Kapitalist ist er nur ein personifiziertes Kapital. Seine Seele ist die Kapitalseele. Das Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu verwerten, Mehrwert zu schaffen, mit seinem konstanten Teile, den Produktionsmitteln, die größtmögliche Masse von Mehrarbeit einzusaugen. Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und um so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt. Der Kapitalist kauft die Arbeitskraft als eine Ware und sucht gleich jedem anderen Käufer aus dem Gebrauchswert seiner Ware den größtmöglichen Nutzen herauszuschlagen, aber der Besitzer der Arbeitskraft, der Arbeiter, spricht schließlich auch ein Wort darein, indem er sich etwa folgendermaßen dem Kapitalisten gegenüber vernehmen läßt:
Die Ware, die ich Dir verkauft habe, unterscheidet sich von dem anderen Warenpöbel dadurch, daß ihr Gebrauch Wert schafft und größeren Wert, als sie selbst kostet. Dies war der Grund, warum Du sie kauftest. Was auf Deiner Seite als Verwertung von Kapital erscheint, ist auf meiner Seite überschüssige Verausgabung von Arbeitskraft. Du und ich kennen auf dem Marktplatze nur ein Gesetz, das des Warenaustausches. Und der Konsum der Ware gehört nicht dem Verkäufer, der sie veräußert, sondern dem Käufer, der sie erwirbt. Dir gehört daher der Gebrauch meiner täglichen Arbeitskraft. Aber vermittelst ihres täglichen Verkaufspreises muß ich sie täglich reproduzieren und daher von neuem verkaufen können. Abgesehen von dem natürlichen Verschleiß durch Alter etc. muß ich fähig sein, morgen mit demselben Normalzustande von Kraft, Gesundheit und Frische zu arbeiten wie heute. Du predigst mir beständig das Evangelium der „Sparsamkeit'' und „Enthaltung“. Nun gut! Ich will wie ein vernünftiger, sparsamer Wirt mein einziges Vermögen, die Arbeitskraft, haushalten und mich jeder tollen Verschwendung derselben enthalten. Ich will täglich nur so viel von ihr flüssig machen, in Bewegung, in Arbeit umsetzen, als sich mit ihrer Normaldauer und gesunden Entwicklung verträgt. Durch maßloses Verlängern des Arbeitstages kannst Du in einem Tag ein größeres Quantum meiner Arbeitskraft flüssig machen, als ich in drei Tagen ersetzen kann. Was Du so an Arbeit gewinnst, verliere ich an Arbeitssubstanz. Die Benutzung meiner Arbeitskraft und die Beraubung derselben sind ganz verschiedene Dinge. Wenn die Durchschnittsperiode, die ein Durchschnittsarbeiter bei vernünftigem Arbeitsmaße leben kann, 30 Jahre beträgt, ist der Wert meiner Arbeitskraft, den Du mir einen Tag in den andern zahlst, 1:365X30 oder 1/10950 ihres Gesamtwertes. Konsumierst Du sie aber in 10 Jahren, so zahlst Du mir täglich nur 1/10950 statt 3 mal 1/10950 ihres Gesamtwertes, also nur 1/3 ihres Tageswerts und bestiehlst mich daher täglich um 2/3 des Wertes meiner Ware. Du zahlst mir eintägige Arbeitskraft, wo Du