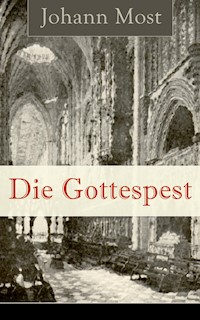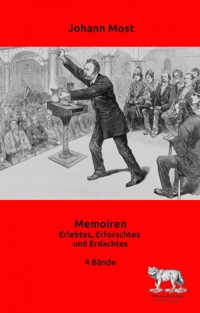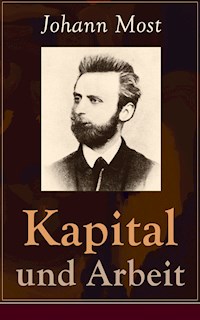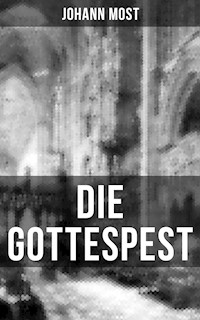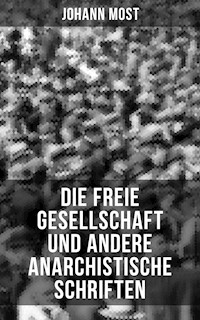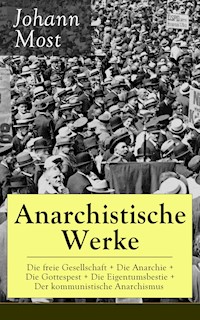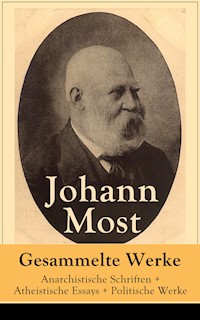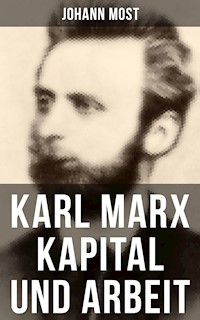
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In 'Karl Marx: Kapital und Arbeit' von Johann Most wird die bedeutende Arbeit von Karl Marx kritisch analysiert. Das Buch beleuchtet die komplexen Themen von Kapitalismus, Arbeit und sozialer Gerechtigkeit und richtet sich an Leser, die ein tiefes Verständnis der politischen Ökonomie suchen. Mit einem klaren und prägnanten Schreibstil erläutert Most die Grundprinzipien des Marxismus und die Auswirkungen von Marx' Ideen auf die moderne Gesellschaft. Mit historischen Verweisen und aktuellen Beispielen bietet das Buch einen umfassenden Überblick über Marx' Werk und dessen Relevanz für die heutige Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Marx: Kapital und Arbeit
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Schon seit dem Entstehen der kapitalistischen Produktionsweise zeigt sich ein Streben, dieselbe wieder zu beseitigen und an deren Stelle eine gerechtere, gemeinnützigere zu errichten. Bald da, bald dort ließen sich diesbezügliche Stimmen vernehmen, allein es waren meist einseitige Klagelieder über die bestehenden Zustände, gepaart mit phantastischen Träumereien über zukünftige Gesellschaftsgebilde, Projekte, welche sich zwar eigneten, dem armen, gequälten Volke Trost und Hoffnung einzuflößen, die aber sonst von gar keiner Bedeutung waren und daher in der Regel bald ins Reich der Vergessenheit wanderten.
Erst in der Neuzeit gewannen die Bestrebungen, welche auf eine Umgestaltung der heutigen Produktionsweise resp. der heutigen Gesellschaft abzielen, festen Grund und praktische Stützpunkte - zum Schrecken aller Volksfeinde. Hier und da treiben zwar noch etliche unklare Köpfe oder bestochene Kreaturen der Reaktion ein frevelhaftes Spiel mit dem Volke, indem sie ihm Utopien vorgaukeln, allein die Erkenntnis bricht sich unter den arbeitenden Klassen zusehends Bahn, so daß die Zeit nicht mehr allzu ferne sein dürfte, wo selbst der schlichteste Proletarier über tragikomische Wahngebilde dieser Art nur noch mitleidig die Achseln zuckt, Eine Zukunft hat eben nur der wissenschaftliche Sozialismus.
Seit dem Erscheinen des „Kapital“ von Karl Marx hat der moderne Sozialismus eine feste Grundlage, eine unbesiegbare Waffe erlangt. Dieses Werk zerstört zwar alle optimistischen Illusionen, weil es darlegt, daß keine Gesellschaft nach individuellen Plänen ausgeklügelt und gemacht werden kann; es beseelt aber andererseits jeden klardenkenden Sozialdemokraten mit der vollsten Siegeszuversicht, weil es beweist, daß der Kapitalismus die Keime des Sozialismus resp. Kommunismus in sich birgt und daß ersterer mit naturgesetzlicher Notwendigkeit und durch seine eigenen Gesetze sich zum letzteren fortentwickeln muß.
„Das Kapital“ hat bereits, obgleich erst der 1. Band erschienen ist, eine große Verbreitung erlangt, allein in die Massen des arbeitenden Volkes ist es noch nicht so recht eingedrungen. Der Preis des Werkes, obgleich derselbe nicht einmal mit dem äußeren Umfange desselben, geschweige denn mit der darin enthaltenen Riesenarbeit im Einklange steht, ist bei der jammervollen Lage, in der die Arbeiter schmachten, einer solchen Verbreitung, wie sie wünschenswert wäre, hinderlich. Außerdem steht dem Verständnis des Buches - ich, der ich selbst Proletarier bin, darf dies schon hervorheben - die Unbildung des Volkes im Wege. Es ist wahr, Marx hat sich Mühe gegeben, so populär zu schreiben, wie es die Wissenschaftlichkeil des Stoffes nur immer zuließ, allein er setzte doch eine Vorbildung voraus, die, dank der systematisch betriebenen Volksverdummung, nicht allgemein vorhanden ist.
Um nun den Arbeitern wenigstens das Wesentlichste dieses hochwichtigen Werkes zum billigen Preis und in leichtfaßlichen Formen gekleidet zugänglich zu machen, habe ich unter anderem meine Zwangsmuße dazu benutzt, das „Kapital“ auszugsweise zu popularisieren.
Vieles habe ich wörtlich oder nur mit geringen Abänderungen - hauptsächlich unter Vermeidung der nicht allgemein gebräuchlichen Fremdwörter - wiedergegeben. Manches jedoch glaubte ich nur summarisch ausführen zu sollen, und einiges, was mir unwesentlich zu sein schien, habe ich ganz übergangen. Ungern nahm ich Abstand, die zahlreichen Daten, welche die Lage der arbeitenden Klassen des näheren charakterisieren, anzuführen, allein der gedrängte Raum, welchen eine Broschüre, die agitatorisch wirken soll, nicht überschreiten darf, verpflichtete mich dazu, übrigens dürfte jeder Arbeiter aus eigener Erfahrung wissen, wie es in dieser Hinsicht steht. Eingeteilt habe ich die Arbeit mehr oder weniger willkürlich, wie es mir der größeren Leichtfaßlichkeit wegen geboten erschien.
Wenn die vorliegende Broschüre manchem die Augen öffnet, habe ich meinen beabsichtigten Zweck erreicht. Ich kann aber schließlich nicht unterlassen, jeden, der die Mittel dazu hat, zur Anschaffung des Marxschen Werkes zu ermuntern, was hiermit geschieht.
Zwickau, im Oktober 1873.
Und nun Gruß und Handschlag den Lesern!
Joh. Most
Ware und Geld
Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform.
Ein Ding, welches sich eignet, menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art zu befriedigen, als Gebrauchsgegenstand zu dienen, ist ein Gebrauchswert. Um Ware zu werden, muß es noch eine andere Eigenschaft besitzen - Tauschwert.
Der Wert der Waren, der sich in ihrem Tauschwert ausdrückt, besteht aus nichts andrem als der Arbeit, die in ihrer Erzeugung verbraucht wird oder in ihnen vergegenständlicht ist. Doch muß man sich genau klarmachen, in welchem Sinne die Arbeit die einzige Quelle des Wertes ist.
In unentwickelten Gesellschaftszuständen verrichtet derselbe Mensch abwechselnd Arbeiten sehr verschiedener Art; bald bestellt er den Acker, bald webt, bald schmiedet, bald zimmert er usw. Aber wie mannigfach seine Beschäftigungen seien, sie sind doch immer nur verschiedene nützliche Weisen, worin er sein eigenes Hirn, seine Nerven, Muskeln, Hände usw. verwendet, worin er mit einem Wort seine eigene Arbeitskraft verausgabt. Seine Arbeit bleibt stets Kraftaufwand - Arbeit schlechthin -, während die nützliche Form dieses Aufwands, die Arbeitsart, je nach der von ihm bezweckten Nutzleistung wechselt.
Mit dem gesellschaftlichen Fortschritt vermindern sich nach und nach die verschiedenen nützlichen Arbeitsarten, welche dieselbe Person der Reihe nach, verrichtet; sie verwandeln sich mehr und mehr in selbständige, nebeneinanderlaufende Berufsgeschäfte verschiedener Personen und Personengruppen. Die kapitalistische Gesellschaft aber, wo der Produzent von vornherein nicht für eigenen, sondern für fremden Bedarf, für den Markt produziert, wo sein Produkt von Haus aus bestimmt ist, die Rolle der Ware zu spielen, ihm selbst daher nur als Tauschmittel zu dienen - die kapitalistische Gesellschaft ist nur möglich, sobald sich die Produktion bereits zu einem vielgliedrigen System selbständig nebeneinander betriebener nützlicher Arbeitsarten entwickelt hat, zu einer weitverzweigten gesellschaftlichen Teilung der Arbeit.
Was aber früher für ein Individuum galt, welches abwechselnd verschiedene Arbeiten verrichtet, gilt jetzt für diese Gesellschaft mit ihrer gegliederten Arbeitsteilung. Der nützliche Charakter jeder besonderen Arbeitsart spiegelt sich wider in dem besonderen Gebrauchswert ihres Produkts, d. h. in der eigentümlichen Formveränderung, wodurch sie einen bestimmten Naturstoff einem bestimmten menschlichen Bedürfnisse dienstbar gemacht hat. Aber der selbständige Betrieb jeder dieser unendlich mannigfachen nützlichen Arbeitsarten ändert nichts daran, daß eine wie die andere Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist, und nur in dieser ihnen gemeinsamen Eigenschaft von menschlichem Kraftaufwand bilden sie den Warenwert. Der Wert der Waren besagt weiter nichts, als daß die Herstellung dieser Dinge Verausgabung menschlicher Arbeitskraft gekostet hat, und zwar der gesellschaftlichen Arbeitskraft, da bei entwickelter Teilung der Arbeit jede individuelle Arbeitskraft nur noch als ein Bestandteil der gesellschaftlichen Arbeitskraft wirkt. Jede Menge individueller Arbeit - im Sinne von Kraftaufwand - zählt daher fortan auch nur als größere oder geringere Menge von gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit, d. h. von Durchschnittsaufwand der gesellschaftlichen Arbeitskraft. Je mehr Durchschnittsarbeit in einer Ware vergegenständlicht ist, desto größer ist deren Wert.
Würde die zur Herstellung einer Ware notwendige Durchschnittsarbeit sich beständig gleichbleiben, so bliebe auch deren Wertgröße unverändert. Dies ist aber nicht der Fall, weil die Produktivkraft der Arbeit durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe der Wissenschaft und ihre technische Anwendbarkeit, die gesellschaftlichen Kombinationen des Produktionsprozesses, den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der Produktionsmittel und durch Naturverhältnisse bestimmt wird, also sehr verschiedenartig sein kann. Je größer die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels erheischte Arbeitszeit, desto kleiner die in ihm kristallisierte Arbeitsmasse, desto kleiner sein Wert. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit, desto größer die zur Herstellung eines Artikels notwendige Arbeitszeit, desto größer sein Wert. Daß hier nur von der jeweiligen gesellschaftlich normalen Produktivkraft und der ihr entsprechenden gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit die Rede ist, versteht sich von selbst. Der Handweber braucht z. B. mehr Arbeit als der Maschinenweber, um eine bestimmte Anzahl Ellen zu liefern. Er erzeugt deshalb keinen höheren Wert, sobald die Maschinenweberei einmal eingebürgert ist. Es wird dann vielmehr die ganze Arbeit, welche bei der Handweberei mehr verbraucht wird, als zur Herstellung einer gleichen Warenmenge durch die Maschinenweberei nötig wäre, nutzloser Kraftaufwand und bildet daher keinen Wert.
Dinge, welche nicht durch Arbeit entstanden sind, wie z. B. Luft, wildwachsendes Holz etc., können wohl Gebrauchswert haben, nicht aber Wert. Andererseits werden Dinge, welche die menschliche Arbeit erzeugt, nicht zu Waren, wenn sie nur zur Befriedigung von Bedürfnissen ihrer unmittelbaren Erzeuger dienen. Um Ware zu werden, muß ein Ding fremde Bedürfnisse befriedigen, also gesellschaftlichen Gebrauchswert haben.
Kehren wir jetzt zum Tauschwert zurück, also zur Form, worin sich der Wert der Waren ausdrückt. Diese Wertform entwickelt sich nach und nach aus und mit dem Produktenaustausch.
Solange die Produktion ausschließlich auf den Selbstbedarf gerichtet ist, kommt Austausch nur selten vor und nur mit Bezug auf den einen oder anderen Gegenstand, wovon die Austauschenden gerade einen Überfluß besitzen. Es werden z. B. Tierfelle gegen Salz ausgetauscht, und zwar zunächst in ganz zufälligem Verhältnisse. Bei öfterer Wiederholung des Handels wird das Austauschverhältnis schon näher bestimmt, so daß sich ein Tierfell nur gegen eine gewisse Menge Salz austauscht. Auf dieser untersten Stufe des Produktenaustausches dient jedem der Austauschenden der Artikel des andern als Äquivalent (Gleichwertiges), d. h. als ein Wertding, das als solches nicht nur mit dem von ihm produzierten Artikel austauschbar ist, sondern auch der Spiegel ist, worin der Wert seines eigenen Artikels zum Vorschein kommt.
Die nächst höhere Stufe des Austausches finden wir noch heute, z. B. bei den Jägerstammen Sibiriens, die sozusagen nur einen für den Austausch bestimmten Artikel liefern, nämlich Tierfelle. Alle fremden Waren, die man ihnen zuführt, Messer, Waffen, Branntwein, Salze etc., dienen ihnen als ebenso viele verschiedene Äquivalente ihres eigenen Artikels. Die Mannigfaltigkeit der Ausdrücke, welche der Wert der Tierfelle so erhielt, machten es zur Gewohnheit, sich ihn vom Gebrauchswert des Produkts getrennt vorzustellen, während andererseits die Notwendigkeit, denselben Wert in einer stets wachsenden Anzahl verschiedener Äquivalente zu berechnen, zur festen Bestimmung seiner Größe führte. Der Tauschwert der Tierfelle besitzt also hier schon eine viel ausgeprägtere Gestalt als bei dem früher nur vereinzelten Produktenaustausch, und diese Dinge selbst besitzen daher nun auch in ungleich höherem Grade schon den Charakter von Ware.
Betrachten wir jetzt den Handel von Seiten der fremden Warenbesitzer. Jeder derselben muß den sibirischen Jägern gegenüber den Wert seines Artikels in Tierfellen ausdrücken. Letztere werden so das allgemeine Äquivalent, welches nicht nur gegen alle die fremden Waren unmittelbar austauschbar ist, sondern auch ihnen allen zum gemeinsamen Wertausdruck, daher auch zum Wertmesser und Wertvergleicher dient. In anderen Worten: Das Tierfell wird innerhalb dieses Gebiets des Produktenaustauschs zu - Geld.