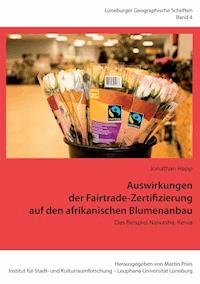
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Lüneburger Geographische Schriften
- Sprache: Deutsch
Wie können wir guten Gewissens Blumen zum Muttertag als Symbol der Zuneigung verschenken, die unter schlimmsten Arbeitsbedingungen von jungen Müttern geerntet wurden? Die immer wieder kritisierten Zustände auf den riesigen Blumenfarmen speziell in Äquatorialafrika verunsichern viele Kunden bei ihrer Kaufentscheidung. Die Arbeitsbedingungen in den Gewächshäusern zeichnen sich durch niedrige Löhne und hohen Pestizideinsatz aus. Einen möglichen Ausweg aus dieser Situation verspricht die Siegel-Organisation „Fairtrade“, die neben agrarischen Produkten von Kleinbauern auch gewissenhafte Blumenproduzenten mit ihrem Siegel zertifiziert. Den Arbeitern soll damit eine langfristige Lebensplanung und den Produzenten eine Schlüsselrolle in der Lösung sozialer Probleme in ihrer Region ermöglicht werden. Doch ist die Hoffnung des europäischen Fairtrade-Konsumenten gerechtfertigt, mit dem Kauf von zertifizierten Blumen ein Produkt zu erwerben, das auch hohen moralischen Ansprüchen gerecht wird? Oder handelt es sich bei dem Zertifikat um eine bloße Marketingmaßnahme? Der Autor stellt die formulierten Ziele des Fairtrade-Handels infrage: Kommen die Mehreinnahmen den Menschen, ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen zugute? Welchen Effekt haben die Fairtrade-Standards auf die lokale Gemeinde? Ein Vergleich von Arbeitsbedingungen und dem Engagement einer Fairtrade-Farm mit denen verschiedener konventioneller Farmen aus der Region Naivasha in Kenia gibt Aufschluss über die Auswirkungen der Zertifizierung am Produktionsstandort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Forschungsstand
1.2 Vorgehensweise der Untersuchung
1.3 Ergebnisse
2 Multidimensionale Armut als Instrument der Entwicklungsmessung
2.1 Der Ansatz des MPI
2.2 Auswahl der Deprivationen
2.3 Vergleich von Einkommensarmut und multidimensionaler Armut
2.4 Abschließende Betrachtung des MPI
3 Geschichte und Entwicklung der Idee des Fairen Handels
3.1 Zwei Ansätze des Fairen Handels
3.2 Aufbau von Fairtrade International und das Fairtrade-Siegel
3.3 Das Fairtrade-Audit
3.4 FLO-CERT GmbH und Konformitätskriterien
4 Die Entwicklung der Blumenindustrie
4.1 Allgemeine Entwicklung der europäischen Blumenindustrie
4.2 Ursprünge der kenianischen Blumenindustrie
4.3 Herausforderungen für die kenianische Blumenproduktion
4.4 Die heutige Bedeutung der kenianischen Blumenindustrie
4.5 Abschließende Betrachtung der Entwicklung der Blumenindustrie
5 Untersuchung der Region Naivasha
5.1 Vorstellung der Region Naivasha
5.2 Bildung
5.3 Gesundheit
5.4 Lebensstandard
6 Fazit
6.1 Auswirkungen der Fairtrade-Zertifizierung auf die Arbeiter und die Gesellschaft
6.2 Entwicklung der Disparitäten
6.3 Schlussfolgerungen
6.4 Beobachtungen und Kritik
6.5 Ausblick
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Quellenverzeichnis
Anhang
Vorwort
Rosen gelten gemeinhin als Zeichen der Liebe. Ihr Absatz steigt als klassisches Geschenk zu den Familienfeiertagen Weihnachten, Muttertag und Valentinstag. Ein Milliardengeschäft, das abhängig ist von viel Handarbeit, sehr spezifischen Anbaubedingungen und hohem Chemikalieneinsatz.
Es verwundert daher nicht, dass sich in den letzten Jahrzehnten ein Großteil der Produktion in die äquatorialen Regionen Afrikas verlagerte. Dort herrschen ideale Anbaubedingungen zu einem sehr niedrigen Lohnniveau. Täglich fliegen Frachtmaschinen aus den ostafrikanischen Hauptstädten nach Nordeuropa und transportieren tonnenweise gekühlte Blumen. Zwei bis drei Tage nach der Ernte stehen die Blumen quasi taufrisch beim Händler, der immer seltener ein Florist und immer öfter ein Discounter ist.
Für die angespannten Volkswirtschaften der Entwicklungsländer ist dieser Exportmarkt ein Segen. Die Blumenproduktion Kenias ist mittlerweile nach Teeanbau und Tourismus der drittwichtigste Devisenbringer. Und dank des hohen Arbeitsaufwands beschäftigt die Branche Zehntausende Arbeitnehmer – im überwiegenden Teil ungelernte junge Frauen, für die der Arbeitsmarkt ansonsten nur sehr wenige Chancen bietet. Die Massenproduktion führt aber auch zu Problemen für Mensch und Umwelt.
Der Faire Handel stellt sich dieser Situation entgegen. Er will mehr sein als Import und Vertrieb von Waren. „Er gibt den Menschen hinter den Produkten ein Gesicht. Ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern, ist das Ziel des Fairen Handels“ (www.fairtrade.de). Diese Neuausrichtung bringt allerdings eine hohe finanzielle Belastung mit sich, die am Ende der Warenkette durch das gute Gewissen des Kunden finanziert wird. Den Konsumenten wird der Eindruck vermittelt, dass mit der Kaufentscheidung für Fairtrade-Produkte der Welthandel und damit die Welt ein wenig gerechter und den Menschen an den Produktionsstandorten geholfen wird.
Doch greifen die Fairtrade-Standards und welchen Effekt besitzen sie auf die lokale Gemeinde?
Der Autor dieses Buches ist ein Skeptiker und sicherlich ein Wissenschaftler, indem er die Versprechen des Fairen Handels infrage stellt. Dieses vielschichtige und durch und durch kulturgeographische Thema findet im vorliegenden 4. Band der Lüneburger Geographischen Schriften eine überzeugende Bearbeitung.
Dank seiner guten Kontakte in Kenia findet Jonathan Happ Antworten auf die gestellten Fragen, indem er dieArbeitsbedingungen und das Engagement einer Fairtrade-Farm mit denen verschiedener konventioneller Farmen aus der Region Naivasha in Kenia vergleicht.
Martin Pries
Lüneburg, Dezember 2015
1 Einleitung
„Die Schnittblumen auf dem deutschen Markt stammen allesamt aus holländischen Treibhäusern.“ So oder ähnlich antworten die meisten Menschen, wenn man sie nach der Herkunft von Schnittblumen, insbesondere von Rosen befragt. Doch die Wahrheit sieht anders aus. In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich die Anbauregion für Schnittblumen nach Süden verlagert. Der Großteil der auf dem europäischen Markt angebotenen Erzeugnisse stammt aus den äquatorialen Regionen Afrikas. Neben dieser Verlagerung hat sich auch der Angebotsort gewandelt. Die meisten Blumen werden heute nicht mehr individuell zusammengestellt beim Floristen erworben, sondern als fertige Standard-Sträuße bei Discountern zu Billigpreisen gekauft. Dieser Wandel geht mit einer Steigerung des Gesamtabsatzes und einer Verbilligung des Einzelproduktes einher.
Es handelt sich um einen Prozess der Globalisierung, der durch folgende Umstände begünstigt wird:
Die Produktion ist in Entwicklungsländern aufgrund weit geringerer Arbeitslöhne günstiger.
Die Anbaubedingungen sind durch das gleichbleibende Tagesklima der Äquatorialzone vorteilhaft, da sie den Blumenproduzenten von den Problemen saisonaler Wetterschwankungen befreien. Die Tagestemperatur ist ausreichend hoch, um in den Treibhäusern ganzjährig ohne eine zusätzliche Beheizung auszukommen.
Das Investitionsklima ist unternehmerfreundlich ausgerichtet: Farmen auf riesigen Anbaugebieten lassen sich oft ohne langwierige Bewilligungsverfahren realisieren, die Rechte der Arbeitnehmer stellen sich nicht als massive Hürde dar, ökologische Gesichtspunkte und Ausgleichsmaßnahmen spielen nur eine untergeordnete Rolle.
Insbesondere der dritte Punkt alarmiert in den Abnehmerländern kritische Verbraucher sowie Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen. Wie können guten Gewissens Blumen zum Muttertag als Symbol der Zuneigung verschenkt werden, die unter schlimmsten Arbeitsbedingungen von jungen Müttern geerntet werden?1
Zu Kritik geben auch die Nebeneffekte Anlass, über die in den Medien berichtet wird. In diesem Kontext ist sowohl von den hoch belasteten Abwässern als auch von der wasserintensiven Produktionsweise zu lesen. Dadurch scheinen Kleinbauern und nomadische Viehzüchter ihrer natürlichen Ressourcen beraubt zu werden.
Einen möglichen Ausweg aus dieser Situation verspricht die Organisation „Fairtrade“, die neben agrarischen Produkten von Kleinbauern auch gewissenhafte Blumenproduzenten mit ihrem Siegel zertifiziert. Der Ansatz von Fairtrade im Segment der Schnittblumen sieht vor, die Produzenten durch Kontrolle und Begleitung unter anderem darin anzuleiten, in ihren Betrieben einen hohen Arbeitsschutz einzuhalten, Fort- und Weiterbildungen anzubieten, langfristig sichere Gehälter zu zahlen und umweltschonend zu wirtschaften. Den Arbeitern soll hierdurch zu einer langfristigen Lebensplanung verholfen werden, die Perspektiven jenseits des klassischen Armutskreislaufs eröffnet, und den Agrarproduzenten soll ermöglicht werden, in ihrer lokalen Umgebung eine soziale Schlüsselrolle zu übernehmen. Diese Neuausrichtung bringt eine hohe finanzielle Belastung mit sich, die durch einen höheren Gewinn kompensiert wird, denn die Fairtrade-Waren werden über den Direktmarkt mit fest vereinbarten Abnahmezahlen sowie höheren und konstanten Preisen gehandelt. Finanziert wird dies durch das gute Gewissen des Kunden am Ende der Warenkette, der sich im Laden für das als Fairtrade gelabelte Produkt entscheidet und dafür einen höheren Kaufpreis bezahlt.
Daraus ergibt sich die Frage, ob die Hoffnung des europäischen Fairtrade-Konsumenten gerechtfertigt ist, mit dem Kauf von Fairtrade-zertifizierten Blumen ein Produkt zu erwerben, das auch hohen moralischen Ansprüchen gerecht werden kann, oder ob es sich bei dem Zertifikat um eine Marketingmaßnahme handelt, ohne dass damit eine Verbesserung der Produktionsbedingungen verbunden ist.
Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich daher mit der folgenden Frage: Welche Auswirkungen hat die Fairtrade-Zertifizierung auf die Arbeitsbedingungen auf einer Blumenfarm und auf die regionale Entwicklung der Kommune? Diese Fragestellung soll anhand der Entwicklung in Naivasha exemplarisch untersucht werden.
1.1 Forschungsstand
Während die Blumenindustrie in Naivasha bisher in der deutschen Wissenschaft kaum Beachtung fand, sind andere Themenbereiche vielfach untersucht worden, deren Darstellung unerlässlich für die vorliegende Arbeit ist. Die folgende Zusammenfassung gibt einen Überblick über den derzeitigen Forschungsstand der einzelnen Teilbereiche der Arbeit.
Die Frage, was eine gesellschaftliche Entwicklung ist und wie sich diese messen lässt, erlebte in den vergangenen 50 Jahren einen weit ausgeprägten Diskurs (u. a. BOHLE & GRANER 1997; BRATZEL & MÜLLER 1979; GIESE 1985; UNDP 2006; UNDP 2010; WORLD BANK 1979). Von besonderer Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist der von ALKIRE und SANTOS vorgestellte Ansatz der „mehrdimensionalen Armut“, da sich die Argumentation methodisch an diesem Konzept orientiert (ALKIRE & SANTOS 2010).
Anhand der Analysen der Weltbank, sowie industrienaher Publikationen und Informationen verschiedener Entwicklungsinitiativen wird die historische Entwicklung der Blumenindustrie in Kenia und des Fairen Handels dargestellt (u. a. FAIR TRADE E. V. 2010a; GEPA 2011a; MOHAN 2009; TRANSFAIR 2009; USITC 2007; WFTO & FLO 2009; WHITAKER & KOLAVALLI 2006).
Über die Regionalgeographie der Region Naivasha geben die offiziellen Erhebungen der kenianischen Behörden, des „Kenya National Bureau of Statistics“ (KNBS 2010a; KNBS 2011) und der „Horticultural Crops Development Authority“ (HCDA 2012), Auskunft. Als weitere Quelle sind die Forschungen des Hydrobiologen David Harper von der University of Leicester zu nennen, der den „Lake Naivasha“ seit 20 Jahren erforscht (HARPER et al. 2011).
Für die Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema im regionalen Kontext findet sich nur wenig akademisch gesichertes Wissen. Zu erwähnen ist die kenianische Master-Arbeit von James Ndwiga Kathuri von der Universität Nairobi „The Feminization of Labour in the Flower Industry in Naivasha, Kenya“ (KATHURI 2003), der Erfahrungsbericht von Bruno LEIPOLD und Francesca MORGANTE von der Universität Warwick „The Impact of the Flower Industry on Kenya‘s Sustainable Development“ (LEIPOLD & MORGANTE 2013) und die Studie „Gender, Rights & Participation in the Kenya Cut Flower Industry“ von DOLAN, OPONDO und SMITH (DOLAN ET AL. 2003). Den genannten Arbeiten ist gemeinsam, dass sie wichtige Aspekte im kenianischen Blumenanbau betrachten, sich dabei aber nur sekundär mit der Relevanz von Fairtrade auseinandersetzen.
Einen stärkeren Bezug besitzen zwei Wirkungsstudien, die von Fairtrade selbst in Auftrag gegeben wurden. Das „Danish Institute for International Studies“ (DIIS) dokumentierte unter dem Projektnamen „FLO impact assessment“ die allgemeinen Folgewirkungen von Fairtrade in der Blumenproduktion in Ostafrika und Lateinamerika. Das „Centrum für Evaluation“ (CEval) der soziologischen Fakultät an der Universität des Saarlandes erarbeitete unter dem Titel „Armutsminderung im Ländlichen Raum durch Fairtrade“ die regionalen Positivwirkungen auf drei Kontinenten in allen landwirtschaftlichen Bereichen, in denen das Siegel aktiv ist. Da die beiden Studien zum Zeitpunkt der Hauptuntersuchung noch nicht abgeschlossen waren, konnten ihre Ergebnisse in dieser Arbeit keine Berücksichtigung finden.
Das Magazin „Ökotest“ ließ in Laboruntersuchungen zwanzig verschiedene Blumensträuße unterschiedlicher Herkunft, die bei Discountern angeboten werden, auf chemische Rückstände untersuchen (STELLPFLUG & GOLL 2011, S. 84–91). Die Ergebnisse dieser Untersuchungsreihen erlauben Rückschlüsse darauf, ob das Versprechen von Fairtrade, auf hochtoxische Chemikalien zu verzichten und grundlegend möglichst wenige Pestizide und Fungizide zu nutzen, eingehalten wird.
Des Weiteren gibt es viele, unterschiedlich stark fundierte, Fernsehbeiträge, Zeitungs- und Magazinartikel, die über die Arbeitsbedingungen und Umweltauswirkungen der Blumenfarmen informieren. Viel Beachtung fand dabei die Produktion „45 Min – Die Rosen-Story“ des Norddeutschen Rundfunks (RICHTER 2011), die zu Teilen in dieser Arbeit aufgegriffen wird.
Einen unabhängigen und wissenschaftlich gesicherten Vergleich zwischen Fairtrade- und konventionellen Blumenfarmen2 gibt es derzeit nicht. Es ist daher notwendig, die Unterschiede der Arbeits- und Lebensbedingungen auf Fairtrade-Farmen im Vergleich zu denen auf regulären Farmen festzustellen und vor Ort zu analysieren.
1.2 Vorgehensweise der Untersuchung
Die Region Naivasha wurde als Untersuchungsort ausgewählt, da sie das Zentrum der kenianischen Blumenproduktion ist. In ihr sind mehr als 50 Farmen mit einer Gesamtzahl von über 35.000 direkt angestellten Menschen beheimatet. Im Zuge dieser Untersuchung wurde Naivasha im Zeitraum von Mai bis August 2011 aufgesucht, wobei anzumerken ist, dass für die Herstellung von Kontakten und die Gewinnung von Informationen oftmals ein hoher Zeitaufwand notwendig war.
Um die Fragestellung beantworten zu können, wurden zunächst reguläre Arbeiter verschiedener Farmen anhand eines Frageleitbogens in circa 45-minütigen Sitzungen befragt3 (vgl. Anhang 2). Diese Erstuntersuchung fand außerhalb der Farmgelände statt, um die Arbeiter nicht zu kompromittieren, und hatte zum Ziel, die spezifischen Lebensbedingungen der Menschen zu erfassen und ein Bild über wesentliche Probleme aufzuzeichnen.
Anhand der Ergebnisse wurden in einem zweiten Schritt mehrere regionale Experten, zwei verschiedene Fairtrade-Farmmanager und mehrere Arbeiter einer Fairtrade-Farm befragt, um eventuelle Unterschiede in den Lebensbedingungen herauszuarbeiten. Diese Interviews dauerten zwischen 45 Minuten und drei Stunden.
Um die Ergebnisse zu evaluieren, wurde zum einen zusammen mit dem Vertreter der Gewerkschaft eine Übersicht mit wichtigen Details über alle örtlichen Blumenfarmen entwickelt (vgl. Anhang 1), zum anderen wurden zwei verschiedene Fragebögen entworfen, die von den Betriebsräten von 10 Farmen und von 17 Schulen ausgefüllt werden sollten.
Leider wurden von den Fragebögen, die an die Betriebsratsvorsitzenden verteilt wurden, nur drei, nicht vollständig ausgefüllte, zurückgegeben, weswegen diese Ergebnisse nicht in die Untersuchung mit einfließen konnten.
1.3 Ergebnisse
Wegen der Komplexität des Themas musste auf die Betrachtung folgender Aspekte verzichtet werden, da von diesen für die Situation der Arbeitnehmer nur eine geringe Relevanz ausgeht:
Der Wasserverbrauch und die genutzten Wasserquellen in Abhängigkeit zu Produktionsmethoden.
Die chemische Kontamination der Umwelt durch Oberflächenwässer oder absickernde Wässer.
Die illegale Landnahme von geschützten und für das Ökosystem wichtigen Wasserrandbereichen.
Die Verdrängung der Massai-Gemeinschaft und deren Verlust traditioneller Korridore zum Tränken ihrer Tiere.
Weitere Konflikte zwischen den verschiedenen lokalen Interessensgruppen, wie zum Beispiel Fischern, Kleinbauern und Tourismusunternehmen.
Der Einfluss der bezahlten Erwerbstätigkeit vieler Frauen auf Familienstrukturen.
1 Die Geschlechterverteilung in der kenianischen Blumenindustrie und die besondere Situation der Frauen wird im Kapitel 5.3.4 betrachtet.
2 Als „konventionelle“ oder „reguläre“ Farmen werden in dieser Arbeit die Unternehmen bezeichnet, die nicht Fairtrade-zertifiziert sind.
3 Die Interviewpartner werden im Kapitel 5 gesondert vorgestellt. Insgesamt wurden für die Untersuchung 17 Interviews in Naivasha und eins in Thika geführt, von denen 14 ausgewertet wurden. Die in dieser Arbeit nicht berücksichtigten Interviews waren entweder inhaltliche Wiederholungen oder beinhalteten Themenbereiche, die in dieser Arbeit nicht betrachtet werden. Die Transkripte und Audio-Dateien liegen dem Herausgeber vor und waren Bestandteil der hier überarbeiteten Abschlussarbeit.
2 Multidimensionale Armut als Instrument der Entwicklungsmessung
Um die Frage nach einer Verbesserung der Lebensbedingungen von Arbeitern beantworten zu können, muss erörtert werden, woran eine solche Verbesserung gemessen werden kann. In der geographischen Diskussion um die Betrachtung und Klassifikation von Gesellschaften seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich gezeigt, dass die bisherigen Ansätze zur Betrachtung von Chancenungleichheit, Entwicklung und Armut methodische Probleme aufweisen. Die eindimensionale Betrachtung von individuellem Einkommen, ob in Form des „Pro-Kopf-Einkommens“ oder gemessen am Anteil der „absoluten Armut“, zeigt sich fehleranfällig (u. a. BOHLE & GRANER 1997, S. 738; BRATZEL & MÜLLER 1979, S. 145; GIESE 1985, S. 174; STORKEBAUM 1984, S. 151; ZIAI 2010, S. 23–29). Und auch der Ansatz des „Human Development Index“ (HDI) konzentriert sich zu stark auf Durchschnittswerte, die insbesondere das Vorankommen der Nationen symbolisieren (u. a. CAPLAN 2009; UNDP 2010, S. 15, 90, 110; ZIAI 2010, S. 25). Während sich die Performance der Länder durch diese Methoden gut abbilden lässt, bringen sie hingegen wenig Licht ins Dunkle der Probleme, wodurch die Aussagekraft der bisherigen Ansätze im Detailbereich lückenhaft bleibt.
2.1 Der Ansatz des MPI
Die „Vereinten Nationen“ (UN) haben zum zwanzigsten Jubiläum des „Human Development Reports“ (HDR) den Begriff der „mehrdimensionalen Armut“ und den „Index für mehrdimensionale Armut“ (MPI) eingeführt, der auf einen Methodenvorschlag von ALKIRE und SANTOS zurückgeht (ALKIRE & SANTOS 2010). Der Ansatz verzichtet bei der Darstellung von Armut, die als ein Grundproblem der Entwicklung erkannt wurde, gänzlich auf die Analyse von Einkommen. Stattdessen greifen die Forscher auf die nach außen hin sichtbaren Formen immaterieller Armut zurück, die sie in den klassischen HDI-Bereichen Bildung, Gesundheit und Lebensqualität lokalisieren und als Deprivationen bezeichnen. Dadurch soll das Armutsphänomen besser erfasst und mögliche Veränderungen präziser abgebildet werden. Im Fokus stehen dabei nicht Einzelpersonen, sondern Haushalte.
2.2 Auswahl der Deprivationen
Tab. 1: Dimensionen und Indikatoren Multidimensionaler Armut
Quelle: Eigene Darstellung, nach LEPENIES 2010, S. 2
„Der einfache und politikrelevante MPI ergänzt monetäre Methoden, indem dabei ein breiterer Ansatz verwendet wird. Er ermittelt überlappende Formen von Deprivationen auf der Haushaltsebene in denselben drei Dimensionen wie der HDI und zeigt die durchschnittliche Zahl armer Menschen sowie die Formen von Deprivation, mit denen arme Haushalte konfrontiert sind.“ (UNDP 2010, S. 117)
Aufgrund des mehrdimensionalen Ansatzes werden nur die Haushalte als entsprechend arm definiert, bei denen parallel mehrere Deprivationen auftreten, deren Summe in der Gewichtung mindestens 30% ergibt. Ein Haushalt, der nur innerhalb eines Indikators Mängel aufweist, gilt nicht als mehrdimensional arm (LEPENIES 2010, S. 1 f.; UNDP 2010, S. 118). Durch diesen Ansatz ist die Methode relativ robust gegenüber einzelnen fehlerhaften Datenquellen und Fehlinterpretationen, denn wenn es auch Haushalte geben mag, die einen einzelnen Mangel aus persönlicher Überzeugung bewusst eingehen könnten4, sind mehrere parallele und gleichzeitig freiwillige Mängel unwahrscheinlich (LEPENIES 2010, S. 1).
Die Auswahl der Deprivationen erfolgte aus zwei Gründen. Der wesentliche Punkt liegt in dem zur Verfügung stehenden Datenbestand. Zwar wünscht sich auch die Forschergruppe hinter dem MPI, Aspekte wie Sicherheit oder Teilhabe einfließen lassen zu können, doch stehen solche Daten nicht in der notwendigen Dichte zur Verfügung (ALKIRE & SANTOS 2010, S. 12 f.).
„We very much wished the MPI to include additional vital dimensions. Unfortunately, we can state categorically that comparable data of sufficient quality are not available from the same survey in the public domain for 100+ less developed countries to consider any other dimensions, nor to include consumption data.“ (ALKIRE & SANTOS2010, S. 12)
Das zweite Auswahlkriterium sind die Millenniumsentwicklungsziele (MDG). ALKIRE und SANTOS hoffen, durch den MPI eine Methode bereitstellen zu können, um das Vorankommen der MDG besser verfolgen und die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen MDGs präziser analysieren zu können (ALKIRE & SANTOS 2010, S. 7–9).
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass zwar einige wichtige Indikatoren im MPI nicht berücksichtigt werden, jedoch über die Bedeutung der zehn relevanten Deprivationen ein internationales Einvernehmen herrscht (UNDP 2010, S. 118). Dadurch wird der MPI zu einem guten Instrument für breite Diskussionen, denn er bildet einen Großteil der Erdbevölkerung anhand einer allgemein akzeptierten Auswahl von Messinstrumenten ab.
2.3 Vergleich von Einkommensarmut und multidimensionaler Armut
Im Ergebnis zeigt sich, dass es eine Nähe zwischen der Einkommensarmut und der multidimensionalen Armut gibt. Vergleicht man die Armutsgrenzen von 1,25 und 2,00 US-Dollar (PPP) und die des MPI, so liegt der MPI zwischen den Werten der beiden anderen (ALKIRE & SANTOS 2010, S. 30). Dies bedeutet aber nicht, dass es sich dabei zwangsläufig um dieselbe Gruppe handelt, denn es kommt teilweise zu sehr großen Ausreißern (vgl. Abb. 1). Dies ist angesichts der sehr unterschiedlich ausgeprägten Sozialleistungen innerhalb der Länder nachvollziehbar, da es Länder gibt, in denen ein Teil der Bevölkerung zwar über ein Einkommen oberhalb der Grenze zur absoluten Armut verfügt, aber in denen gute Schulbildung, sauberes Trinkwasser und sichere Ernährung derart kostenintensiv ist, dass diese Menschen trotzdem keinen Zugang zu diesen erhalten und daher der Gruppe der multidimensional Armen angehören (UNDP, 2010: S. 120):
„[I]n manchen Ländern [werden] die durch den MPI gemessenen Ressourcen kostenlos oder kostengünstig bereitgestellt, während sie in anderen selbst für Erwerbstätige außer Reichweite sind. Entsprechend sehen wir, dass Länder mit relativ gutem Zugang zu Dienstleistungen, beispielsweise Sri Lanka, Tansania und Usbekistan, einen MPI aufweisen, der deutlich niedriger ist als auf Einkommen basierende Schätzungen. Dies ist dagegen nicht der Fall in Ländern wie Äthiopien und Niger, wo die Formen von Deprivation jenseits unzureichender Einkommen noch schlimmer ausfallen.“ (UNDP 2010, S. 120)
Abb. 1: Vergleich zwischen Multidimensionaler und Absoluter Armut
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von OPHI 2010a; OPHI 2010b; UNDP 2015
2.4 Abschließende Betrachtung des MPI
Es ist die große Stärke des MPIs, dass er durch die Analyse von Deprivationen eine Vergleichsbasis für die Lebenssituation innerhalb verschiedener Länder liefert, über deren Bedeutung internationales Einvernehmen herrscht. Auch scheint er gut geeignet zu sein, um größere Gruppen von Menschen oder Regionen zu analysieren. Geht es allerdings um Detailbetrachtungen, scheinen Limitationen unvermeidlich. Dies hat mindestens drei Gründe:
Einige der Deprivationen treten nicht zwangsläufig aufgrund von Armut auf, sondern sind eventuell selbstgewählt oder aufgrund anderer Einflüsse vorhanden.
Es werden insbesondere Haushalte und Familien betrachtet. In vielen Ländern, so auch in Kenia, gibt es aber eine große Gruppe von Wanderarbeitern, die als Einzelindividuen auftreten.
Der MPI bietet durch sein relativ grobmaschiges Raster keine ausreichende Möglichkeit, Detailverbesserungen zu erfassen und darzustellen. Schulbildung und Gesundheit sind vage gehaltene Indikatoren. Arbeitsplatzsicherheit, politische Teilhabe und Gendergerechtigkeit bleiben völlig unberücksichtigt.
Dennoch ist der Ansatz der multidimensionalen Armut für die Fragestellung zielführend, da der Forschungsgegenstand eine benachteiligte Gruppe von Menschen ist, deren Lebenssituation eine Vielzahl von Mängeln aufweist. Um die Auswirkungen der Fairtrade-Zertifizierung auf diese Menschen bewerten zu können, muss primär gefragt werden, welche Mängel aufgrund der Fairtrade-Zertifizierung gegenüber klassischen Anstellungsverhältnissen bei dieser Gruppe nicht mehr auftreten. Sekundär kann untersucht werden, ob es darüber hinaus positive Entwicklungseffekte gibt.
Darüber hinaus ist die Betrachtung von Disparitäten für die Bewertung der gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen von Relevanz. Die Besserstellung einer Einzelgruppe kann zu ausufernden Gesellschaftsspannungen führen. Zahlreiche Konflikte zwischen bestehenden Gruppen, angefacht durch einen unterschiedlich guten Zugang zu Wohnraum, Einkommen, medizinischer Versorgung und schulischer Betreuung, sind dabei denkbar – insbesondere in einem Umfeld, das auch durch den Zuzug von Wanderarbeitern ethnischen Spannungen ausgesetzt ist. Daher könnten gutgemeinte Maßnahmen zu einem kontraproduktiven Effekt führen, wenn durch sie Disparitäten entstehen oder verstärkt werden.
Da es im Fall dieser Arbeit um einen sehr begrenzten Datenbestand geht, kann keine statistische Aussage in Bezug auf den MPI gemacht werden. Hierfür wären umfangreiche Reihenuntersuchungen von Haushalten notwendig, die mit einem erheblichen logistischen, finanziellen und administrativen Aufwand verbunden wären. Ähnliches gilt für eine empirische Untersuchung von Disparitäten. Es können aber anhand von Einzelbefragungen die Fairtrade-Maßnahmen in Bezug auf Deprivationen und Disparitäten herausgearbeitet und bewertet werden. Das Ergebnis einer solchen Methode liefert zwar kein empirisch repräsentatives Ergebnis, kommt aber dennoch zu einer qualitativ belastbaren Aussage. Die Arbeit wird diesem Ansatz in ihrem Fortgang folgen und auf Basis dieser Überlegungen argumentieren.
4 An dieser Stelle kann an Menschen gedacht werden, die aufgrund ihres Schönheitsideals so wenig Nahrung zu sich nehmen, dass sie als unterernährt eingestuft werden, oder an Personen, die aus Überzeugung auf den Besitz von Gütern oder einen Stromanschluss verzichten.
3 Geschichte und Entwicklung der Idee des Fairen Handels
„Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte ProduzentInnen und ArbeiterInnen – insbesondere in den Ländern des Südens – leistet der Faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. Fair Handels-Organisationen engagieren sich – gemeinsam mit VerbraucherInnen – für die Unterstützung der ProduzentInnen, die Bewusstseinsbildung und die Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und der Praxis des konventionellen Welthandels.“ (Gemeinsame Definition des Fairen Handels von FLO, IFAT, EFTA und NEWS! aus dem Jahr 2001, zitiert nach WFTO & FLO 2009)
Die grundsätzliche Idee hinter dem Konzept des Fairen Handels ist, dass sich durch diesen die Lebenssituation der Bauern in den Entwicklungsländern bessert und sich den Menschen daraus eine zukunftsorientierte Perspektive eröffnet. Dieser Anspruch führt zwangsläufig zu der Forderung nach höheren Verkaufspreisen. Das Grundproblem dabei ist, dass die Mechanismen der globalen Marktwirtschaft ihnen diese verwehren. Lokaler Konkurrenzkampf gekoppelt mit der monopolartigen Verhandlungsposition internationaler Großhändler zwingt die Produzenten zu Verkaufspreisen, die nur selten mehr als existenzsichernd sind.
Das Konzept, das hinter der Bewegung des Fairen Handels steht, sieht daher eine Abkehr von der klassischen Marktwirtschaft vor. Der Endverbraucher soll seine Kaufentscheidung nicht nach rein ökonomischen Gesichtspunkten treffen, sondern auch sozialpolitische Aspekte in diese miteinbeziehen und bereit sein, für Produkte einen Preis zu bezahlen, der über dem marktüblichen liegt. Der Mehrwert, den der Kunde dafür erhält, ist ein besseres Gewissen, denn die fairen Handelsorganisationen garantieren ihm, dass der Produzent im Erzeugerland nicht nur einen besseren Lohn erhält, sondern auch Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen getroffen werden (MOHAN 2009, S. 22).
Dieses Versprechen findet viele Freunde. Fairtrade-Produkte gehören heute zum festen Warenbestand vieler Einzelhändler und können eine beachtliche Erfolgsgeschichte aufweisen:





























