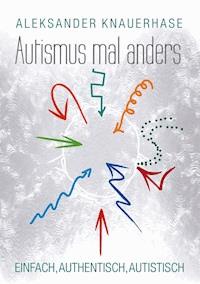
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Stellen Sie sich vor, um Sie herum dudeln 23 Radiosender gleichzeitig; Sie riechen den Duft aus 3 verschiedenen Parfümerien, spüren das Kratzen des Hemdkragens und das Reiben der Ferse an der Schuhkante, während Ihre Augen gleichzeitig diesen Klappentext lesen möchten … Klingt unmöglich – ist aber Alltag für Autisten: Reize werden intensiv und ungefiltert wahrgenommen. Besuche in einer Shopping-Mall, mit der Freundin ins Kino? Nur sehr selten, sagt Aleksander Knauerhase: »Anders als nicht-autistische Menschen, die Störendes wie Gespräche an Nachbartischen automatisch ins Unterbewusstsein verschieben, muss ich als Autist viele der auf mich einströmenden Reize bewusst filtern – und das ist extrem anstrengend.« Wie man trotzdem gedeiht, in einem Umfeld, das so gar nicht für Autisten geschaffen ist, zeigt Aleksander Knauerhase in einfacher, unverschnörkelter Sprache. Mehr noch: Er nimmt die Lesenden mit auf eine faszinierende Entwicklungsreise, vom Zeitpunkt seiner Diagnose 2009 bis heute – mit Rückblenden zur Zeit, wo er einfach nur »anders« war. Und zeigt auf, dass Autisten die Welt der »Neurotypischen« auch bereichern können: Weil sie oft streng logisches Denken lieben und Muster oder Fehler schneller erkennen – was in vielen Situationen und Branchen nützlich sein kann. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für die Innenansicht eines Autisten interessieren – und die lieber mit als über Betroffene reden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Wegleitung
Vorwort
Einleitung
Die zwei Seiten von »auch«
Wahrnehmung
Ein Leben in High-Definition
Atemberaubend und ohrenbetäubend
Please don’t touch
Autismus
Autismus ist: Manchmal leben wie in einem Film
Please don’t touch … my Life! Strategien zum Überleben
Emotionen haben ist nicht schwer …
Das Menschenpuzzle oder Kennen wir uns?
Wenn Druck hilflos macht: Autismus und Aggression
Soziales Rüpeltum
Über das Gefühl, zu schweigen
Wenn man in der Gesellschaft verschwindet
Wenn Masken fallen
Gedanken: Das Sprechen der Kunst
Gedanken: Gebärdensprache – harte Schule, tolle Wirkung
Therapie
Therapie und der Wunsch, die Welt zu verstehen
Wenn Festhalten als ABArtig empfunden wird
Wenn Delfine wiehern, bellen und schnurren
Den Körper spüren lernen
Gedanken: Autismus und wie mich die Forschung darüber spaltet
Gedanken: Weltgesundheit, Definitionen und mein geraubter Schlaf
Gedanken: Die Autismuswaage
Gesellschaft
Autismus ist, wenn man trotzdem lacht
1,2,3,4 Eckstein … Autismus muss versteckt sein
Autismus ist nicht gleich Autismus
Toleranz basiert auf Gegenseitigkeit
Awareness? Pride? Just be?!
Gedanken: Leben in zwei Welten und zwischen zwei Stühlen
Gedanken: Es kann nicht sein was nicht sein darf
Gedanken: Was ist eigentlich die »Norm«?
Gedanken: Ich bin Autist! Na und?
Sprache
Autismus im Teufelskreis der Sprache. Oder: Hört das jemals auf?
Autismus: Diskreditierend und wertvernichtend?
Gedanken: So ein bisschen Autismus …
Gedanken: Es geht auch ohne!
Gedanken: Die Suche nach Erklärungen und was Flotz damit zu tun hat
Inklusion
Mehr Schein als Sein?
Inklusion ist der erste Schritt zur Inklusion
Auf anderen Pfaden
Literarisches Rätselraten
Wenn Klassen reisen
Gedanken: Einmal Autismus bitte! Mild oder schön scharf?
Gedanken: Ein Autist in der Regelschule: weggesperrt und ausgegrenzt
Specials
Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum (2011)
Welt-Autismustag 2011: Es gibt nichts, was Autisten nicht können!
Welt-Autismustag 2013: Es gibt noch viel zu tun!
Gedanken zum Schluss
Autismus ist
Wegleitung
Die Diagnose »Autismus« wird in der heutigen Zeit vielfach als Schlagwort und Ausdruck negativer Verhaltensweisen benützt. Da werden die einen als »sexuelle Autisten« oder als »politisch autistisch« bezeichnet, um auszudrücken, dass sie sich egoistisch verhalten. »Autistische« Architektur soll vielleicht ausdrücken, dass ein Bau (zu) schlicht ist? Ich weiß es nicht.
Autismus hat schon vor längerer Zeit den Titel »Modediagnose« erhalten, denn schließlich darf sich jeder Autist nennen, der gerne Ordnung hat und seine Ruhe haben will. Aber so einfach ist es dann doch nicht.
Aleksander Knauerhase hat es sich trotz aller Widerstände zur Aufgabe gesetzt, ein Buch über Autismus zu schreiben, das vor allem informieren soll. »Information ist toll!«, werden Sie vielleicht sagen, lieber Leser. Schließlich haben Sie deshalb dieses Buch gekauft. Doch ich muss Sie vorwarnen: Wenn Sie denken, dass Sie mit diesem Buch eine weitere Ausgabe eines Fachaufsatzes besitzen werden, sind Sie auf dem Holzweg. Knauerhase schreibt nicht aus der bequemen Hochsitzlage eines ausgebildeten Sozialpädagogen. Aleksander Knauerhase ist Autist.
Seit einigen Jahren verfolge ich Knauerhases Texte im Blog »Quergedachtes«. Dank seiner Fähigkeit zu beschreiben und zu analysieren, bekommt jeder Leser einen wirklichen Einblick in sein Leben und kann sich selber eine Meinung bilden: Was bedeutet es, als Autist in der heutigen Gesellschaft zu leben?
2013 durfte ich mit ihm in der Stiftung Friedheim Weinfelden an einem Mitarbeiter-Weiterbildungstag über das Thema »Autismus« sprechen. Er schaffte es mit wenigen Worten, den Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen nahezubringen, wie sich autistisch sein anfühlt und welch vielfältigen Anforderungen Autisten, gerade in Institutionen, gerecht werden müssen.
Ich wünsche mir, dass dieses Ihnen vorliegende Buch Ihr Herz berühren wird. Vor allem aber wünsche ich mir, dass Sie nach der Lektüre dieses Buch ihre autistischen Mitmenschen mit anderen Augen sehen werden.
Zora Debrunner, im März 2016
Vorwort
Liebe Leser und Leserinnen,
»Autismus mal anders. Geht das denn? Kann man Autismus einmal anders beschreiben und betrachten?« Das waren die ersten Gedanken, die ich vor vielen Jahren hatte – lange, bevor ich an ein eigenes Buchprojekt dachte. Denn was mir bis dato begegnet war, waren hoch-wissenschaftliche und kompliziert beschriebene Blickwinkel auf Autismus als Pathologie, als Problem. Oder, im anderen Extrem der Autismusliteratur, biographische Erzählungen dessen, wie Familien, Angehörige oder Autisten selbst den Autismus erleben. Was mir fehlte waren einfach verständliche Beschreibungen über das, was Autismus ist. Mit meiner Diagnose war ich in einem Findungsprozess – ein Prozess, in dem ich mir sachlich erklären wollte, was Autismus für mich bedeutet und wie er mein Leben prägt. So entstand mein Blog »Quergedachtes«. Auch dank vieler Fragen und Anregungen von Außen schrieb ich mehr und mehr das nieder, was mich bei dem Thema beschäftigte. Und, ich konnte es nicht glauben, irgendwann waren es so viele Texte, dass ich mir dachte: Das wird ein Buch. Und dieses Buch halten Sie nun in den Händen.
Zu Beginn werden wir die autistische Wahrnehmung und deren Grundlagen kennenlernen. Es folgt der umfangreiche Bereich Autismus, der diesen in möglichst einfachen Worten beschreiben und erläutern möchte. Dann besprechen wir die Themen Therapie, Gesellschaft, Sprache und Inklusion.
Übers ganze Buch verteilt finden Sie immer wieder Gedanken: Texte, die nicht direkt Autismus beschreiben sondern Denkanstöße mitgeben wollen. Denken Sie mit mir zusammen darüber nach, was Autismus in den verschiedenen Lebensbereichen bedeuten und was man vielleicht ändern kann – im eigenen Leben oder als Gesellschaft. Im Anhang finden sich die Specials – Artikel, die zu besonderen Anlässen publiziert worden sind und die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Zum Schluss wartet auf Sie eine Überraschung in 500 Wörtern.
Kommen Sie mit mir auf eine Reise, lassen Sie sich führen und nehmen sie den einen oder anderen Denkanstoß mit. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß, aber auch viele AHA!s und OHO!s.
Aleksander Knauerhase, im Februar 2016
Einleitung
Die zwei Seiten von »auch«
Seitdem ich offen über Autismus – und dass ich selbst Autist bin – spreche, bekomme ich immer wieder eine bestimmte Reaktion zu hören: »Das kenne ich auch!« oder »Das geht nichtautistischen Menschen aber auch so!«. Nun hat es mit so einem Auch-Satz mehr auf sich, als man auf den ersten Blick denken möchte. Genauer gesagt: der Auch-Satz hat zwei Seiten.
Ein »Auch« ist der erste Schritt zur Inklusion
Schon kurz nachdem ich anfing, meinen Autismus zu verarbeiten und darüber zu schreiben, hatte ich ein Ziel: Die Menschen sollten erkennen, dass Autisten weder Monster noch eine Gefahr für die Gesellschaft sind. Wir sind, wenn man genauer hinschaut, eigentlich ganz normal. Mit der Ausnahme, dass wir Sinnesreize wegen unserem mangelnden Filter sehr intensiv wahrnehmen. Und so sind unsere Reaktionen – mögen sie auf Menschen, die sich mit Autismus nicht auskennen, noch so exotisch wirken – eigentlich ganze »normale« menschliche Reaktionen auf Reizüberflutungen. Reaktionen also, die wohl jeder Mensch zeigen würde, wenn er Sinnesreizen so massiv ausgesetzt wäre.
Mich hat die Aussage »auch« immer gefreut, zeigt sie doch, dass man beim Thema Autismus keine Berührungsängste haben muss: Jeder Mensch, der die Gemeinsamkeiten versteht, trägt dazu bei, dass Autisten ein Stückchen mehr in die Gesellschaft rücken. Ist es nicht das, was wir alle wollen?
Wenn da nur nicht dieses dazugehörige »ja, aber …« wäre.
Drei Beispiele, oder: Das kenne ich auch, aber …
Schaut man genauer hin, scheitert diese gewünschte »auch« an einem entscheidenden Punkt: Dem echten Verständnis. Ich meine damit nicht das mitleidige Bedauern, sondern den Prozess des reflektierten Verstehens – warum sind Autisten so, wie sie sind?
Viele Menschen, die meine Texte lesen, schalten nach der Erkenntnis »Das kenne ich doch auch!« leider erst einmal ab. Das ist auch nicht weiters schlimm; man muss den Gedanken nur irgendwann fortsetzen und darüber nachdenken. Natürlich kennen viele die von mir beschriebenen Probleme aus eigener Erfahrung. Die Reaktionen auf solche Probleme sind nur allzu menschlich. Was aber gerne vergessen geht, ist die Ausprägung und Intensität dessen, was Autisten in den beschriebenen Momenten erleben. Ich versuche das in ein Beispiel zu fassen:
Sie gehen, als nichtautistischer Mensch, auf ein Open-Air-Konzert. Natürlich ist die Musik laut, viele Menschen sind vor Ort, und selbstverständlich kommt eventuell auch irgendwann ein Punkt, an dem sie sich nicht mehr so ganz 100 %ig wohl fühlen. Sie erkennen also das Gefühl aus der Situation heraus.
Ein Autist (und ich spreche da nicht für alle, denn jeder empfindet das anders), kann die gleichen Gefühle aber schon bei viel weniger Menschen, bei weniger lauter Musik und z.B. an einem alltäglichen Ort wie der Fußgängerzone erleben. Würden Sie in einer solchen Situation das oben angesprochene Unwohlsein empfinden? Wahrscheinlich nicht. In Extremsituationen mag das Gefühl bei den meisten ähnlich sein – aber bei manchen Menschen tritt es sehr viel früher, schneller und heftiger auf, als oft nachvollziehbar ist.
Ich möchte ein weiteres Beispiel bringen, um die Falle des »das kenne ich auch!« deutlich zu machen:
Ein Autist sitzt in einer Vorlesung. Er konzentriert sich auf die Dozentin und versucht nach Möglichkeit, alles Wichtige mitzubekommen. Neben der eigentlichen Vorlesung nimmt er aber noch viele weitere Dinge wahr: Die Hitze im Raum, die tuschelnden Kommilitonen, das tippen der Nachbarn auf ihren Laptops, den einen Studenten, der ständig auf seinem Kugelschreiber rumdrückt; die Textnachrichten, die geräuschvoll ankommen und mit eingeschalteten Tastentönen beantwortet werden. Den muffigen Geruch im Raum, das Ticken der Uhr an der Wand und und und.
Ein nichtautistischer Student folgt der Vorlesung, er hört mit halbem Ohr, dass neben ihm geredet wird. Vielleicht stört ihn das in seiner Konzentration. Oftmals war es das aber auch schon: Er blendet, dank seines funktionierenden Reizfilters, alle störenden Reize vor deren Bewusstwerden als »unwichtig« aus. Ganz automatisch.
Die Intensität der Reize, die einen Autisten überlasten können, ist eine ganz andere. Wieder so eine Auch-Situation: Jeder kennt Kommilitonen oder Mitschüler, die genau dann quasseln, wenn man aufpassen müsste. Bei einem Autisten geht das Ganze viel weiter und hat stärkere Reaktionen zur folge. Spinnt man das Beispiel weiter, kann es durchaus so ausgehen:
Durch die ständige, andauernde, nicht vermeidbare Reizbelastung bahnt sich ein »Overload« an. Je nach Charakter des Betroffenen kann es dazu kommen, dass er sich, weil er der Vorlesung folgen möchte, zur Wehr setzt: der klassische Wutausbruch durch Überlastung. Aus Sicht des Autisten eine normale und sehr verständliche Reaktion, aus Sicht aller anderen nicht. Der Wutausbruch kommt für die Nichtautisten wie aus heiterem Himmel, da sie die massive Reizbelastung nicht bewusst wahrgenommen haben. Das Ergebnis sind Reaktionen der Form »Wie kann er nur so reagieren? Da haben sich doch bloß zwei Kommilitonen unterhalten!«.
Mit einem dritten Beispiel möchte ich die Nachwirkungen solcher Situationen illustrieren.
Wenn man wie im Open-Air-Beispiel davon ausgeht, dass ein Autist, der Probleme mit Menschenmengen hat, schon in einer normal-bevölkerten Fußgängerzone Probleme bekommt, dann versteht man sicher, dass er Situationen mit noch mehr Menschen meiden wird. Denn diese Situationen wären weitaus stressiger. Aber gehen wir davon aus, dass der Autist das Open-Air-Konzert trotzdem besucht. Er bräuchte ob der Masse an Reizen, die auf ihn einprasseln, sehr viel länger, um sich im Anschluss von der Reizüberflutung zu erholen – selbst wenn er den Anlass genossen hat. Was nichtautistische Menschen vielleicht einen oder zwei Tage umhaut kann für einen Autisten so belastend sein, dass er für Wochen aus dem Takt ist und sich unwohl fühlt. Er ist um ein Wesentliches erschöpfter als ein Nichtautist.
Das Vorlesungs-Beispiel ist für einen nichtautistischen Menschen ärgerlich, und nach einer harten Studienwoche ist sicher jeder über ein freies Wochenende froh. Ich selbst konnte als Autist nur Vorlesungen an jeweils zwei Wochentagen besuchen. Und an diesen Tagen hatte ich, je nach Lehrplan, nie mehr als zwei oder höchstens drei Vorlesungen. Die restlichen Wochentage benötigte ich, um mich vom Studium zu erholen, so anstrengend war die Reizbelastung im universitären Umfeld.
Bei allen drei Beispielen würden Sie wohl sagen: Das kenne ich auch! Zu recht – aber vergessen Sie dabei bitte nicht, dass Autisten sowohl in der Intensität der Reize wie auch in Bezug auf ihre Reizschwelle anders reagieren, als Sie es als Nichtautist tun. Das, was Autisten jeweils erleben, kann viel tiefergreifende Folgen haben. Die Erschöpfung ist wesentlich größer, die Regenerationszeit erheblich länger.
Wenn Sie also meine Erklärungen über Autismus lesen, behalten Sie bitte eines im Kopf:
Es ist normal und menschlich, dass Sie vieles aus dem eigenen Leben kennen oder sich gar ansatzweise wieder-erkennen. Aber bei Autisten haben die beschriebenen Situationen einen anderen »Wirkungsgrad« und sind deshalb wesentlich belastender. Sie beeinträchtigen das Leben viel stärker, als Sie vielleicht spontan nachvollziehen können.
Wenn Sie das im Hinterkopf behalten, wird aus der kopflosen Floskel »Das kenne ich auch!« ein wirklich guter Satz. Eine Aussage, die dazu beiträgt, dass Autisten und die Gesellschaft ein Stückchen mehr zusammenwachsen.
Wahrnehmung
Ein Leben in High-Definition
Auch wenn sich Autismus bei jedem anders äußert, eines haben alle Autisten gemeinsam: Eine, im Vergleich zu Nichtautisten, veränderte Wahrnehmung der Umwelt. Jeder, der nicht schon als Kind als Autist diagnostiziert wurde, kann mir sicher beipflichten: Man kennt nur seine Art der Wahrnehmung! Es ist förmlich unvorstellbar, dass andere Menschen die gleiche Umgebung »anders« wahrnehmen als man selbst.
In diesem Kapitel möchte ich meine Wahrnehmung als Autist beschreiben. Auch wenn es wahrscheinlich unmöglich ist, diese Wahrnehmung für nichtautistische Menschen 100%ig verständlich zu machen, möchte ich wenigstens versuchen, diese Wahrnehmung zu erklären. Ich bin der festen Überzeugung, dass im Verständnis dieser anderen Wahrnehmung einer der Schlüssel zur Welt der Autisten liegt.
Was passiert in der menschlichen Wahrnehmung? Eine interessante Frage, die ich neurologisch-wissenschaftlich weder exakt beantworten kann noch möchte. Aber ich versuche, die die Grundzüge kurz zu umreißen.
Was nimmt man wahr? Es sind Reize, die auf unsere Sinne treffen und zum Gehirn weitergeleitet werden. Betrachtet man die Summe an Reizen, die ständig auf uns einprasseln, so wird man von deren Masse förmlich erschlagen. Damit unser Gehirn nicht vor Reizen überläuft – und damit überlastet wird – findet zwischen Reizaufnahme und Reizverarbeitung eine Filterung statt. Wir müssen also nicht alle Reize bewusst verarbeiten, wir sortieren vorab unbewusst sehr viel aus. Ein Mechanismus der Evolution, um unser Gehirn zu schützen und das Überleben der Menschheit zu garantieren. Es wäre auch reichlich dumm, wenn wir einem Vogelgezwitscher zuhörten und dabei übersehen, dass wir gerade im Treibsand versinken. Und das nur, weil wir Reize nicht unterscheiden, verarbeiten und priorisieren können.
Letztendlich haben autistische Menschen aber genau dieses Problem. Der Filtermechanismus, der dafür sorgt, dass unbewusst unwichtige Reize ausgefiltert werden, funktioniert nicht richtig bzw. gar nicht. Dies führt dazu, dass wesentlich mehr bewusste Umweltreize auf einen Menschen mit Autismus einprasseln als auf einen nichtautistischen. Diese Flut an Reizen muss nun verarbeitet werden, das Gehirn wird außerordentlich belastet. Wenn man bedenkt, dass die Wahrnehmung ohne Unterbruch arbeitet und kein kurzzeitiger Vorgang ist, wird einem klar, dass Autisten ständig unter Strom stehen. Dies führt dann zu dem Phänomen, das unter Autisten als »Overload« bekannt ist: Der betroffene Autist ist extrem überlastet.
Wie sich ein Overload bei einem Autisten äußert ist recht unterschiedlich. Manche versuchen dagegen anzugehen und die Ursache, die Reizüberflutung, abzustellen bzw. dieser aus dem Weg zu gehen. Wenn also ein Autist, für Außenstehende oftmals ohne Grund, darum bittet, gehen zu dürfen oder einen Raum bzw. eine Situation zu verlassen: Bitte denken Sie an diesen Text zurück!
Andere wiederum kämpfen lange mit sich, versuchen, sich »zusammen zu reißen«, den Stress zu kompensieren. Sie wissen, dass die Umwelt um sie herum die Reizüberflutung nicht nachvollziehen kann und versuchen deshalb so gut wie möglich, mit der Situation fertig zu werden. Gute Miene zum bösen Spiel. Ich kann hier nur für mich mit Sicherheit sprechen, aber bemerkbar wird es dann, wenn ein gewisser Rückzug erfolgt, der Mensch stiller wird und letztendlich sehr gestresst und angespannt wirkt. Bei vielen zeigt sich diese Kompensierung der Situation zum Beispiel durch rhythmische bzw. wiederkehrende Bewegungen oder Handlungen, die auf den Autisten beruhigend wirken. Am bekanntesten ist wohl das Schaukeln des Oberkörpers. Bewegungen wie das Schaukeln sind im Umkehrschluss aber kein sicheres Anzeichen für einen Overload – sie können bei Autisten auch unbewusst stattfinden.
Ist kein Ausweichen möglich, kommt es letztendlich zu einer unvermittelten Explosion. Die Anspannung, welche im Falle eines Overloads extrem ist, muss raus. Außenstehende deuten solche Äußerungen dann oft als Wutausbrüche. Es handelt sich dabei aber weniger um aggressives Verhalten gegen die Umwelt, sondern vielmehr um gelöste, innere Anspannung. Und natürlich auch um einen Versuch, der Situation zu entkommen bzw. die Reize abzustellen.
Ich kann hier nur um Verständnis für Menschen mit Autismus bitten. Wir sind nicht aggressiver als andere Menschen. Es gibt immer einen Grund für den Wutausbruch eines Autisten, auch wenn dieser schwer zu greifen sein sollte. Es ist nicht verboten, in einem angemessenen zeitlichen Abstand, danach zu fragen. Als Autist sage ich sogar: Fragen hilft! Es hilft, die Situation zu verstehen, zu begreifen was der Auslöser war – und vielleicht in Zukunft einen sich anbahnenden Overload frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
Die Folgen eines Overloads sind nicht unerheblich. Zum einen hat ein Overload mehr oder weniger Folgen für das Umfeld des Autisten. Nicht jeder hat Verständnis dafür oder kommt damit auch nur ansatzweise klar. Aber auch die direkten Folgen für einen Menschen mit Autismus können gravierend sein. Overloads erschöpfen ungemein – Energie, die in den kommenden Tagen fehlt, sei es, um ein annähernd normales und integriertes Leben zu führen, oder einfach nur, um überhaupt einen klaren Gedanken fassen zu können. Dass einem der Schädel gehörig brummt ist dann fast nebensächlich.
Schlimmer wird es, wenn ein Autist körperlich aggressiv wird. Hier kann es zu Selbstverletzungen kommen. Nicht bei jedem Autisten prägt sich der Overload so aus, aber doch bei einigen. Man sollte als Außenstehender dabei immer bedenken: Es ist in dem Moment der einzige Ausweg für den Autisten, die einzige Möglichkeit, seiner extremen Situation zu entkommen. Er ist weder latent aggressiv noch möchte er jemandem schaden. Ich werde immer wieder wütend und traurig, wenn ich in Medien und Sachbüchern lesen muss: Autisten sind eine Gefahr für ihre Umwelt!
Wer nun glaubt: »Schlimmer wird’s nicht werden«, den muss ich leider enttäuschen. Einige Autisten berichten von sogenannten »Meltdowns«, einer Kernschmelze. Am besten kann man den Meltdown mit einer Notabschaltung des Gehirns beschreiben – eine letzte Schutzmaßnahme, bevor der Verstand endgültig ausbrennt. Ein Meltdown ist ein Zustand, während dem wohl jeder Autist wirklich jedem in der öffentlichen Wahrnehmung verbreiteten Klischee entspricht.
Wie beschreibt man also am knappsten und besten die autistische Wahrnehmung im Vergleich zur nichtautistischen? Ich versuche es mit einer Illustration, die wohl vielen geläufig sein dürfte:
Wenn die normale Wahrnehmung der guten alten PAL-Fernsehauflösung entspricht, dann gleicht die autistische mindestens einer modernen Full-HD Fernsehauflösung. Wir Autisten nehmen Details und Informationen bzw. Reize wahr, die in einer nichtautistischen Wahrnehmung schon vorab unbewusst ausgefiltert werden. Unsere Welt ist also extrem hochauflösend, und deshalb manchmal auch extrem anstrengend. Aber mal direkt gefragt: Es macht doch auch keinen Spaß, die Umwelt in PAL zu sehen, wenn sie schon in HD ausgestrahlt wird, oder?
In diesem Sinne: Mit Autismus sieht man besser. Und das sogar gebührenfrei!
Atemberaubend und ohrenbetäubend
Eng mit der persönlichen Wahrnehmung hängen auch die Sinne des Menschen zusammen. Und so wie die Wahrnehmung von Menschen mit Autismus eine ganz besondere ist, sind deren Sinne oftmals anders ausgestattet als bei Nichtautisten. Das betrifft manchmal nur wenige Sinne, manchmal alle, teilweise auch gar keinen. Autismus ist, gerade hier, etwas besonders Individuelles. Wer autistische Menschen verstehen möchte, findet in der Art, wie sie Sinnesreize wahrnehmen, einen weiteren Schlüssel. Wundern Sie sich nicht, wenn ein Autist Dinge wahrnimmt, die Ihre eigenen Sinne nicht erfassen.
Das Sehen
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass man aufgrund der mangelnden Filterung nicht nur mehr Details wahrnimmt. Man bemerkt auch Besonderheiten, die nichtautistische Menschen ausblenden. Ein Beispiel dafür sind Leuchtstoffröhren oder auf der gleichen Technik basierende Energiesparlampen: Mit der Zeit können diese anfangen zu flimmern und zu flackern. Autisten nehmen das oft bereits sehr früh wahr. Das führt unter anderem dazu, dass man in einem Konferenzraum sitzend dem Vortrag nicht mehr richtig folgen kann, da das ständige hochfrequente Flimmern extrem ablenkt und stört. Schließt man daraufhin die Augen, um sich auf die Konferenz zu konzentrieren, dauert es oftmals nicht lange, bis ein aufmerksamer »Mithörer« einem einen Finger in die Rippen stupst, um den Autisten aus dem vermeintlichen Büroschlaf zu wecken.
Ganz alltägliche Situationen, die wohl auch Nichtautisten stören, können sich bei Autisten gravierend auswirken. Schnelle Lichtimpulse, zum Beispiel in einer Disko oder bei anderen Veranstaltungen, können einen Overload erheblich beschleunigen – denn ein Autist kann diese nicht ausblenden. Derartige Lichtgewitter können eine erhebliche Belastung darstellen. Manchmal reicht bereits das Scheinwerferlicht eines entgegenfahrenden Autos, einen Autisten aus der Bahn zu werfen.
Es hat aber auch seine positiven Seiten: Wetten Sie niemals mit einem Autisten, wenn es um Fehler in Film oder Fernsehen geht. Die Chance, dass er etwas bemerkt hat, was Ihnen entgangen ist, ist extrem hoch.
Das Hören
Wussten Sie, dass Leuchtstoffröhren nicht nur flimmern sondern auch zirpen können? Die meisten Menschen müssen das nicht lange ertragen, da viele das Geräusch erst dann hören, wenn die Röhre schon kurz vor ihrem Lebensende steht – und dann, weil es stört, schnellstens ausgetauscht wird. Erklären Sie nun jemanden, der dieses Geräusch noch nicht wahrnimmt, dass Sie selbst am Rande des Wahnsinns stehen, da Sie einen ständigen, in der Frequenz leicht wechselnden und sehr hochfrequenten Pfeifton im Ohr haben. Da wird einem schnell mal ein Tinnitus angedichtet! Wenn Autisten also einen Raum betreten und zusammenzucken oder irritiert dreinschauen: Es könnte die Beleuchtung sein.
Generell ist es sehr belastend, wenn man Dinge hört, die andere entweder überhören, ausblenden oder einfach nicht wahrnehmen. Wer schon einmal mehrere Minuten oder gar Stunden nach der Ursache für ein nerviges Geräusch gesucht hat, weiß, was gemeint ist: Nicht zu wissen, was einen da stört, ob und wie man es abstellen kann, und ob schon wieder etwas im Haus defekt ist, kann einen mächtig belasten – ganz abseits des Sinnesreizes. Bedenkt man, dass jede Wohnung bzw. jedes Haus ganz individuelle Eigengeräusche hat, kann man sich vorstellen, warum Umzüge oder längere Ortswechsel für Menschen mit Autismus oft schlaflose Nächte bedeuten.
Die Empfindung von Geräuschen bzw. eine komplexe Geräuschkulisse kann aber auch ganz allgemein belastend sein. Besonders dann, wenn man sich eigentlich konzentrieren müsste. Ein gutes Beispiel dafür sind Wartezimmer. Wer kennt sie nicht, die typischen Wartezimmertypen? Da gibt es die Smartphonefummler, die nichts anderes machen, als ständig mit der neusten Errungenschaft der Technik zu spielen und die Umgebung mit Spielesounds oder Wischgeräuschen zu unterhalten. Immer wieder beliebt sind auch die SMS-Vibrierer, die dank Flatrate eine Flut von Kurznachrichten erhalten. Wer dann seine Tastentöne nicht ausgeschaltet hat, wird für Autisten schnell zum Geräuschgewehr. Der »Guten Morgen!«-Brüller ist eigentlich eine nette Spezies von Mensch. Für Autisten jedoch problematisch: bis sie sich sortiert haben und reagieren können, haben alle anderen schon längst geantwortet. Also lässt man es lieber. Und wo die »Guten Morgen!«-Brüller sind, ist die Plaudertasche auch nicht weit. Man glaubt gar nicht welche Informationen man in einem Wartezimmer so mitbekommt, ohne das eigentlich zu wollen. Wirklich schlimm sind aber die »Zeitschriften-Durchwühler«, die sich nervös eine Zeitschrift nach der anderen greifen und hektisch (und äußerst geräuschvoll) durchblättern. Wenn man bis dato nicht wusste, wie viele Seiten eine aktuelle Ausgabe der Zeitschrift »Wie mache ich Autisten wahnsinnig?« hat: spätestens nach der Begegnung mit dieser Spezies von Wartezimmertyp weiß man es!
OK – viele Menschen haben ein Problem mit Wartezimmern und den Menschen darin. Weshalb ist die Situation für Autisten oft besonders anstrengend? Sie warten darauf, aufgerufen zu werden. In der Masse der Geräusche, die auf sie einprasseln, geht der Aufruf unter. Zumindest ist das zu befürchten. Wo Menschen normalerweise abschalten und versuchen, Ruhe zu finden, läuft die autistische Wahrnehmung auf Hochtouren. Ganz ehrlich: Wenig ist peinlicher, als wenn man aufgerufen wird und nicht reagiert. Vor allem, weil die Mitwartenden dazu neigen, sich suchend umzuschauen, welcher Patient wieder mal »den Termin versemmelt hat«. So wird jeder Aufenthalt in einem Wartezimmer zu einer Geräuschsafari mit anschließendem Überraschungseffekt.
Auch einkaufen gehen gleicht oftmals einem Ausflug in einen Abenteuerpark. Achten Sie einmal darauf, wie oft »5 die 23« anrufen soll, wie viele (Tief-)Kühltruhen pfeifen, rappeln oder brummen, und wie sehr das Piepen der Scannerkassen nerven kann, wenn die Schlange besonders lang ist. Zum vollkommenen Glück des Autisten fehlt dann nur noch der Diebstahlalarm, der an der Kasse nebenan losgeht, und natürlich durch mehrfaches durchschieben des Einkaufswagens immer wieder neu ausgelöst werden muss. Ein guter Tag ist ein Tag, an dem schon eines dieser Geräusche beim Einkaufen fehlt. Halten Sie bei Ihrem nächsten Einkauf einfach mal die Ohren offen: Sie werden sich wundern, wie ohrenbetäubend so ein Supermarkt sein kann!
Das Schmecken
Wussten Sie, dass »Feinschmecker« und »Fein-Schmecker« zwei unterschiedliche Dinge sind? Die einen legen Wert auf gutes Essen und erlesene Zutaten. Manchmal reicht aber auch nur die Erwähnung von vermeintlich erlesenen Zutaten, um den Homo Sapiens Feinschmecker zufrieden zu stellen. Einige Autisten zählen zu jenen Menschen, die sehr fein schmecken können. Da schmeckt man schon mal heraus, wenn die von Weihnachten übrig gebliebenen Kokosmakronen neben einem Stück Apfel gelagert wurden, um wieder weich zu werden. Wenn man Kokosmakronen mag, ist das noch ganz angenehm. Aber wie sieht es mit der Handcreme oder der Desinfektionsflüssigkeit von Fleisch- oder Käsefachverkäuferinnen und -verkäufern aus? Aufschnitt mit Handcrèmegeschmack ist nicht wirklich lecker. Wer schon mal einen leckeren Weichkäse mit einem Hauch Parfümaroma im Mund hatte versteht, wovon ich schreibe. Ich weiß nicht, was so manche Bäckerei mit ihren Brötchentüten anstellt, aber Frühstücksbrötchen die einen Hauch von »was auch immer« haben, sind zum Abnehmen ideal!
Wirklich lustig wird es in Restaurants. Schon einmal ein Getränk mit Spülinote gehabt? TOP! Da sind die Diskussionen mit der Bedienung, ob eine Cola nun »Light« oder »Nicht Light« ist, ein Klacks dagegen. (Ein kleiner Tipp für die Diabetiker unter den Lesern: Ein Blutzuckermessgerät kann eine solche Situation schnell peinlich werden lassen – für die Bedienung. Ich zumindest möchte keine Cola Light serviert bekommen, aber leider gibt es noch keine Spülmittelmessgeräte für den Hausgebrauch.)
Das mein Geschmack manchmal besser als ein Laborgerät und ein Haufen Laborassistenten ist, hat sich vor vielen Jahren gezeigt. Ich hatte beim Trinken meines gewohnten Mineralwassers das Gefühl: Hier stimmt etwas nicht. OK, es war Sommer, manchmal kommt es da zu Abweichungen im Geschmack, wenn der Kasten Wasser länger in der Sonne gestanden hat oder einfach so warm geworden ist. Nachdem aber auch andere Flaschen aus unterschiedlichen Kisten komisch schmeckten, konnte etwas nicht stimmen. Ich meldete mich beim Hersteller, dieser lies die Kisten abholen. Auf Nachfrage hieß es: Unsere Sensoriker haben nichts gefunden, aber das Wasser sei ins Labor gegangen. Hmmm, doch nur Einbildung? Wie sich (viel) später herausstellte: Nein, ich lag richtig. Was war passiert? Selbst das Labor war recht ratlos und hat auf Anhieb nichts gefunden. Dann überprüfte man, was sich in letzter Zeit in der Produktionskette geändert hatte, und siehe da: Man hat den Außenbedruck auf den Flaschenverschlüssen gewechselt! Genau diese neue Farbe hat minimal ausgedampft, und genau das hatte ich wahrgenommen. Das Labor konnte den Stoff erst nachweisen, nachdem sie genau wussten, wonach sie zu suchen hatten. Danach gab es von diesem Hersteller monatelang keine bedruckten Verschlüsse mehr …
Wer nun denkt, dass ich der geborene Sommelier sei, muss ich leider enttäuschen. Alkohol belegt meine Geschmacksnerven derart, dass ich feine Noten von Melone, Schiefer und Heidelbeere nicht heraus schmecken kann. Ich gehe hier den pragmatischen Weg: Wein schmeckt, oder schmeckt eben nicht. Ist zur Abwechslung auch mal entspannend.
Das Riechen
Die Welt ist voller Gerüche. Und es ist nur menschlich, diese einfangen und mit sich herumtragen zu wollen. Nun ist das aber leider für jemanden, der hier sehr empfindlich ist, eine unheimliche Last. Für mich persönlich ist es das größte Hemmnis, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Das Problem fängt bereits zu Hause an: Es ist belastend, wenn frisch gewaschene Wäsche einem den Atem raubt. Bis ich ein Waschmittel gefunden hatte, das nicht einfach nach Kernseife müffelt, mich aber trotzdem nicht übermäßig reizt – das hat viele Jahre gedauert. Warum in aller Welt will die Menschheit eigentlich, dass ihre Wäsche nach Alpenduft, Meeresbrise, Sommergarten oder Schneeparadies riecht? Und noch unverständlicher: Wieso glaubt sie, dass eine »Sommerfrische« so duftet wie sich Herr oder Frau Waschmittelhersteller das vorstellen? Natur ist etwas schönes, Duftkompositionen sind eine Beleidigung für die Natur!
Seit einigen Jahren gibt es ja den Trend »parfümfrei«. Wer aber nun glaubt, das sei ein Segen: Falsch gedacht. Mir kann zumindest keiner erzählen, dass die verwendeten Rohstoffe für Cremes und Co »duften« statt »riechen«! Parfümfrei heißt leider noch bei zu vielen Produkten: drei Tropfen weniger von dem Stinkekram reingepanscht. Klar – würde sonst keiner kaufen, er bemerkt den Unterschied sonst ja nicht. Es kann einen in die Verzweiflung treiben, wenn man die eigene Partnerin nach dem Duschen nicht riechen kann, weil man keine Luft bekommt.
Das Haus liegt in der eigenen Verantwortung, da kann man selbst etwas an der Duftsituation ändern. Aber sobald man die eigenen vier Wände verlässt, ist man der Umwelt und den Menschen ausgeliefert. Sei es im Bus oder in der Bahn, wo man das Parfüm und die Haarpflegeprodukte der Mitmenschen (bildlich gesprochen) in die Nase gedrückt bekommt, oder einfach nur auf offener Straße. Manchmal könnte man glauben, dass Leute sich derart einduften, damit man sie noch am anderen Ende der Welt riechen kann! Ganz schlimm wird es für mich im Flugzeug. So wie jeder einen Tomatensaft bestellt, wenn einer damit anfängt, funktioniert das auch mit Duty-Free. Was man gerade zum Schnäppchenpreis gekauft hat, muss natürlich umgehend ausprobiert werden. Und auch wenn man sich zusammenreißt: Man macht sich doch »frisch« bevor man aus dem Flugzeug steigt? Für alle die darunter leiden: Ein Taschentuch mit Heilpflanzenöl kann hier helfen (sofern man den Geruch mag). Das überdeckt so ziemlich alle anderen Gerüche und, direkt unter die Nase gehalten, hilft es zumindest mir freier durchzuatmen. Was uns sensorisch empfindlichen Autisten geruchsmässig angetan wird, kann jeder prima selbst ausprobieren: Besuchen Sie die Waschmittelabteilung im Supermarkt. Alternativ die Parfümerie im Kaufhaus. Ich komme da nur mit Luftanhalten durch!
Solchen Situationen kann man zumindest versuchen, auszuweichen. Das Ausweichen schränkt das Leben, gemessen mit den nichtautistischen und normalen Maßstäben, zwar ordentlich ein, aber man kann sich damit arrangieren. Einschneidend wird es, wenn man wegen dieser sensorischen Empfindlichkeit quasi und praktisch jeden »sozialen« Event meiden muss. Gerade im Theater, Kino, Konzert oder bei Veranstaltungen duften sich die Menschen derart ein, dass man das als sensibler Mensch kaum ertragen kann. Und man hat keinen Spaß an so einer Veranstaltung, wenn man während der gesamten Zeit das Gefühl hat, zu ersticken.
Stellen Sie sich ein Leben ohne soziale Veranstaltungen, ohne Spaß und Vergnügen vor. Stellen Sie sich vor, dass Sie das Haus nicht verlassen, weil die auf sie einprasselnden Reize sie überlasten – alles nur wegen Gerüchen, die Sie nicht ertragen. Meine Bitte: Achten Sie sich einmal darauf, welche Duftstoffe sie in welchen Mengen benutzen, bevor sie zu so einer Veranstaltung gehen. Und denken Sie dabei an Menschen wie mich, damit aus einem atemberaubenden Duft für manche nicht ein atemraubender wird. Danke!
Das Fühlen
Ich möchte mich an dieser Stelle auf Schmerzreize beschränken. Dem Tastsinn, Berührungen und Co. ist das nächste Kapitel gewidmet.
Viele Autisten berichten von einem veränderten Temperaturempfinden. So kann es durchaus vorkommen, dass heißes Wasser nicht wirklich oder zu spät als heiß empfunden wird, oder dass sich ein Autist in der Kälte wohl fühlt und seine Hand problemlos lange Zeit in Eiswasser halten kann, weit über den Punkt hinaus, wo andere Menschen vor Schmerz aufheulen. Mein schönster Winter war einer in Kanada, bei um die minus 40 Grad und mit Eisblumen an der Innenseite der Fenster. Wärme hingegen mag ich persönlich gar nicht, ich hasse es zu schwitzen. Schwitzen spannt mich an und belastet mich.
Wichtig zu wissen ist, wie Autisten Schmerz empfinden. Natürlich ist das nicht bei allen so, aber viele von uns haben ein vermindertes Schmerzempfinden. Da hält man durchaus schon mal Schmerzen aus, die andere wahnsinnig machen würden, empfindet manches als nicht so schlimm, und unterschätzt so manche Verletzung, tut sie als Bagatelle ab. Auch können viele Autisten die Frage eines Arztes nach dem Schweregrad der Schmerzen nicht sinnvoll beantworten. Hier ist es wichtig, dass der eigene Arzt, die eigene Ärztin über dieses veränderte Schmerzempfinden Bescheid wissen, um die Aussagen von autistischen Patienten entsprechend einordnen zu können. Denn Autisten sprechen in solchen Fällen leider oft keine für Außenstehende eindeutige und klar verständliche Sprache. Das liegt nicht daran, dass sie dies nicht wollen, sondern dass sie es aufgrund eines anderen Empfindens nicht können!
Auch sind Fragen, die sich auf Stärke oder die Art der Schmerzen konzentrieren, oftmals für Autisten uneindeutig gestellt. Es gibt keine Pauschallösung für dieses Problem, aber ich kann nur raten, bei Autisten sehr genau nach zu fragen und dabei ein vermindertes Schmerzempfinden im Hinterkopf zu behalten. Ärzte, die ihre Patienten schon länger kennen, können das zumeist gut einschätzen.
Aber einen Satz möchte ich bitte nicht hören: »Wenn sie derartig schlimme Schmerzen hätten, wären sie schon längst zu mir gekommen!« Ich kann solche Aussagen mittlerweile begrenzt einschätzen und weiß damit umzugehen. Aber das trifft nicht auf alle Autisten zu: Besonders, wenn er oder sie sich schon überwinden musste zum Arzt zu gehen, sich ihm anzuvertrauen, können solche Sprüche dauerhaft verschrecken. Das Gefühl, nicht verstanden zu werden, ist für Menschen mit Autismus gerade im medizinischen Bereich fatal. So mancher, ich kann mich da auch nicht ganz ausschließen, bleibt deswegen oft lieber zu Hause, als sich von Ärzten helfen zu lassen.
Ich bin froh um jeden Arzt, der bei der Erwähnung von »Asperger« oder »Autismus« nicht zusammenzuckt, die Stirn runzelt oder zweifelnden Blickes den Kopf schüttelt. Denn es gibt sie, die engagierten, informierten und aufgeschlossenen Ärzte. Sie scheinen noch recht wenig verbreitet zu sein, aber wenn man sie gefunden hat, sind sie Gold wert.
Wer nach dem Lesen dieses Kapitels das Bild eines sensorischen Superhelden vor Augen hat: »Super« und »Held« ist anders. In einem Gewitter von Reizen gehen feine Impulse oftmals verloren, sie gehen im Getöse unter. Was bleibt, ist das Gewitter, die Belastung und der drohende Overload.
Please don’t touch
Wie die anderen Sinne auch, kann der Tastsinn bei Autisten besonders ausgeprägt sein. Nicht nur in der Empfindung sondern auch in der Bedeutung. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass ein autistisches Kind sich unter Umständen weniger mit der Funktion eines Spielzeuges als mit einem Teil oder der Oberfläche befasst? Das kann zum einen eine Teilfunktion des Spielzeuges oder Gegenstandes sein – also das sich drehende Rad eines Autos, ein beweglicher Teil, etwas was Geräusche macht usw.. Es kann aber auch die Oberfläche sein, die einen Autisten fasziniert. Ich kann nicht sagen ob es etwas besonders bei Autisten Ausgeprägtes ist, aber ich habe schon von klein auf meine Welt im wahrsten Sinne des Wortes »begriffen«. Oberflächen und deren Struktur bzw. Textur haben mich schon immer fasziniert. Und auch heute noch muss ich mich manchmal sehr beherrschen, Dinge nicht einfach anzufassen um sie begreifen zu können.
Im Laufe der Jahre memoriert man, wie sich verbreitete Dinge beim Anfassen anfühlen werden. Und lernt auch, dass man eben nicht alles anfassen darf, wie man gerade lustig ist. So fand ich als kleines Kind die Winterdekoration eines Schaufensters total faszinierend. Die Wäscherei hatte das Schaufenster mit künstlichem Schnee besprüht. Ich stand lange vor dem Schaufenster, weniger weil es mir gefiel sondern weil ich rätselte ob dieser Schnee nun innen oder außen aufgesprüht war. Mich faszinierte also nicht die Gesamtheit sondern ein kleines Detail, über das sich andere wohl niemals einen Kopf gemacht haben dürften. Ich kam durch das Betrachten nicht darauf, wo sich nun der Schnee befand und wie er sich anfühlen musste. In logischer Konsequenz nahm ich also vorsichtig einen Finger und berührte die Schaufensterscheibe. Der Schnee war von außen aufgesprüht und dort wo mein Finger die Scheibe berührte war nun ein kleiner aber gut sichtbarer Punkt im Schneegestöber. Und wie es kommen musste so kam es auch: Ich stand noch recht fasziniert aber auch erschrocken um den Schaden den ich da angerichtet hatte vor dem Schaufenster und betrachtete meinen Finger. Währenddessen stürmte aber schon eine Angestellte aus dem Laden und fing mit einer Standpauke an, die sich gewaschen hatte. Ich sagte nur: »Ich wollte doch nur fühlen …«. Als Antwort bekam ich »wenn alle das so machen würden wäre kein Schnee mehr am Schaufenster« zu hören. Danach hatte ich erst einmal eine ganze Weile fürchterliche Angst, meine Welt weiterhin durch Anfassen zu begreifen. Heute denke ich mir: Wer nicht will, dass man seine Schaufenster antatscht und eine Deko beschädigt: Der soll sie gefälligst innen anbringen oder sich nicht aufregen!





























