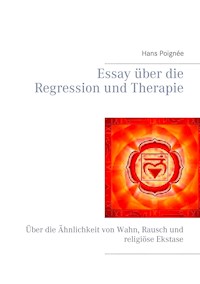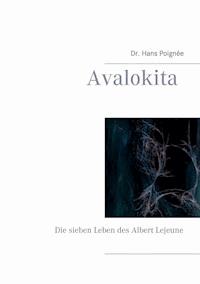
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein schelmenhafter Roman über das Leben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Von der Beschaulichkeit der 60-er Jahre über den Jugendaufstand in den 70-er Jahren zur Flucht in die Selbsterfahrung bis hin zum bürgelrichen Alltag. Alles betrachtet aus einer selbstironischen Perspektive, als Avalokita, als Betrachter aus einer höheren Warte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Letztes Leben: Le promeneur solitaire
Zweites Leben: Lehrjahre des Herzens
Drittes Leben: Alma mater
Viertes Leben: Die Erprobung neuer Sozialformen oder wie man Handtücher spart
Fünftes Leben: Die Suche nach der Erkenntnis oder La folie à plusieurs
Sechstes Leben: Amateur oder Animator?
Siebtes Leben: Der schleichende Tod oder das Berufsbeamtentum
Schluss
Zum Geleit
Manchmal erscheint uns das, was wir gemeinhin als unser Leben bezeichnen, ziemlich verworren. Wir ändern uns nicht nur häufig, wir sind auch nicht beständig in unserem Fühlen und in unseren Überzeugungen. Manchmal erscheint es uns, wenn wir in ein Fotoalbum blicken, als ob uns dieser Mensch, der wir ganz offensichtlich einmal waren, gänzlich fremd sei. Vielleicht führen wir nicht nur ein Leben, sondern mehrere, die manchmal mit einem Schicksalsschlag oder einer glücklichen Fügung des Himmels beginnen und manchmal in dunklen Sackgassen und Verwirrungen ein Ende nehmen. Vielleicht lebte Albert Lejeune deshalb sieben Leben, oder acht, wer will das schon so genau wissen?
Letztes Leben: Le promeneur solitaire
Die Visitenkarte, die er dem kleinen Jungen in die weichen Hände drückte, war aus feinem, weißem Papier. Den Text konnte der Fünfjährige, der gerade für das Lagerfeuer seiner Eltern nach Holz suchte, noch nicht lesen. Erst eine Weile später las ihm sein Vater vor: „Albert Lejeune, Fußgänger, Wien, Madrid, Gibraltar“. Der Mann war nett gewesen, hatte Leon nach seinem Namen gefragt und ihm beim Holzsammeln unterstützt. Dann hatte er seinen Rucksack geöffnet, einen dunklen Laib Brot mit dem Taschenmesser aufgeschnitten, Käsebrot und Milch mit dem Jungen geteilt. Als der Kleine die Visitenkarte seinen Eltern zeigte, hatte der einsame Wanderer den Jakobsbrunnen schon weit hinter sich gelassen. Niemand konnte später feststellen, wohin er gegangen war, noch verstehen, weshalb er seine komplette, spärliche Ausrüstung zurück gelassen hatte. Eine Feldflasche mit kuhfrischer Milch, ein Camembert, ein Vollkornbrot, weder Personalausweis noch Kompass hatte er mitgenommen.
Es war Samstagnachmittag, der Wald stand leuchtend und moosgrün gegen die satten, duftenden Sommerwiesen voll Schaumkraut und Margeriten. Im Kopfteil des Rucksacks fand Leon ein dickes, verfettetes Notizbuch, das nach Gras, Käse und Schimmel roch.
Ein Jahr vorher
Albert Lejeune, legte das fertige Manuskript eines Büchleins aus der Hand. Eigentlich wollte er in narzisstischer Weise diese Novelle als sein letztes Werk der Öffentlichkeit vorstellen. Während er sich selbst mit dem Genuss einer kompletten Tafel Ritter-Sport belohnte, entschied er sich doch noch einmal darüber nachzudenken, ob es über das Leben als solches nicht noch anderes zu berichten gäbe als die Tatsache, dass es unerklärliche Zusammenhänge im Leben gab, dass unglückliche Zufälle im Rückblick eines Lebens sich als Glücksfälle herausstellen, dass Sexualität etwas ist, was sich entwickeln lässt und dass der Tod immer dann entritt, wenn man ihn am wenigsten erwartet. Außerdem fühlte er sich, im Abstand von 14 Tagen betrachtet, unwohl bei der manieristischen Art, in der er den „Marabut“ geschrieben hatte. Natürlich war es der Stil von W. Somerset Maugham gewesen, dessen Lebensende er beschreiben und dessen Stil sich in dem blauen Folianten wiederfinden sollte. Aber heute schrieb niemand mehr einen solchen Stil, voller Metaphern, Andeutungen und dunklen Winken. Heute, um Jahr 2000 war es angesagt, extrem cool aus der Welt des Internets zu plaudern, Helden warfen wie bei Grisham nur so mit den 100.000 $ um sich, die Protagonisten reisten ununterbrochen um den Erdball in geheimnisvollen Missionen und wenn nicht, so brachten sie zumindest das Internet zum Erliegen, planten oder verhinderten Attentate auf den amerikanischen Präsidenten oder waren völlig hip in den Diskos, vollgedröhnt mit Exstacy oder Mushrooms. Ihre Message war wahlweise:
Es lohnt sich jedes Geschäft, wenn es Geld gibt.
Allen geht es schlecht, aber mir geht es besonders.
Männer sind noch blöder.
Nur in geheimer Mission, mit MG, Maserati und Laptop lohnt sich der Einsatz des Lebens.
Nur frisch eingekaufte Hemden, Kokain und Alk gemischt
mit juvenilem Zynismus machen das Leben schön.
Albert sehnte sich, wie das bei vielen Männern nach der Midlife-Crisis der Fall ist, zurück nach der guten alten Zeit. Vielleicht war es die Mühe wert, einmal aufzuzeigen, wie die Welt früher war, so vor einem halben Jahrhundert, in jener Zeit, die die jetzige Jugend kaum mehr vom Dritten Reich unterscheiden kann. Er legte den Bleistift aus der Hand und legte sich schlafen. In der Nacht legten sich Bänder um sein Herz und er rang nach Luft wie ein Sterbender. Ein gutes Zeichen; am nächsten Morgen würde er wie Wiedergeboren sein. Am Nachmittag endlich, nach Kaffee, Brötchen, Morgenzeitung, Stadtbummel und Telefonaten machte er sich an die Arbeit und begann zu schreiben. Dieses Mal nahm der den neuen Laptop zur Hand, installierte ein Diktierprogramm- eine Sekretärin kann sich ein Schriftsteller nur leisten, wenn er gleichzeitig Staatsminister ist- und bemühte sich, dem Computer seine Stimme nahe zu bringen. Der erste Abend war geschenkt. Er brauchte bis in die späte Nacht, um das Programm zu „zähmen“. Am nächsten Tag begann das Diktat:
Erstes Leben: Dichtung und Wahrheit
Das Dumme am zweiten Weltkrieg ist, dass er überhaupt stattfand. Ständig stößt man in Europa auf bescheuerte Ausländer, die einem deswegen schneiden. In Split wird man auf offener Straße als „Scheiß-Deutscher“ beschimpft, wenn man Krachlederne anzieht.
Dabei ist meine hirschlederne Hose, die mir meine Eltern mit 7 Jahren verpasst hatten – ein Erbstück – sicher unschuldiger an den Massenmorden an Serben als Ustasha der Kroaten.
Aber auch die wollten einmal einen 14- jährigen Jungen ins Gefängnis stecken, weil er sich mit einem 5 – Pfennig – Schein eine Zigarette anzünden wollte, mit dem Abbild des Staatspräsidenten Tito auf der vorderen Seite. Und auf einem Parkplatz in Porec war es einem Kroaten eine Ehre, uns, den blöden Deutschen, den Parkplatz, auf den wir offensichtlich gerade einfahren wollten, weg zu schnappen.
Wir haben uns gerächt und seinem Fiat in der Parklücke um 90 Grad gedreht. Das geht schon bei 6 kräftigen Helfern! Persönlich habe ich nur ein beeindruckendes Beispiel französischen Hasses auf Deutsche erleben müssen. Nachts um 22 Uhr war ich in der Nähe von Marseille mit einem französischen Freund auf dem Heimweg von der Diskothek. Im Dunkel und nicht allzu fern hörte ich das Wort „Bosch“, das sich wohl auf das Deutsch bezog, das mein Freund mit mir üben wollte. Zu spät versuchte ich ihn davon zu überzeugen, dass wir es lieber mit Französisch versuchen sollten, schauen hatten wir beide einem Kinnhaken und lagen am Boden. Damals wusste ich noch nicht, dass sich Jugendliche aus Marseille am Samstagabend auf ihre Motorräder schwingen, die Campingplätze in der Nähe aufsuchen und ihren Spaß haben wollen. Was so ein Straßenbau-Facharbeiter, Sanitärlehrling oder Arbeitsloser unter Spaß versteht. Seither habe ich mir die Überzeugung zugelegt, dass Rassismus eine Frage der Intelligenz und nicht der Überzeugung ist. Dass Hitler selbst ein Depp gewesen ist, passt hervorragend zu meinen Beobachtungen. Einmal wollte ich ein paar Hauptschülern nahe bringen, warum Nationalsozialismus nichts Vernünftiges ist. Diese Schüler sind – das verstehen viele Intellektuelle nicht – fasziniert von der Tatsache, dass einer wie sie ein Hitler (= Hüttler), der Name sagt schon alles, zum Führer werden konnte. Will man ihnen diesem Mann madig machen, genügt nicht der Hinweis auf 6 Millionen Juden. Man muss ihnen sagen, wie unendlich dumm dieser Mann war, sich nach der Aufbauarbeit mit einem Gegner wie der Sowjetunion oder den USA anzulegen. Man muss ihnen das Gefühl geben, besser zu sein als Hitler, was sie meistens auch sind. Über Hitler, den Nationalsozialismus und sein Verhältnis zu Frankreich zu schreiben, war eine Notwendigkeit, der sich Albert nicht entziehen konnte, denn sein Leben begann nur sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Seine Eltern waren ohne nennenswerten Schaden aus den Kriegswirren hervor geschliddert. Eine Sprengbombe hatte nur das Treppenhaus des Elternhauses des Vaters in die Tiefe gerissen. In diesem Haus erlebte Albert seine frühe Kindheit.
Manchmal stellte er sich vor, russische Flieger kämen plötzlich aus den dunklen Tannenwald des Schwarzwaldes hervor und würfen ihre Bomben auf Freiburg. Aber die Russen waren weit weg, Freiburg war französische Besatzungszone und die Kinder der Sergeants und Officiers gingen auf das Lucée Turenne, direkt neben dem altertümlichen Gebäude, in dem Albert seine ersten Schuljahre verbrachte.
Goethe schrieb in Dichtung und Wahrheit ein Erlebnis aus der Zeit, als er so alt wie Albert war. Seine Eltern fanden den Jungen Johann Wolfgang am Küchenfenster sitzen wie er, herzallerliebst, das gesamte Inventar an tönernem Geschirr aus dem Fenster warf. Goethe führt dies im Rückblick darauf zurück, dass er sich am Klang zerspringender Tontöpfe und Teller erfreut habe. Albert brauchte Jahre, nachdem ihm sein Deutschlehrer die Anekdote übermittelt hatte, um den wahren Sinn des Geschehens zu begreifen. Auch Johann Wolfgang wurde wie Albert von der Geburt eines Bruders überrascht, der bald alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Da galt es gegenzusteuern. Mit dem Lärm konnte er das glänzend bewerkstelligen. Albert warf, als sein Bruder Karl gegen Weihnacht zur Welt gekommen war, den gesamten Christbaumschmuck, vor allem die hell klingenden Glaskugeln aus dem dritten Stock. Darin erschöpfen sich jedoch die Ähnlichkeiten in deren Lebensläufen.
Das Leben nach dem Krieg war abenteuerlich und für ein Kind wie ein unentdecktes Eiland. Wenn ein Land bei Null anfängt – als Kind und als Teilnehmer der freien Marktwirtschaft – ist immer alles aufregend. Noch lag vieles in Trümmern – heute würde man diese einen Abenteuerspielplatz nennen. Frankreich war nicht nur durch die Besatzungsmacht immer sehr nahe gewesen. Der Bürgersteig hieß nie anders als trottoir die Pisshäuschen an den Straßen hießen pissoirs und die Mädchen sollten keine visi(t)ma-tente(n) machen.
Die gutgenährten Männer dieser Zeit waren die Schrotthändler. Der später in Vergessenheit geratene Ausruf: „ Lupen, Alteisen, Papier“ hatte für Albert etwas Verruchtes an sich. Einmal brach er durch ein ebenerdiges Fensterchen in eine Schrebergartenhütte ein und entwendete einen Hammer und ein Stemmeisen, um es dem Schrotthändler, der unweit am Bahndamm seinen Platz hatte, zu bringen. Doch selbst der Schrotthändler, der schon Jahre später seine Villa mit vergoldeten Wasserhähnen in Littenweiler besaß, war sich der Legalität dieses Geschäftes nicht sicher. „Das hast du doch irgendwo gestohlen?“ Normalerweise waren Schrotthändler nach dem Krieg nicht so wählerisch. Freiburg lag voller Trümmer, aus denen man jedoch gleich leicht verformte Eisenrohre ziehen konnte, die sie dann als gebrauchte Ersatzteile teuer verkaufen konnten.
Der besagte Schrotthändler, Schottmüller hieß er, wandte sich bald dem Hochbau zu. In seinem Lager türmten sich Wasserrohre, Siphons, Abflussrohre, Badewannen sowie weiße, grüne und rosa Kacheln. An jeder Straßenkreuzung konnte er Arbeitslose finden, einarmige Plattenleger, kräftige Maurer mit einem Auge, auch ehemalige Parteimitglieder, die sich in Krieg in Schreibstuben warm und gesund gehalten hatten und sich auf Arbeitseinsätze – gleich welcher Arbeiter – verstanden. So wie die Uniformen beim Einmarsch der Alliierten in Senkgruben und Feuern verschwanden, so wollte plötzlich niemand mehr Nazi gewesen sein, höchstens Mitläufer der zweiten Stunde; Persilscheine wurden zu Hunderten problemlos ausgestellt.
Kundschaft für Schottmüller gab es bald genug: Die ersten Mietskasernen sollten bald die Obdachlosen aufnehmen. Sein Geschäftsbereich wuchs, als er mit einen katholischen Pfarrer, den er aus seiner Zeit bei der christlichen Jugend kannte und zehn anderen die CDU gründete. Die neue Partei, die sie christlich – demokratisch nannten, war frei vom üblen Geschmack der Straßenschlachten, der den Sozialdemokraten und den Kommunisten anhaftete. Der Parteivorsitzenden der bayrischen Schwesterpartei, ein Mann namens Franz Josef Strauss, hielt eine bemerkenswerte, rhetorisch geschliffene Rede, in der er die populäre Forderung (Er sollte sich immer auf das verstehen, was populär und gewinnträchtig war!) aufstellte: „ Jedem Deutschen soll die Hand abfallen, der je wieder ein Gewehr in den Hand nimmt!“. Ihm fiel sich später nicht ab als er mit der übrigen Prominenz Bayerns auf Jagd ging oder wenn er mit Waffen Geschäfte machte).
Albert hatte nun unglücklicherweise nichts dazu beitragen dürfen, den gewaltigen Bedarf an Eisen nach dem Krieg zu befriedigen, sein gestohlener Hammer war rüde zurückgewiesen worden. Für einen Jungen von vier Jahren war es 1955 noch ziemlich schwer, auf ehrliche Weise zu Geld zu kommen. Weiter unten in der Erwinstraße stand das Gründerzeithaus, in dem die Familie Lejeune im dritten Stock eine Vier-Zimmer-Wohnung bewohnte. Ein Stück weiter unten gab es eine Bäckerei, deren Schaufenster gerade mal zwei Quadratmeter groß war, in dem ein einziges Brot vor sich hin dämmerte, umrahmt von zwei steinharten Brötchen und einer langsam vergilbenden Meringe. Im Verkaufsraum war es dunkel, hinter der Theke etwas mehr Brot, aber auch nicht füllig. Durch einen dunklen Schlund gelangte der mutige Forscher in die Backstube, in dem Mehlstaub in der Luft das Atmen schwer machte, Teigklumpen auf weißem Leinen ausgebreitet lagen und Herr Brandner die ganze Nachbarschaft mit Backwaren versorgte. Brandner, noch nicht versorgt mit modernem Gerät, war immer emsig am Kneten oder Verkaufen. Da ihm selbst die Zeit fehlte, schickte er Albert und die anderen Kinder aus der Dreikönigstraße, die sich ihre Nasen am Schaufenster platt