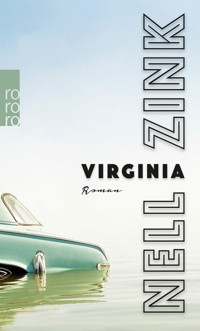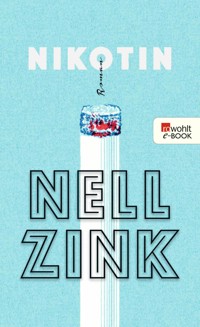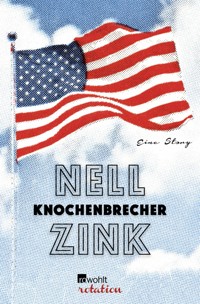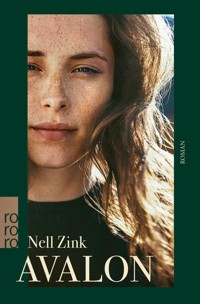
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Eine besondere Liebesgeschichte, ein besonderer Blick auf die amerikanische Klassengesellschaft und auf die Suche nach dem persönlichen Glück.» Hessischer Rundfunk Bran Thomas hat schon früh gelernt, was Verlust bedeutet. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt, ihre Mutter starb, nachdem sie die Tochter früh bei Verwandten zurückgelassen hat, um tibetische Nonne zu werden. Für ihre Stieffamilie, die eine Gärtnerei betreibt und allerhand krummen Geschäften nachgeht, ist Bran eine billige Arbeitskraft, aber sie ist klug und schafft die Highschool – nur fehlt ihr eine Perspektive. Sie lebt in ihrem klapprigen Auto und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, als sie Peter kennenlernt, einen gutaussehenden intellektuellen Überflieger von der Ostküste, der pausenlos Kapitalismuskritik absondert. Bran verliebt sich unsterblich. Während die beiden eine so stürmische wie krisenhafte Fernbeziehung beginnen, stellt Bran ihre katastrophale Existenz immer mehr infrage. Sie weiß, wie man überlebt, aber sie weiß auch: um glücklich zu sein, ist überleben nicht genug. «Nell Zink ist eine erstaunliche Entdeckung.» Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nell Zink
Avalon
Roman
Über dieses Buch
Für Bran Thomas ist Avalon ein paradiesischer kleiner Hafenort auf Santa Catalina Island, vor der Küste Kaliforniens. Sie war dort nur einmal, mit ihrer Mutter, als diese noch lebte. Seit deren Tod wächst Bran bei einer Stieffamilie auf, die eine Pflanzengärtnerei betreibt. Brutalität und Ausbeutung hilflos ausgesetzt, haust sie in einem Schuppen und schuftet für Kost und Logis. Aber sie ist klug, schafft die Highschool – nur fehlt ihr eine Perspektive. Sie kampiert in ihrem zusammenbrechenden Auto, jobbt im Coffeeshop und anderswo und hält per Handy Kontakt zu ihren ehemaligen Mitschülern, die alle an der Uni sind.
Eines Tages schleppt ein Schulfreund Peter an, einen gut aussehenden intellektuellen Überflieger von der Ostküste, der pausenlos Kapitalismuskritik absondert. Bran sieht ihn und verliebt sich unsterblich. Das Problem: Er interessiert sich zwar auch sofort für sie, aber er ist mit einer bruneiischen Prinzessin verlobt und, Kapitalismuskritik hin oder her, konservativ. Nur mit Brans proletarischer Resilienz hat er nicht gerechnet …
Vita
Nell Zink, 1964 in Kalifornien geboren, wuchs im ländlichen Virginia auf. Sie studierte am College of William and Mary Philosophie und wurde in Medienwissenschaft an der Universität Tübingen promoviert. Mit ihrem 2019 erschienenen Roman Virginia war sie für den National Book Award nominiert. Sie lebt in Bad Belzig, südlich von Berlin.
Thomas Überhoff studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik und arbeitete lange als Lektor und Programmleiter Belletristik beim Rowohlt Verlag. Er übersetzte unter anderem Sheila Heti, Nell Zink, Jack Kerouac und Denis Johnson.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel «Avalon» bei Alfred A. Knopf, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Avalon» Copyright © 2022 by Nell Zink
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, nach einem Entwurf von Coco Meurer
Coverabbildung Jules Esick
ISBN 978-3-644-01407-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
KAPITEL EINS
Ich lag auf meinem Rucksack und wollte nicht wahrhaben, dass mein Arm gebrochen war. Der Mond hatte mich glauben lassen, es sei hell genug, einen Berg hinunterzuhüpfen. Die Wasserfallwiese, die Seidenpapierblätter, die Eisbergwolken und Diamantfelsen, der Mond ein Teich voll toter Frösche: Beim Blick von der Eingangstreppe hatte ich die Welt in Weißtönen gesehen. Aber sie war schwarz, ein weicher Mix aus haarfeinem Gras und krümeliger Erde, der mich zwischen dem Schmelzkern der Welt und dem All balancierte, während ich die Finger tastend über meinen Arm gleiten ließ.
Ich setzte mich auf. Ein schmieriger Streifen Mondlicht führte zur Insel Avalon. Aber da war keine Insel, und mein Arm war in Ordnung. Je länger ich ihn betastete, umso heiler fühlte er sich an.
Es war eine warme Nacht. Ich nahm den Rucksack ab und schaute, auf die Hände gestützt, hinauf und hinaus zum aufgerissenen, mit Flugzeugen übersäten Firmament. Der Wind nahm zu, und langes Gras kitzelte mich im Gesicht. Ich fragte mich, ob mein Wagen anspringen würde. Ich hörte einen großen Hund schnuppern und Peters Stimme sagen: «Halt, mach langsam, Rabelais!»
Er kam näher. Er hatte mir noch etwas zu sagen.
Ungefähr drei Meter hinter mir blieb er stehen. Das Gescharre sagte mir, dass er den Hund am Halsband festhielt. Er wartete, aber ich konnte ihn nicht ansehen.
Leise sagte er: «Weißt du was? Sie hat zuerst angerufen und mich zum Teufel geschickt.» Pause. «Was für ein Scheiß-Desaster. Ich weiß nicht, wer es ihr gesteckt hat, aber jetzt trennt uns nichts mehr …» Pause. «Nichts mehr außer diesem verdammten Köter.»
Die Sterne zerflossen in unbeschreiblichem Glück. Warum nur? War das irgendwie moralisch zu rechtfertigen?
«Avalon» heißt «Ort mit Äpfeln», diesem gesunden Zeug, das auf Bäumen wächst. Wenn du Äpfel richtig behandelst, bleiben sie das ganze Jahr frisch. Deshalb heißt das Wort Paradies «Garten», und deshalb wurde Artus nach Avalon gebracht, um seine Wunden zu heilen.
Am Ostersonntag 2005, als ich in der vierten Klasse war, brachten meine Mutter und mein nichtehelicher Stiefvater mich und meinen nichtehelichen Stiefbruder dorthin. Die Personenfähre fuhr in Long Beach, Kalifornien, ab, südlich von L.A. Wer auch immer das Touristenfallen-Kaff auf Santa Catalina Island «Avalon» getauft hatte, hoffte wohl, von König Artus’ Marktwirksamkeit zu profitieren und weitere mythische westliche Inselparadiese wie Tír na nÓg, Emain Ablach und Atlantis gleich mit heraufzubeschwören. «In Avalon lebt Artus», rief meine Mutter, als sie darauf deutete, und fügte hinzu: «Es gibt ihn nicht in echt.» In ihrer eigenen Welt gab es einen echten König, den Dalai Lama. Das Schiff pflügte durch die flache Dünung, so stetig wie ein Zug. Gequälte Möwen quälten meine Ohren mit Schreien der Qual und verlangten nach Fritten, die ich nicht hatte und ihnen auch nicht hätte geben wollen. Teilnahmslos glotzende fliegende Fische sprachen ihren stummen Gruß – offenkundig magische Wesen, die steif und papieren am Schiff vorbeisegelten, Artus’ schuppige Herolde.
In Avalon fuhren wir mit einem Glasbodenboot und sahen frei lebende Goldfische. Dann aßen wir an einem Imbissstand Burger. Ich durchlief gerade eine Phase, wo ich nur den Bratling ohne was drauf wollte, deshalb verputzte Axel mein Brötchen. Auf Catalina gibt es auch Bisons und Antilopen, aber wir gelangten nicht über den Hafen hinaus.
Nicht lange nach diesem Ausflug zog meine Mutter in ein tibetisch-buddhistisches Kloster und ließ mich mit ihrem Freund und dessen Familie allein. Ich habe noch die Bücher, die sie dagelassen hat: Der König auf Camelot, Flammender Kristall, Taran und das Zauberschwert. Einen Stapel Tolkiens ließ sie auch da, aber die hat Doug verkauft.
Ich habe Probleme, meine Kindheit in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Sie taucht nur in Fragmenten auf, wie ein entkernter und segmentierter Apfel. Setz ihn wieder zusammen, und das Innere verschwindet. Meine erste eigene Erinnerung ist, wie weich sich der Staub auf der Unterseite einer langen rechteckigen, zentimeterdicken Stahlplatte anfühlte – eine, wie sie verwendet werden, um beim Straßenbau Löcher abzudecken, etwa eins zwanzig lang und mit zwei Bohrungen drin, damit ein Kran sie anheben kann –, die auf der Bourdon Farm gegen die Schlackenbetonwand eines Düngemittelschuppens lehnte. Die seltsame Stille dahinter, das schräg einfallende Licht, der scharfe Geruch. Unter meiner gelblich pinken rechten Hand das von Spritzwasser oder Regen unberührte Zement- und Rostgesprengsel. Ich weiß, ich war fast noch ein Baby, weil die Stahlplatte noch heute dort steht und der Raum darunter winzig ist. Spielte ich da, versteckte ich mich, oder beides? Keine Ahnung. Das meiste, was ich weiß, stammt aus zweiter Hand.
Die Hendersons aus Torrance, Kalifornien, gehen einem über Generationen geführten Gewerbe nach. Ihr Haus, wie auch ihr Hof, sind mit Clan-Memorabilien gefüllt. Ein historischer Gefrierschrank samt erhaltener Tür birgt einen Baseballschläger, verziert mit aztekischen Tempelszenen, die in einer Kombination von Holzbrenntechnik und Emaillierung aufgebracht sind. Ein flacher, ausgetrockneter Brunnen birgt einen zerbrochenen Schaukelstuhl mit handbestickter Sitzfläche. Doug hat ihn mal nach einem Regenguss als Schlitten für eine Schlammfahrt benutzt. Für einen Versuch hat es gereicht, so erzählte er mir, danach warf er ihn in den Brunnen. In meiner Kindheit blätterte ich in den spröden schwarzen Seiten grüner Fotoalben und erkannte unsere vordere Veranda hinter einem weißhaarigen Mann am Lenkrad eines glänzenden 1920er Ford T. Der längst ausrangierte Wagen stank nach Hühnerscheiße. Zu meinen Lebzeiten hatte es dort keine Hühner gegeben.
Das Grundstück erstreckt sich über gut zweieinhalb Hektar unter der Starkstromleitung, die von La Fresa nach Redondo Beach hinunterführt. Es reicht von Straße über Schlucht zu Straße, die Umzäumung wird von der Elektrizitätsgesellschaft gepflegt, und drum herum führt eine Crossstrecke, auf der Grandpa Larry früher mit seinen besten Biker-Saufkumpanen Rennen fuhr. Das Gewerbe ist eine auf Exotenimporte und Formschnitt spezialisierte Baumschule. 1978 limitierte die California Proposition 13 die Grundsteuer auf ein Prozent der Wertfestsetzung von 1976. Umzüge sowie An- und Neubauten zogen finanziell einschneidende Neubewertungen nach sich. Um ihre Bemühungen um Werterhaltung zur Schau zu stellen, während sie fünfzig Jahre lang in denselben bescheidenen Häusern lebten, verlegten sich die Reichen aufs Gärtnern, und da kam die Bourdon Farm ins Spiel.
Ob in diesen Schiffscontainern mit Zielhafen Long Beach jemals etwas anderes als tropische Pflanzen eintrifft und ob die motorradfahrenden Freunde der Hendersons mit dessen Verteilung irgendwas zu tun haben, weiß ich nicht. Ich bin nie als Familienmitglied betrachtet worden, es sei denn, sie wollten was von mir.
Wie bei vielen Familienbetrieben ist der Schlüssel zur Rentabilität dieses Geschäfts unbezahlte Arbeit von Frauen, Kindern und unlängst Geflüchteten, die einen Schlafplatz brauchen. Bestenfalls grauer Markt, wahrscheinlicher Schwarzmarkt. Aber Steuerfahnder legen sich nicht mit den Hendersons an. Dazu bräuchte es schon das FBI, und es würde Jahre dauern. Eine schlichte Durchsuchung brächte nichts zutage. Da führt keiner Buch oder bringt Geld auf die Bank. Sie würden sich bei den Bundespolizisten für ihre Unwissenheit entschuldigen (Bundesautorität lehnen sie prinzipiell ab) und sie an ihren imaginären, leider abwesenden Arbeitgeber Mr Bourdon verweisen.
Das Grundstück steht in Kaliforniens Liegenschaftsinventar. So viel weiß ich. Mithilfe des Internets an meiner Highschool habe ich herausgefunden, dass es dem Staat gehört. Ich habe Doug danach gefragt. Er erzählte mir, dass Ur-Ur-Grandpa Allans Ranch sich kilometerweit bis hin zur Madrona-Marsch erstreckte, wo er sein Vieh tränkte. Der Staat enteignete ihn, um die Stadt Torrance zu bauen, und entschädigte die Erben mit einer unbegrenzten Ausnahmeregel für jederlei zukünftig geltendes Recht. «Deshalb hissen wir hier die Fahne der Republik Kalifornien», erklärte er mit Hinweis auf die Staatsflagge samt Grizzlybär und rotem Stern. «Dies ist der einzige Ort, wo ein Mann noch ein aufrechtes Leben führen kann.»
Das Haus ist die Appalachen-Billigversion eines Cape-Cod-Hauses mit Kunststofffassade und Blechdach, und es hockt auf Ziegelpfeilern über einem flachen Kriechboden. Mit Ausnahme des Fernsehers, der stets State of the Art ist, besteht die Einrichtung aus einer immer gleichen Kollektion von heruntergekommenen Uraltmöbeln, die das Problem vergrößern, Erinnerungen Zeitfenstern zuzuordnen, ohne meine Körpergröße als Referenzmaß nehmen zu können.
Grandpa Larry bewohnte das Elternschlafzimmer. Im Alter von drei Jahren wechselte ich von einem mit Mom und Doug geteilten Zimmer in ein mit Axel geteiltes. Mit sechs übernahm ich den unbeheizten, nach Mäusen stinkenden Anbau vor dem, was einst die Hintertür gewesen war. Den hatte man dort hingesetzt, bevor die Kunststofffassade draufgekommen war, deshalb bestanden meine Wände aus Fichtenholz, und ich konnte aus Zeitschriften ausgeschnittene Bilder mit Heftzwecken anbringen. Er hatte zwei Türen und ein winziges Fenster, das nicht zu öffnen war.
Die Biker unterhielten auf dem Grundstück ein Clubhaus, über dem Tag und Nacht der kalifornische Bär und eine schwarze POW/MIA-Flagge zum Gedenken an Kriegsgefangene und Vermisste wehten. Wenn sie richtig besoffen waren, sangen sie «He Ain’t Heavy, He Is My Brother». Den Konsum von Ess- und Rauchwaren trieben sie bewusst auf die Spitze, denn sie setzten Körpergewicht und zerklüftete Gesichter mit Männlichkeit gleich. Ich bin sicher, dass in ihren Gedanken kein richtiger Mann jemals nackt war. Identität war eine Frage von Werkzeugen, Maschinen, Leder und Waffen. Es waren transhumane Cyborgs.
Die Arbeiter waren netter. Die fremden Lieder, die sie mir beibrachten, habe ich vergessen, aber ich erinnere mich an all ihre Namen – Eric, Roger und Simon –, denn Grandpa Larry war ein höllisches Ein-Mann-Ellis-Island. Hundert Jahre zuvor hatte die New Yorker Einwanderungsbehörde Immigranten angelsächsische Namen verpasst, und das fand er gut. Jeder Eric wurde sofort durch einen Eric ersetzt und jeder Roger durch einen Roger, sodass in der Baumschule beide Namen immer je einmal vergeben waren, während Simon die Option für den Hochbetrieb an Ostern und Weihnachten blieb. Die Hendersons fütterten sie durch, gaben ihnen ein Dach über dem Kopf, luden sie zum Fernsehen bei sich ein – obwohl die Benutzung unserer Toilette unerwünscht war –, ließen sie arbeiten, bezahlten sie nicht dafür und stellten ihnen frei, jederzeit weiterzuziehen.
In der Regel blieben sie weniger als einen Monat. Sie hatten ihren eigenen Schuppen mit Propangas-erhitztem Wasser nach Bedarf und teilten sich mit uns die illegale Klärgrube. Ihre Duscheinrichtung war für Pferdeställe konzipiert und nicht für den menschlichen Wohngebrauch, aber sie schienen gern weitab vom Schuss zu sein. Einmal (da war ich ungefähr vierzehn) half ich Doug, eine Norfolktanne nach Rancho Palos Verdes zu bringen, und wir trafen auf einen Typen aus Burkina Faso, der im Jahr davor ungefähr zwei Wochen bei uns verbracht hatte. Er hatte jetzt einen Teamleiterjob bei einem teuren Rasenpflegedienst und nannte sich Roger Bourdon.
Ich begann im Alter von drei Jahren zu arbeiten, indem ich Schnecken in Eimern sammelte und sie zur West 190th Street schleppte, damit sie dort überfahren wurden. Das tat ich, weil meine Mutter wollte, dass auf der Bourdon Farm kein Schneckengift mehr benutzt wurde. Sie mochte Katzen. Die Streuner, die sie fütterte, starben ständig an Metaldehydvergiftung. Sie wurden durch neue Streuner ersetzt, die ebenfalls qualvoll starben. Trotzdem betrachtete das Management meine Arbeit als komplementär zu Schneckengift, nicht als substitutiv.
Den Baggerlader oder den Stapler durfte Mom nie steuern, aber zu der Zeit, als sie ging, konnte sie umtopfen, Wurzelballen trimmen und verpacken und Pflanzen beschneiden. Sonntags, an unserem freien Tag, schnallte sie mich auf den Beifahrersitz von Dougs Truck, und wir fuhren auf dem Pacific Coast Highway nach Norden bis hinter Will Rogers Beach, um dann über den Sunset Boulevard zurückzukehren, wobei wir immer einen Umweg durch eine Straße in Brentwood machten, die mit Banyanbäumen gesäumt war. Meine Mutter fuhr langsam durch die Arkaden ihrer säulenartigen Stützwurzeln und blickte bewundernd auf den Reichtum, für den die Bäume standen, die entlang der Straße wucherten wie ein am Zügel zerrender Dschungel. Dann hielten wir eine Weile unter der gigantischen Großblättrigen Feige (ich hege den Verdacht, dass sie als Yggdrasil angefangen hat und irgendwann zum Bodhi-Baum wurde) vor einer presbyterianischen Kirche nahe der Kreuzung von Palms und Sepulveda und warteten auf das Ende des Gottesdienstes, sodass wir am Buffet Essen und Getränke abstauben konnten, bevor wir über den Freeway nach Hause fuhren.
Wenn ich mir alle Mühe gebe, mich daran zu erinnern, wie sie war, stelle ich mir sie auf dieser langen Rückfahrt nach Torrance vor, wortlos und willentlich glücklich, während ihr der Wind durchs offene Fenster das Haar zerzaust. Was komisch und irgendwie traurig ist, weil ich die ganze Zeit dabei war – ihr eigenes Kind, das parallel zu ihr durch die Frontscheibe starrte, in ständiger Furcht, ihre Konzentration zu stören.
In Pacific Palisades gab es ein buddhistisches Zentrum, das schönste Gebäude auf dem ganzen Sunset. Vielleicht lag es daran. Oder am Verkehr. Wir standen irgendwo im Stau, kamen kaum voran, und sie trug mir auf, mir vorzustellen, dass dieser Moment das Einzige wäre, was je in meinem Leben geschehen war und geschehen würde, und dass er ewig sei, und ich solle mich fragen, ob das Leben dann immer noch lebenswert wäre. Sie fing an, Magazine mit Bildern all der verschiedenen Lamas und Bodhisattvas darin zu kaufen, und stahl sich zum Meditieren davon. Nach neun Jahren mit Doug floh sie in ein buddhistisches Zentrum in den Sierras – Riesenbäume überall – und wurde Nonne.
Ihre Eltern, Grandma Tessa und Grandpa Lamont, mochten mich zwar, aber es fehlte ihnen an Ressourcen. Grandpa Lamont war in der Kindheit als geistig zurückgeblieben diagnostiziert und so lange in staatlichen Einrichtungen beherbergt worden, bis man ihn einzog und die Army herausfand, dass er unter einer behandelbaren Petit-mal-Epilepsie litt. Grandma Tessa hatte bei Bell Helicopter in Fort Worth als Näherin gearbeitet. Sie lernten sich bei einer Freimaurerversammlung in Chicago kennen und zogen zusammen nach Pasadena, wo sie ein schuldengetriebenes Geschäft aufmachten, das Kopierer an Läden verleaste. In meinen Kindertagen waren sie pleite. Soviel ich weiß, war ihr einziger Luxus die alljährliche Fahrt mit mir zu Knott’s Beerenfarm, im Alter von sechs bis dreizehn. Ihre Armut versperrte mir den Zugang zum amerikanischen Jerusalem, Disneyland (während Disney World in Florida das Mekka war). Sie lebten in einem Standard-Mobile-Home in einem Trailerpark für Rentner. Als Mom sich verdünnisierte, nahmen sie mich für acht Tage auf, vom Samstag bis zum darauffolgenden Sonntag. Niemand unter fünfundfünzig durfte länger als eine Woche bleiben. Für den Extratag mussten sie fünfzig Dollar Strafe zahlen.
Die Hendersons behielten mich gern. Ein zehnjähriges Stiefkind bedeutete ungefähr acht Jahre unbezahlte Arbeit und 20000 Dollar Kindergeld, falls das Finanzamt mitspielte. Aus ihrer Sicht bot ihnen meine Mutter als finanziellen Ausgleich für ihre Freiheit mich an.
Freiheit von was? Davon, mich großzuziehen? Bei mir zu sein? Das nahm ich an, weil sie nie zu Besuch kam oder mich zurückhaben wollte. Ein Kloster in Tibet hätte eine Zehnjährige jederzeit aufgenommen, und selbst in Kalifornien hätte das als Heimunterricht durchgehen können, aber ihres war nur für Erwachsene. Es war ein oldschool-tantrisches – Nyingma – mit roten Roben, einem goldenen Stupa, großen Statuen, Steingärten, Räucherstäbchen, Gebetsmühlen, Mantrasingen, Sandmandalas und allem Brimborium. Es residierte in einem ehemaligen Motel an der Straße von Fresno zum Yosemite, hinter Tannen an einem Hang verborgen. Dem erstmaligen Besucher kam es irgendwie lustig vor, denn die Lobby war in Wigwamform gebaut.
Mom arbeitete dort, wie schon auf der Bourdon Farm, für Kost und Logis. Aber sie hatte mehr davon. Die Buddhisten schurigelten sie nicht mit harter oder schneller Arbeit, und sie gaben ihr frei zum Meditieren.
Ihre wichtigste Übung bestand darin, das Bewusstsein so auszubilden, dass es noch die kleinste Bewegung oder Nervenregung wahrnahm, und dieses Training konnte mit jedweder Art von ungelernter Arbeit verbunden werden, etwa den Pool saugen. Wer dabei genügend Tempo rausnimmt, halluziniert irgendwann eine geisterhafte Präsenz, die den Wahrnehmungsleerlauf ausgleicht. In ihrem Fall war es eine blaue Kugel hinter ihrer linken Schulter.
Doug fuhr mich zweimal hin, einmal mit zwölf und einmal mit fünfzehn. Beide Male hörte sie nicht auf zu lächeln. Beim ersten Mal war sie sehr dünn. Beim zweiten Mal sah sie so hungrig aus, dass ich ihr die hart gekochten Eier aus meinem Lunchpaket gab. Tiere durfte sie essen, wenn nicht sie selbst sie getötet hatte, und streng genommen hatten die Eier niemals gelebt. Sie erzählte, sie sei glücklich, und wie sehr sie mich, ihre Novizinnen, ihre Mitmönche und -nonnen sowie ihren Rinpoche liebe.
Wenn ich nach diesen Besuchen im Bett lag und zwanghaft über sie nachdachte, nervte mich immer die Kugel. Ging es darum, das Bewusstsein auf kleinste Reize hin zu trainieren, wie half sie dabei?
Später kam heraus, dass sie Eierstockkrebs gehabt hatte. Aber wenn sie nicht mit maximaler Achtsamkeit Klos schrubbte oder Tannennadeln auffegte, meditierte sie stumm, um sich von der Realität abzulenken, sodass niemand etwas davon mitbekam, bis der Krebs in ihren Rücken metastasierte und sie nicht mehr arbeiten konnte.
Sie starb dort im Kloster mithilfe all der nichtexistenten Palliativmedizin, die Medicaid für Nonnen vorsieht. Ich weinte mit unbeirrbarer Konzentration und spürte ihre Präsenz als vages Epiphänomen in meinem Rücken, wie die Kugel, nur gelb. Vielleicht, weil sie blonde Haare gehabt hatte, als ich klein gewesen war.
Danach holte Doug sie zurück. Er preschte mit einem Bestattungsunternehmer aus Gardena in einem Leichenwagen nach Oakhurst hinauf, um ihre Wertsachen sicherzustellen und ihre sterblichen Überreste vor den Heiden zu retten, von denen er behauptete, sie würden sie auf einem Beinacker den Kondoren zum Fraß vorwerfen. Er ließ sie «wie einen normalen Menschen» verbrennen und nahm mich zum Verstreuen der Asche zu dem Ententeich im Park von Manhattan Beach mit, wo sie sich, wie er sagte, an einem bewölkten Sommernachmittag nach Club-Sandwiches und Kaffee im Kettle zum ersten Mal geküsst hatten, drei Jahre bevor die Auswanderung meines Vaters ihn ermuntert hatte, Axels Mutter wegen meiner zu verlassen.
Das war das Erste, was ich von der Auswanderung meines Vaters hörte. Ich war sechzehn. Ich sagte: «Echt jetzt?»
Doug zufolge war mein Vater nach Australien ausgewandert, als ich elf Monate alt gewesen war. Meine Mutter war da noch im Mutterschaftsurlaub von ihrem Job in der Joghurtfabrik gewesen, wo mein Vater als Kontrolleur gearbeitet hatte, weil ich so viel schrie, so langsam aß und es mir schwerfiel, etwas bei mir zu behalten.
Mein Vater plante die ganze Aktion als Überraschung. Er verkaufte das vormalige Haus seiner Eltern in Hollywood unter unserem Hintern hinweg und mietete eine Zweizimmerwohnung auf der West 190th in Torrance. Er zahlte ein Jahr im Voraus und gab Mom genügend in bar, dass es für das Jahr gelangt hätte.
Für meine Mom lag Torrance am Arsch der Welt, fern von allem, es sei denn, man zählte den mit Teerklumpen übersäten städtischen Strand mit, an dem sie zum ersten Mal Doug begegnet war. Auf Ringe gezogene Müllbeutel wehten leer im Wind, während Rentner im Schatten von Chemietoiletten mit Handgelenks- und Knöchelgewichten gegen die Herzkrankheit ankämpften. Im Kontrast dazu hatte Doug ziemlich gut ausgesehen, aber nicht gut genug, was ihn ärgerte. Solange ihre Ehe bestand, ließ er ihr keine Ruhe.
Dad blieb zwei Nächte in der Wohnung in Torrance. Dann stieg er in einen Flieger zu dem Ort, an dem er seinen Lebenstraum verwirklichen konnte. Sein Lebenstraum bestand darin, wieder single zu sein, eine ihm diesmal treue Frau zu heiraten, neue Kinder zu zeugen, uns nichts zu zahlen und seine Familie samt seinen Eltern und seiner Schwester für immer zu ignorieren. Nach Dads Abgang überredete Doug Mom, ihm die ganze Barschaft zu geben, die Wohnung unterzuvermieten und auf die Bourdon Farm zu ziehen.
Die Hendersons missbrauchten mich weder, noch belästigten sie mich. Zu der Zeit, als ich in den Kindergarten kam, begann Grandpa Larry Reden zu schwingen, dass er jedem Mann, der mich berührte, die Eier abschneiden würde. Diese Reden beunruhigten meine Mutter, aber nicht so sehr, dass sie ihm widersprochen hätte. Manchmal jagten mich Doug und Axel, als würden wir Fangen spielen, und forderten Grandpa Larry so heraus, sie doch zu kastrieren. Aber sowohl sie als auch die Arbeiter hielten sich von mir fern, und das tat auch Grandpa Larry. In gewissem Sinne, irgendwie fast unmerklich, wuchs ich behütet auf. Auch in der Schule blieb ich unbehelligt. Axel war drei Jahre älter und weithin bekannt dafür, dass er einen verletzten Kojoten mit einem Fahrradschloss erschlagen hatte.
Die Hendersons hatten keine Pläne für mich, außer mich auf Trab zu halten.
Das kommt eben vom Basteln an Motorrädern: Sie konnten das Spaßhaben nicht davon unterscheiden, die Bedingungen dafür zu schaffen. Spaß zu haben, war die ihnen übertragene Aufgabe, Verpflichtung und Rolle im Leben, und das zu ermöglichen, machte Arbeit nötig, bisweilen sogar von ihrer Seite. Meine Arbeit, da unterschied sie sich nicht von ihrer Motorradwerkelei, trug zu ihrem Vergnügen bei. Sie machten keinen emotionalen Unterschied zwischen dem Auftrag an mich, von einer Lieferung «organischer» Zwergpalmen Blatt für messerscharfes Blatt Fungizidrückstände abzuwaschen, und der Vernichtung eines Sixpacks in Vorbereitung auf ein Rennen. Beide waren zu ihrem Vergnügen notwendige Schritte.
Ich aß jeden Krümel, der mir vorgesetzt wurde. Es war niemals zu viel. Wir hatten zwei mit Bier beladene Kühlschränke, aber keinen funktionierenden Backofen im Haus. Bei dem, den meine Mutter benutzt hatte, hatte ein Fettbrand die Elektronik beschädigt, und wir nahmen ihn nun, um Brot nagersicher aufzubewahren. Die Erwachsenen lebten von Gourmet-Rindfleisch, das vom Laster fiel. Axel und ich teilten uns auf Propangas erhitztes Dosenfutter. Bei richtigem Timing konnten wir uns die Mesquite-Holzkohle der Erwachsenen zunutze machen, um direkt aus der Dose zu essen wie Cowboys – SpaghettiOs, Corned Beef, gebackene Bohnen, Bohnenmus, Spam. Ich lernte, Kartoffeln, TK-Burritos und -Pizzas et cetera in Folie zu wickeln und sie in die Glut zu legen.
Aber entweder waren die Dosen kleiner als in Dougs Kindheit (er kaufte ein), oder Axel hatte größeren Hunger, als Doug je gehabt hatte, denn aus mir wurde ein mageres, langbeiniges Kind mit Gliedern wie Stöcke, das die Reste von den Tellern aß, bevor es sich ans Spülen machte.
Ich erledigte so viele Hausaufgaben wie möglich in den Minuten zwischen meiner morgendlichen Ankunft in der Schule und dem Glockenton, und meine Noten waren okay. Ich verschlang die kostenlosen Schulmahlzeiten, während ich in meinen Lehrbüchern las. Lehrer versuchten, mich für außerschulische Aktivitäten zu interessieren, aber ich musste jeden Nachmittag zu Hause sein, um bis zum Einbruch der Dunkelheit in der Baumschule zu helfen.
Mit jedem Tag der heranrückenden Pubertät und des damit einhergehenden gesteigerten Ich-Bewusstseins wurde ich unglücklicher. Ich weinte im Bett aus Angst vor wiederkehrenden Albträumen, in denen ich, immer in banalen Situationen, meine Mutter sterben sah. Sie brach auf dem Boden einer öffentlichen Toilette zusammen oder erstickte an einer Walnuss. Um diesen Träumen etwas entgegenzusetzen, fantasierte ich mir einen Garten Eden voller Blumen zusammen und freundliche Kidnapper, die mich in einen Bettvorleger wickelten und in einem Standard-Schiffscontainer dorthin brachten.
Das waren keine erotischen Fantasien. Ihr Wesenskern war die Flucht.
In den Stunden, die dem Weinen und den Fantasien vorausgingen, las ich noch einmal die Fantasyromane meiner Mutter, identifizierte mich manchmal mit tapferen Helden und Prinzessinnen, häufiger mit dienstbaren Tieren wie etwa Tarans Pferd Melynlas – obwohl ich noch zu jung war, um mir Zwang dadurch schönzureden, ich würde meine treuen Dienste freiwillig leisten –, aber meistens mit ganzen, von vorrückender Dunkelheit bedrohten Königreichen. Ich identifizierte mich mit der Welt. Die Hauptfigur in all diesen Büchern ist die in Not geratene Welt, und die war ich.
Als die Betreuungslehrerin mich in der fünften Klasse zögernd fragte, ob ich daran dächte, mir etwas anzutun (meine Arme und Beine waren ständig zerkratzt von der Arbeit), dachte ich: verrückte Frage, warum ausgerechnet ich, ist sie blind? Ich zog eine Grimasse und sagte: «Nein!» Heute weiß ich, dass die Hendersons einen Ruf hatten, der andere Erwachsene um sie herum wie auf Zehenspitzen gehen ließ. Die Leute schoben die Verantwortung für die Aktionen – stets verkauft als Reaktionen – der Hendersons praktisch jedem anderen, nur nicht ihnen selbst zu und taten meine vergeblichen Versuche, mich zu beschweren, als schuldbewusstes Gejammer ab.
KAPITEL ZWEI
Zwei Jahre nach der Flucht meiner Mutter tauchte ein Kind auf, das gewillt war, mit mir zu sprechen. Ich blieb stehen, um mir das Foto von Camarón de la Isla in seinem Schließfach anzusehen, er sagte, er möge mein Holzfällerhemd, und von da an hingen wir jeden Tag zusammen herum. Nicht, dass einen Freund zu haben gereicht hätte, um mich zu retten. Aber es half.
Er war mir ein Jahr voraus – siebte Klasse, als ich in der sechsten war –, sodass wir uns zunächst nur beim Lunch trafen. Doch als es Sommer wurde, teilten wir so viele Erlebnisse, wie wir konnten, waren eine verschworene Gemeinschaft geworden. Beide entschlossen, einen Zeugen für unser elendes Leben zu haben, obwohl wir, wie unter Kindern üblich, allenfalls beiläufig darüber sprachen.
Er hieß Jay und war ein Paria. Seine Eltern vermakelten Gewerbeimmobilien und arbeiteten rund um die Uhr, um in unregelmäßigen Abständen mit gigantischem Geldregen überschüttet zu werden. Sie hatten ihn als Baby aus Russland adoptiert und ihn in die Obhut eines Kindermädchens gegeben. Nach dem, was er erzählte, waren sie sich nicht mehr sicher, ob die Adoption eine gute Idee gewesen war. Aber sein Wechselbalgstatus bot ihm einen entscheidenden Vorteil: Er stand unter viel geringerem Druck, wie sein Vater zu werden, als der typische einzige männliche Erbe.
Als er zum ersten Mal zu mir nach Hause kam, ungefähr fünf Monate nach Beginn unserer Freundschaft, erkannten die Hendersons und die Arbeiter postwendend, dass er schwul war. In der Schule hatte er bei seinen Eltern lange erbettelte Flamencoschuhe getragen, und die Rabauken hatten sie in einen Gully geworfen. Er gehörte zu der Sorte von Hänflingen, die zur Selbstverteidigung lieber ein Skateboard dabeihaben sollten, statt auf schiefen Sechs-Zentimeter-Absätzen herumzuwackeln. Die vage zentralasiatischen Wangenknochen und ätherisch feines kastanienbraunes Haar verstärkten nur den verträumten Look, der Rabauken anzog wie Limonade die Fliegen.
Seine Eltern hatten mehr als genug Geld, um ihm neue alberne Schuhe zu kaufen. Sie waren so liberal und tolerant, dass sie ihn sogar in die öffentliche Schule schickten, damit er den Plebs kennenlernte. Die Schuhe hatten sie ihm zunächst nur in der Hoffnung verweigert, ihn vor sich selbst bewahren zu können.
Aber er wollte keine soziale Anerkennung. Er wollte anders sein, nicht weil er hoffte, damit in der Mittelstufe durchzukommen – so dumm war er nicht –, sondern weil ihn eine unausgereifte pubertäre Sehnsucht antrieb, durch öffentlich ausgestelltes Leiden eine Intervention von außen anzuregen. Die Schuhe kamen einer Selbstverletzung gleich.
Trotzdem glaubte er, seiner Nanny Mrs Imai und den Hausbediensteten nicht auf Strümpfen gegenübertreten zu können, deshalb begleitete er mich an diesem Tag nach Hause, um sich irgendwelche Schuhe von mir auszuleihen.
Ich befand mich im Wachstum, und alle meine Schuhe waren selbst mir zu klein, deshalb lieh ich ihm ein Paar Plastik-Zoris. Dann musste ich arbeiten. Er half mir, die braunen Stellen von einer Bestellung wurzelloser Baumfarne abzuschneiden, die an eine Indoor-Mall ausgeliefert werden sollte. Irgendein Roger, der auf einem Stapler einen Tank voll Flüssigdünger transportierte, drosselte den Motor und sagte freundlich: «Wer ist die Drama-Queen da?»
Jay gab zurück: «Ich bin keine Drama-Queen!»
Der andere rief: «Jetzt komm schon, Bran! Sag’s uns! Wer ist die Drama-Queen, Bran?» Er legte den Gang wieder ein und war bald außer Hörweite. Bran ist die Abkürzung für Brandy.
«Du bist keine Drama-Queen», sagte ich. «Du bist der einzige normale Mensch, den ich kenne.» Ich musste erst sechzehn werden, bevor mir aufging, dass er mich niemals heiraten würde.
Zweimal die Woche fuhr Mrs Imai Jay zu einem Studio in Venice Beach für private Tanzstunden bei einer alten Hippie-Lady namens Loretta, die ihr halbes Leben in Sevilla verbracht hatte. Sie durfte legal mit einer Teleskopbrille Auto fahren, die ein Auge um 25 Dioptrien korrigierte. Hinterher fuhr sie ihn erst in eine Eisdiele und dann nach Hause, aber nur so lange, bis er seinen Eltern erzählte, dass sie blind war. Danach wartete immer Mrs Imai auf ihn.
Ich lernte viel von Loretta, obwohl ich sie nur ein paarmal getroffen habe. Die korrekte Haltung beim Flamenco ist die sentada, ein Quasi-Sitzen im Stehen; die Ellbogen sind der höchste Punkt der Arme, die Füße so schwer wie die Hände leicht. Sie tanzte mit einem merkwürdigen Glamour und begrenztem Bewegungsrepertoire, in roten Leotards, die ihre Rippen hervorstehen ließen, und langen Rüschenkleidern, die ihre Beine verbargen, das weiße Haar mit Klammern zu einer Krone aufgetürmt und überragt von einem Kamm. Die Röcke waren rot oder schwarz mit großen weißen oder roten Punkten drauf. Sie trug Stilettos mit Fesselriemchen. Grandma Tessa hat mir mal erzählt, dass Huren die aus Sicherheitsgründen trugen, nicht mal ins Bett gingen sie barfuß, während respektable Frauen in Pumps herumlaufen, die sie jederzeit sorglos und befreit von den Füßen schlenkern können. Aber mir war auch schon ohne diese Erklärung klar, dass es bei Tanz-Outfits gerade darum ging, im Stehen verachtenswert auszusehen und den Respekt allein durchs Tanzen einzufordern. Kostüme waren ein altehrwürdiges Mittel, Menschen zum Performen zu zwingen, damit es auch vor der Erfindung des Fernsehens schon was zum Anschauen gab.
Jay war ein extrem unbegabter Tänzer. Es ist schwer, als Freundin zu beschreiben, wie er beim Tanzen aussah. Stellen Sie sich einen Pädophilen vor, der nebenbei Hundewelpen umbringt, aber gewillt ist, gegen Sex mit Jay ein paar zu verschonen. Jay vernimmt das Angebot, während er den Verkehr regelt. Die Drohung lässt ihn zurücktaumeln wie von einem Windstoß, über sein Gesicht zucken Gefühle, die Absätze stampfen im Rhythmus eines Wutausbruchs, während er mit dem Schicksal feilscht. Er umkreist es verführerisch, vermittelt Verletzlichkeit, Schwäche sowie die unmissverständliche Botschaft: «Lass mich erst mal Kacki machen.» Also, ohne Witz, so entsetzlich war das. Der Flamenco riss der kontrollierten Routine seiner Schuljungenexistenz die Maske ab, und was er dabei freilegte, war nicht gut. Oder doch gut, weil es ein authentischer Teil von Jay war, bloß zur Entblößung nicht geeigneter als seine Gallenblase oder sein Hypothalamus. Nur indem ich die Augen fest zukniff, konnte ich die kritische Stimme der vorrückenden Dunkelheit, in der wir nach Erlösung suchen und die auch meine Stimme war, zum Schweigen bringen.
Gegen Ende von Jays achtem Schuljahr lag es auf der Hand, dass er mich in Richtung Highschool verlassen würde. Ich bestand darauf, die achte Klasse zu überspringen, damit wir zusammenbleiben konnten.
Unbürokratisch, wie er von Natur, Tradition, Gewohnheit und Ansehen aus war, stattete Grandpa Larry dem Büro des Schulleiters einen Besuch ab und schrieb mich in die Abschlussklasse von 2012 ein. Wenn Schule Zeitverschwendung war, konnte ich sie auch fix zu Ende bringen – so der Hintergedanke. Was die Schule davon hielt, kümmerte keinen, nicht mal die Schule selbst.
An der West High fielen Jay und ich plötzlich nicht mehr auf. Der Konformitätsdruck nimmt in der Adoleszenz zu, während die individuellen Fähigkeiten verkümmern. Die Sozialphobie wird zur Norm. Um herauszustechen, reichte es schon, dass man weder Japaner noch Koreaner war. Wir fanden Freunde. Genauer gesagt, mein angebeteter Jay verliebte sich umgehend in einen hübschen, superstraighten Jungen namens Henry. In den chaotischen Anfangswochen der neunten Klasse stellte sich heraus, dass es gar keine dermaßen unüberwindliche Herausforderung war, mit ihm über die soziale Kluft hinweg in Kontakt zu kommen, die uns, wie wir glaubten, trennte. Als uns aufging, dass wir alle gleich unberührbar waren, werkelten wir längst für das von ihm geleitete Literaturmagazin der Schule.
Henry wurde schnell braun und hatte krauses Haar, das sich im Sommer rötlich verfärbte. Seine Vorfahren waren als Okies aus der Dust Bowl geflohen und hatten es zu einem eigenen Wohnmobilhandel gebracht; sein Ehrgeiz tendierte also zum Geschäftlichen. Es wurde offen darüber spekuliert, wohin sie eigentlich «gehörten». Sein großer Bruder hatte mal einen DNA-Test gemacht, bei dem herausgekommen war, dass sie teilweise aus Nordafrika stammten, aber es bestand keine Einigkeit darüber, ob ihn das schon zu einem Afroamerikaner werden ließ. Er selbst jedenfalls fand das. Er sah auf kantige, muskulöse Weise gut aus, war ein exzellenter Schüler, spielte Trompete und schwamm Schmetterling. Als Expfadfinder leistete er Freiwilligenarbeit beim Roten Kreuz. Trotzdem galt er als Außenseiter, qualifiziert für Freundschaften mit Kandidaten wie Jay und mir, weil er mit Fifi zusammen war. Die beiden waren schon derart lange liiert – eine händchenhaltende Kindheitsromanze, die so früh zu einer sexuellen Beziehung geworden war, dass es noch gegen das Gesetz verstieß –, dass sie auftraten wie ein altes Pärchen, samt Rollenspiel und Zankereien, um die Sache aufzupeppen. Sie führten lautstarke Auseinandersetzungen, sogar in der Schule. Ihre Reife machte die Lehrkräfte nervös.
Fifis Mutter war eine japanischstämmige CAD-Zeichnerin, ihr Vater ein schwarzer Zahnarzt aus Atlanta. Sie hatte ein dunkles Asiatinnengesicht und gewelltes Haar, und sie liebte alles Flauschige, Cord, Velours, Chenille und grellfarbige Acrylstrumpfhosen unter Röcken – will sagen, sie kleidete sich wie ein Kleinkind und fiel auf, wo auch immer sie hinging. Alles an ihr war rund, von den überrascht dreinblickenden Augen (sie weit aufzureißen, war ihre Reaktion auf anderer Leute unmögliches Benehmen, und sie tat es oft) bis zu ihren winzigen Füßen. Ihr Elternhaus war japanisch eingerichtet, und die Sommerferien verbrachte man in Japan, aber nur als Touristen, weil die dortige Verwandtschaft vor der Geburt von Fifis großem Bruder den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen hatte. Der Bruder betrachtete sich als Japaner. Er wollte den Mädchennamen der Mutter annehmen und die verstreute Familie aussöhnen. Womöglich war das eine geläufige, geschwisterrivalitätsbedingte Arbeitsteilung, aber seine Brückenbaumanie – dass er seine Mutter zwang, Japanisch mit ihm zu sprechen, und die japanischen Kids in der Schule, ihn zu akzeptieren, et cetera, als könnte eine Brücke einen Abgrund zuschütten – erzeugte Peinlichkeiten ohne Ende. Fifi distanzierte sich früh von solchen Szenen, was zu einer haarsträubenden generellen Konfliktintoleranz geführt hatte.
Sie fühlte sich ihrer Verwandtschaft in Atlanta zugehörig. In ihrer Selbsteinschätzung war sie eine Schwarze aus Georgia, entspannt, höflich und pragmatisch, und wehe denen, die es wagten, anders zu sein. Der Konsens an der Schule war: «So eine Bitch.»
Sie lernte wie der Teufel, um perfekte Noten und Testergebnisse zu erzielen, weil sie die Karriere ihres Vaters noch toppen wollte, indem sie eine schwarze Kieferorthopädin mit milliardenschweren Patienten wurde. Nach der Schule jobbte sie in seiner Praxis und fand keine Zeit für Philanthropie oder Sport. Henry hatte vor, an die UCLA zu gehen, und sie hatte vor mitzukommen. Um sich ihre Zulassung zu sichern, brauchte sie dringend eine außerschulische Aktivität.