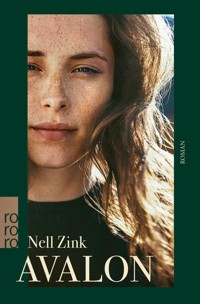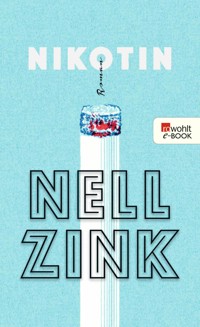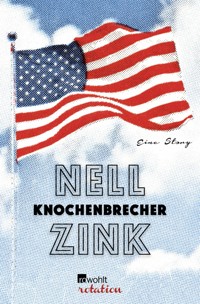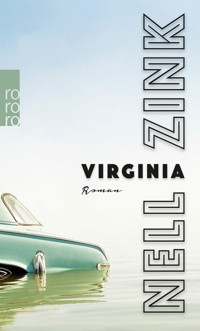
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Peggy fühlt sich früh zu Frauen hingezogen, Lee ist der schwule Spross einer konservativen WASP-Familie. Zu beider Überraschung fangen sie etwas miteinander an. Das Ergebnis sind Heirat, ein Sohn, Byrdie, und eine Tochter, Mickie. Nach zehn Jahren ist die Ehe gescheitert an Sprachlosigkeit und den verklemmten frühen Sechzigern. Peggy brennt mit Mickie durch, für die sie sich die Papiere eines toten schwarzen Mädchens erschwindelt. Als "Schwarze" leben Mutter und Tochter fortan unerkannt in einem kleinen Ort in Virginia. Und lernen eine ganz neue Welt kennen … Nell Zink nimmt in dieser temporeichen dunklen Komödie scharfzüngig die fundamentalen Widersprüche in der amerikanischen Gesellschaft aufs Korn: Rasse, Klasse, sexuelle Orientierung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nell Zink
Virginia
Roman
Über dieses Buch
Peggy Vallaincourt fühlt sich früh zu Frauen hingezogen, Lee Fleming ist der schwule Spross einer konservativen WASP-Familie. Sie besucht das Frauencollege, an dem er als Lyrikdozent lehrt, und zu beider Überraschung fangen sie etwas miteinander an. Das Ergebnis sind Heirat, ein Sohn, Byrdie, und eine Tochter, Mickie. Nach zehn Jahren ist die Ehe gescheitert an Sprachlosigkeit und den verklemmten frühen Sechzigern. Peggy brennt durch und will beide Kinder mitnehmen, am Ende hat sie aber nur Mickie dabei, für die sie sich die Papiere eines toten schwarzen Mädchens erschwindelt. Fortan gilt die hellblonde Tochter als schwarz – falscher Ausweis genügt. Und als «Schwarze» leben Mutter und Tochter nun unerkannt in dem kleinen Ort in Virginia, wo sie sich in einem leerstehenden Haus Nachfragen nach ihrem Verbleib entziehen. Und lernen eine ganz neue Welt kennen …
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg bei Reinbek
«Mislaid» Copyright © 2015 by Nell Zink
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München,
nach der Originalausgabe von Harper Collins Publishers
Coverabbildung Sean Murphy/Getty Images
ISBN 978-3-644-55581-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Mein Leben wäre mühsamer
ohne das großartige Kollektiv von
Zeitenspiegel Reportagen,
dessen Mitarbeitern und Unterstützern
ich dankbar dieses Buch widme.
... in des lauten Pöbels Menge
Des Löwen Glut in Asche sinkt –
Er kuscht vor seines Wärters Streich –
Die Wüsten aber sind sein Reich,
Wo Größe und Gewalt und Schrecken
Mit ihrem Hauch sein Feuer wecken.
E.A. Poe, «Tamerlan»
EINS
Das Stillwater College befand sich an der Fall Line südlich von Petersburg. Die eine Hälfte des Campus lag höher als die andere, und die oberen Wasser waren von den unteren durch einen steinigen Streifen Land geschieden. Die unteren Wasser standen still, die oberen flossen hinab. Sie versickerten im sandigen Boden, bevor sie zum Bach werden konnten. Und so war das College zu seinem Namen Stillwater gekommen. Es blickte auf einen See, der so reglos dalag, als wäre er mit Schaufeln ausgehoben und von Hand mit Lehm ausgekleidet worden. Aber der See war schon seit Menschengedenken da gewesen. Es gab keinen sichtbaren Ablauf und keine Stege, denn Pfähle hätten womöglich die Lehmschicht durchlöchert. Wegen der Blutegel im Schlick schwamm niemand im See. Und niemand angelte, denn Mädchen angeln nicht.
Früher hatte das Haus zu einer Plantage gehört. Nach dem «Krieg zwischen den Staaten» war eine Mädchenschule daraus geworden, danach ein Lehrerseminar und während der 1930er ein Frauencollege. In den 1960ern wurde Stillwater ein Mekka für Lesben; Mädchen in Shorts standen rauchend im Schilf, ließen kleine schwarze Blutegel zwischen den Fingern platzen und riskierten den Schulverweis wegen Rauchens und Stehens im See.
Die Straße, die vom Highway heraufführte, gabelte und verzweigte sich wie ein Blitz. Man musste wissen, wo Stillwater lag, um es zu finden. Fremde fuhren bis zum Städtchen Stillwater, parkten dort und liefen dann los. Sie dachten, in einer so kleinen Stadt könnten sie das College gar nicht verfehlen. Aber die Menschen in Stillwater meinten, man hätte im College nichts verloren, wenn man nicht wusste, wo es zu finden war. Das ganze County war alkoholfrei und im Übrigen so überschaubar, dass die meisten Geschäfte keine Schilder trugen. Selbst wenn man also einen Haarschnitt wollte, oder gar einen Drink, musste man wissen, wohin. Das größte Schild in der Gegend gehörte zu dem Farbigen-Imbiss draußen am Highway, dem «Bunny Burger». Das Hinweisschild «Stillwater College» war kurz vor dem letzten Abzweig an einen Zaun genagelt; von dort aus konnte man die Nebengebäude schon sehen.
Das Haupthaus ging auf den See hinaus. Die Studiengebäude und das Studentenwohnheim waren hinter dem Haupthaus um einen Platz gruppiert. Alle Mädchen wohnten auf dem Campus. Vom Rundweg zweigten in alle Richtungen ungeteerte Sträßchen ab und führten zu den Unterkünften der Lehrer, wo unter großen Eichen Kombis schief in Schlaglöchern standen.
Ein berühmter Dichter war der Grund, warum Fremde nach Stillwater kamen. Er arbeitete dort als Englischprofessor und war so angesehen, dass andere berühmte Dichter den Weg nach Stillwater auf sich nahmen, um seine Vorlesungen zu hören. Tommy, Klugscheißer und Besitzer des Weißen-Imbisses in der Stadt, nannte sie die «internationale Schwuchtelei» und fragte jedes Mal, ob sie Mayonnaise in den Kaffee wollten.
Peggy Vaillaincourt war ein Einzelkind und wurde 1948 in der Nähe von Port Royal, nördlich von Richmond, geboren. Ihre Eltern waren wohlhabend, lebten aber bescheiden und widmeten ihr Leben der Gemeinde. Peggys Vater war episkopaler Priester und Seelsorger eines Mädcheninternats. Ihre Mutter war seine Frau – ein anspruchsvoller Fulltimejob. Es war die Zeit vor Psychologen und Therapien, und wenn ein Mädchen keinen Appetit mehr hatte oder eine Frau Schuld wegen einer Ausschabung empfand, kam sie zu Mrs. Vaillaincourt, die sich infolgedessen wichtig fühlte. Hochwürden Vaillaincourt fühlte sich immer wichtig, denn er entstammte einer Familie, die dem Lincoln-Mörder John Wilkes Booth Unterschlupf gewährt hatte.
Die Vaillaincourts wohnten in einem hübschen Backsteinhaus auf dem Schulgelände. Um einen Interessenkonflikt zu vermeiden, ging Peggy auf die öffentliche, weiße Schule. Ihre Mutter hatte Bryn Mawr besucht und hätte Peggy gern auf ein besseres College geschickt. «Wie wäre es mit einem etwas intellektuelleren?», fragte sie Peggy. «Zum Beispiel Wellesley?» Aber Peggy wollte nach Stillwater.
Und das kam so: Miss Miller, ihre Turnlehrerin, hatte etwas über ihren Turnanzug gesagt, und Peggy hatte begriffen, dass sie eigentlich ein Mann hatte werden sollen. Turnanzüge waren blau und schlabbrig, aber je älter man wurde, desto weniger schlabbrig waren sie und schnitten einem in den Schritt, auf eine Art, die irgendetwas andeutete, aber sie wusste nicht, was. Miss Miller hatte vor ihr gestanden, am Unterteil ihres Anzugs gezupft und es ein Stück nach unten gezogen. Sie legte die großen Hände auf Peggys Taille und sagte etwas wie, der Anzug habe ihr noch nie richtig gepasst und werde es auch nie tun.
Peggy hatte ein Faible für Miss Miller, seit sie in der dritten Klasse hingefallen war und sich einen Zahn ausgeschlagen hatte. Miss Miller hatte sie zu den Toiletten gezogen, um ihr das Blut vom Mund zu waschen, und der Zahn wurde in den Ausguss gespült. «Da verschwinden fünf Cent von der Zahnfee», hatte Peggy gesagt. Miss Miller griff in ihre Tasche und förderte einen Vierteldollar zutage. So viel Geld auf einmal hatte sie noch nie von einem Erwachsenen bekommen. Diese Szene hatte sich der kleinen Peggy unauslöschlich eingeprägt. Sie bekam neun Cent Taschengeld – einen Nickel und fünf Pennys, von denen sie einen in den Klingelbeutel legen musste.
Die Einsicht, dass ihre Mädchenjahre ein Irrtum gewesen waren, veränderte ihr Leben nicht sofort. Sie konnte immer noch reiten, Tennis spielen, mit den Pfadfinderinnen zelten gehen, Sonnenbarsche angeln und mit einem Luftgewehr auf Schildkröten schießen.
Aber so mit vierzehn wurde es etwas komplizierter. Sie teilte ihrer besten Freundin Debbie mit, dass sie nach der Highschool zur Army gehen wollte. Sie kannte Debbie aus dem Pfadfinderinnen-Zeltlager. Debbie kam aus Richmond, einer großen und vielseitigen Stadt. «Du bist eine Thespe», sagte Debbie. «Bleib mir vom Hals.» Debbie nahm ihre Decke und zog auf die andere Seite des Zimmers um. Von da an veränderte sich Peggys Leben. Debbie hatte ihr das Zungenküssen beigebracht und anzügliche Tänze wie den Watusi, Wissen, das sie für die gemeinsamen Abenteuer der Debütantinnenbälle rüsten sollte. Und nun dies. Verrat. Debbie sprach nie wieder mit ihr. Peggy erzählte ihrer Mutter davon.
«Eine Thespe», sagte ihre Mutter irritiert. «Na ja, Schatz, jeder verguckt sich mal.» In ihrer Generation glaubte man noch, die erste Liebe eines Mädchens sei immer ein etwas burschikoses älteres Mädchen. Sie gab Peggy Cress Delahanty zu lesen. Das war kontraproduktiv. «Du gehst unter keinen Umständen zur Army, auf gar keinen Fall. Verstehst du mich? Du gehst aufs College. Schlag es dir aus dem Kopf. Du wirst dich irgendwann selbst auslachen.» Ihre Mutter argwöhnte, dass sie bereits eine feste Freundin hatte, und besorgte Broschüren über eine frühe Zulassung am Radcliffe. Sie glaubte zwar nicht an Koedukation, aber die Not ihrer Tochter erforderte verzweifelte Maßnahmen.
Doch Peggy hatte keine Freundin. Einmal nahm sie eine Einladung von Miss Miller zu einem Grillfest im State Park an. Es waren nur Frauen dort und keine anderen Mädchen. Sie erkannte die Frau wieder, von der alle sagten, sie sei «der» Hausmeister an der Grundschule. Es war indirekt Miss Millers Schuld, dass Peggy unter beruflicher Tätigkeit etwas Männliches verstand. Die Frauen spielten Softball und nahmen das Spiel sehr ernst, schlugen den Ball so hart, dass Verletzungsgefahr bestand. Peggy verließ die Party, um mit den Kindern der Baptistengemeinde Hufeisenwerfen zu spielen und mit ihnen im Bus nach Hause zu fahren.
Sie fing an, den Thespisjüngern an der Schule mehr Beachtung zu schenken. Es waren dicke Mädchen und nette Jungs mit Halstuch unterm Hemdkragen. Peggy sprach für eine Rolle in Unsere kleine Stadt vor und bekam sie nicht. Danach ging die Theater-AG auf ein paar Milchshakes in den Drugstore, und der Regisseur, ein Oberstufenschüler, erklärte ihr, was es mit Lesben auf sich hatte. Er kicherte und schüttelte dauernd den Kopf. Die anderen lachten so laut, dass Peggy sich ungeachtet des Themas unauffällig vorkam. Der Regisseur aber flüsterte nur: «Du und deine Freundin Miss Miller, ihr seid doch Kampflesben. Du solltest nach Washington gehen, da gibt es Lesbenbars. Oder aufs Stillwater College.»
«Miss Miller ist nicht meine Freundin!»
Anschließend erfuhr Peggys Mutter davon, und Miss Miller und die Hausmeisterin wurden gefeuert und zogen weg. Peggy bestand darauf, dass Miss Miller nie etwas Ungehöriges getan hatte. Es war ihre eigene Idee gewesen, ein Mann und Thespisjünger zu werden. Ihre Mutter sagte: «Da hast du dir aber ein ziemlich kompliziertes Leben ausgesucht.» Dann gingen sie Schnittmuster kaufen, denn Peggys Debüt stand bevor, und ob nun lesbisch oder nicht, dafür brauchte man ein dreiviertellanges, schulterfreies Kleid aus fester Baumwolle mit aufgedruckten Blumen und Tüllunterrock. Abgeschnittene Latzhosen waren in Ordnung für die Schildkrötenjagd im Wald, aber beim Debütantinnenball wollte Peggy hübsch sein. Am Ende war sie so schön, dass es ihr den Atem verschlug. Sie stand in Slip und Seidenstrümpfen vor dem Ganzkörperspiegel im Ankleideraum für Frauen des Jefferson Hotels und verspürte ein fast überwältigendes Verlangen zu masturbieren. Sie erklärte sich selbst zum schönsten Mädchen, das sie je gesehen hatte. «I feel pretty, oh so pretty», sang sie stattdessen und wirbelte mit ihrem Kleid im Arm im Kreis herum, als wäre es ein Mädchen. Pinocchia, deren Wunsch erhört wurde. Jemand, den sie lieben konnte. Dann machte sie ihren Abschluss und verschwand Richtung Stillwater.
Zum Studienanfang ließ sie sich die Haare kurz schneiden und fing an, Zigarillos zu rauchen. In einem Army-Laden hatte sie sich neu eingekleidet. Sie stellte die Gleichung aus der Kindheit, Mädchen zu mögen bedeute ein Mann zu sein, nicht in Frage, und in schwarzen Chinos und schwarzem Rundhalspullover fand sie sich hart, smart und einschüchternd. Sie sah bezaubernd aus. Der Kurzhaarschnitt ließ ihre Locken zu einer Krone weicher Löckchen werden. Sie fand ihre schmalen Hüften und die flache Brust jungenhaft, aber 1965 war das schick.
Doch so gern sie ein Mann sein wollte, so abstoßend fand sie Behaarung, dicke Bäuche, Rülpser, Obszönitäten und so weiter. Ihr schlanker Vater trug Ascots und ließ sich maniküren. Sein Gesicht war weich, und die Manschetten seiner Hemden hatten Monogramme. Sie hielt schwarze Pennyloafer und weiße Socken à la Gene Kelly für den Inbegriff einer Butch aus der Arbeiterklasse.
Der Campus war ein Universum für sich. Man musste ihn nie verlassen. Freunde und Freundinnen anderer Schulen kamen zu Besuch, es gab Kennenlernpartys, Sportwettkämpfe mit anderen Colleges, eine Kantine, einen Laden mit Verpflegung und sogar einen Getränkespender. So autonom wie eine Militärbasis. Aber ohne Grundausbildung. Kein Putzen, kein Kochen. Die Arbeit bestand zum Beispiel darin, sich Gedanken über Edna St. Vincent Millay zu machen. Wenn man das vermasselte, dann wurde man nicht kritisiert. Man wurde in ein Büro gebeten, bekam einen Sherry angeboten und wurde gefragt, was verkehrt lief.
Ich glaub es einfach nicht, dachte Peggy. Meine Eltern bezahlen dafür, dass ich das vier Jahre lang mache. Wenn man Französisch als Hauptfach wählte, konnte man das dritte Jahr an der Sorbonne verbringen. Aber die Studenten, die danach zurückkamen, wirkten verloren. Neue Cliquen hatten sich ohne sie gefunden, und ihre französischen Freunde kamen sie nie besuchen. Peggy wählte stattdessen Spanisch. Sie beschloss, einen Abschluss in Creative Writing zu machen. Sie wollte Theaterstücke für ihre thespischen Kollegen schreiben.
Peggys Mitbewohnerin kam aus Newport News, ihr Vater diente in Vietnam. Sie war an einen strikten Tagesablauf gewöhnt. Sie gehorchte Peggy aufs Wort. Wenn Peggy sagte: «Dein Wecker klingelt zu früh», dann stellte sie den Wecker auf eine Stunde später. Wenn Peggy sagte: «Dein Pyjama gefällt mir», dann bügelte das Mädchen ihn und trug ihn das ganze Wochenende. Das alles machte sie nicht gerade fürchterlich interessant. Peggy fühlte sich zu einer im zweiten Studienjahr aus Winchester hingezogen, die ihr Pferd in einem Stall oben in den Hügeln untergebracht hatte. Dieses Mädchen trug meistens beige Reithosen und Stiefeletten und aß jeden Morgen zum Frühstück ein Eis, das der Koch für sie im Tiefkühler aufbewahrte. Weil ihr wertvolles Pferd jeden Nachmittag geritten werden musste, war ihr erlaubt worden, ein Auto zu haben. Höhere Semester durften Autos besitzen, aber nur, wenn sie unter den Jahrgangsbesten waren und keine Strafpunkte hatten. Da aber Strafpunkte unter den höheren Semestern Ehrensache waren, war Emily aus dem zweiten Jahr zurzeit die einzige Studentin, die ein Auto fahren durfte. Sie wollte einen Abschluss in Kunstgeschichte machen und dann in das Im- und Export-Geschäft ihres Vaters einsteigen.
Peggy starrte sie so lange lächelnd an, bis sie auf den Beifahrersitz des Chrysler New Yorker eingeladen wurde, der hinter der ehemaligen Milchscheune parkte. Emily redete über ihr Pferd. Peggy, die sich, die Hände im Schoß, Emily zugewandt hatte, bemüht, gleichermaßen konzentriert und anziehend zu wirken, merkte, wie es in ihr rumorte. Sie dachte, dass sie noch nie in ihrem Leben außerhalb einer Kirche etwas so Langweiliges gehört hatte, nicht mal vom Hörensagen. Peggy erwähnte einen Kurs, den sie beide besuchten. Sie erwähnte die Stadt, in der sie aufgewachsen war. Sie erwähnte einen Film, den sie kürzlich gesehen hatte, und wollte wissen, ob Emily ihn auch gesehen hatte. Schließlich sagte sie: «Ich bin eigentlich nicht mit dir hier rausgekommen, um über Reitturniere zu reden.»
Das war ein Fehler. Emily starrte auf die Windschutzscheibe und sagte: «Dann bist du dumm, denn du magst mich, und ich möchte eben über Reitturniere reden.»
Peggy stieg aus dem Wagen und ging zu den Bäumen. Sie hörte die Tür zuschlagen und sah Emily samt Auto um die Ecke der Scheune verschwinden. Die Buchen wurden langsam gelb, und der wilde Wein war schon rot wie ein Feuerwehrauto. Peggy tröstete sich mit beidem, was, wie sie glaubte, auch ein empfindsamerer Mensch getan hätte.
Der berühmte Dichter des Colleges hieß Lee Fleming. Er war ein junger Mann aus der Gegend, der seiner Familie in der Jugend viel Ärger gemacht hatte. Nach dem Internat schickten sie ihn auf ein weit entferntes College in New York. Als sie hörten, was er dort so trieb, stellten sie ihm ein Ultimatum: Hör auf, den Familiennamen in den Schmutz zu ziehen, oder du siehst keinen Cent mehr.
Bis dahin war Lee sich gar nicht bewusst gewesen, dass es von Vorteil war, ein Fleming zu sein. Sprich, ihm war nie aufgegangen, dass er selber gar kein Geld hatte.
Seine Eltern waren reich. Er hatte Aussichten und Taschengeld, sonst nichts. Sein Vater legte ihm nahe, an einen entlegenen Ort zu ziehen. Auf vor Zutritt geschütztem Eigentum kann man schwul wie ein Rudel Friseure sein. Lees Vater war Pessimist. Er stellte sich muskelbepackte Hilfsarbeiter vor, die mit Lee schlimme Sachen machten, und er wollte nicht, dass Passanten die Schreie hörten. Er bot ihm das Haus auf der anderen Seite des Stillwater Lake an, gegenüber vom College.
Es handelte sich um ein viktorianisches Holzhaus, das Lees Großvater während der Weltwirtschaftskrise praktisch geschenkt bekommen hatte. Es war an seinem ursprünglichen Standort zerlegt und auf einem Backsteinfundament wieder errichtet worden, sodass es jetzt auf den See hinausging. Eigentlich sollte es ein Sommerhaus sein. Aber es war schwer zu erreichen, lag weitab von jeder Stadt, es wimmelte dort von Bremsen, und statt eines Bootshauses gab es ein Bambusdickicht. Also wurde das Haus nie genutzt. Es stand da einfach auf Fleming-Land und nahm Platz weg. Selbst als die Zeit kam, Holz einzuschlagen, um es im Zuge der Kriegsanstrengungen zu verkaufen, konnte Mr. Fleming sich nicht dazu durchringen, es abzureißen. Umgeben von Ahorn und Tulpenbäumen, sah das Haus so hübsch aus. Der Trampelpfad zum Wasser schlängelte sich durch anzügliche Sprösslinge von altem Bambus mit dem Durchmesser einer Getränkedose.
Lee war nicht der Mann, für den seine Familie ihn hielt. Als Liebhaber war er ein treuer Romantiker, dessen Gefühle immer wieder verletzt wurden. Er war ein Top. Aber er bekam es nie richtig hin. Er mochte ein feines Hemd und eine graue Anzughose tragen, dazu seine Budapester, und darin so mannhaft aussehen wie jeder beliebige Episkopale. Aber dann stellte er sich direkt vor völlig Fremden in Positur, behielt sie fest im Blick und sprach zu ihnen über Poesie. Innerhalb eines Monats nannten ihn alle im County eine Schwuchtel. Aber er war ein Fleming, und er war ein Top. Er war unantastbar. Der örtliche Hexenmeister des Ku-Klux-Klan arbeitete in der Sägemühle seines Vaters. Der Pfingstprediger lebte im Trailer-Park seines Vaters. Der Vorsitzende der Prince-Hall-Freimaurerloge fuhr einen der Müllwagen seines Vaters. Die Bezirksregierung saß in einem Gebäude an einer Kreuzung namens Fleming Courthouse, und die Amoco-Tankstelle hieß Fleming’s American. Niemand neidete ihm öffentlich ein Haus im Wald an einem See, in dem niemand angelte.
Lee meinte es ernst mit der Dichtung. Er glaubte, dass alle für sie wichtigen Dinge in den Sechzigern in Amerika stattfanden. Er war davon überzeugt und konnte es erklären. John Ashbery, Howard Nemerov und sein Favorit: Robert Penn Warren. Dann die Beats. Er hatte sie alle in New York kennengelernt, und sie alle hatten eine Schwäche für attraktive Südstaatler, die Ländereien besaßen.
Zunächst hatte Lee nichts mit dem College zu tun. Aber dann machte ein Freund die Bemerkung, ein Mädchencollege am Ende der Welt klinge doch irgendwie nach Fellini, und er hatte eine Idee. Er schlug dem Fachbereich Englisch vor, Gregory Corso einzuladen.
Selbst aus Richmond kamen Dichter angefahren, um ihn zu hören. Aber die Mädchen blieben cool und abweisend, sogar bei «Marriage», seinem bekanntesten Gedicht, und Corso fuhr zurück und erzählte jedem in New York, Lee lebe in einer Zeitblase, in der das gute alte Frauenbild der Südstaaten noch lebendig sei. Zwei Verleger und ein Romancier schickten daraufhin ihre Töchter nach Stillwater.
Kurz gesagt, das College half Lee, und Lee half dem College. Er sollte eine Vorlesung über Dichtung halten. Die Frage nach dem Gehalt stellte er zunächst nicht. Stattdessen bat er das College, seine Literaturzeitschrift zu finanzieren, die Stillwater Review heißen sollte.
Drei Jahre später wurde die Stillwater Review tausendfach verkauft, und zehn Studentinnen waren damit beschäftigt, die Einsendungen zu prüfen, während Lee pro Semester drei Vorlesungen bestritt: wechselweise englische Dichtung im Herbst und amerikanische Dichtung im Frühjahr, dazu Literaturkritik und einen Schreibworkshop.
Zur Arbeit kam er, ob Regen oder Sonnenschein, mit einem Kanu. Wenn er es vor seinem Haus an Land zog, schloss es die Lücke im Bambus wie ein Gartentor. Studentinnen wurden nie zu ihm ins Haus eingeladen. Es gab Geschichten. John Ashbery, der aus drei Metern Entfernung ein schlafendes Weißwedelkitz schießt. Howard Nemerov, der auf Meskalin Pfefferminzextrakt in die Spaghettisoße mischt. Um überhaupt eine dieser Geschichten zu hören, musste man jemanden von anderswo kennen, der jemanden kannte, der eingeladen worden war – die Cousine vom Sarah Lawrence, deren Liebhaber einen schwulen Bruder hatte. Der See von Stillwater hätte ebenso gut die Berliner Mauer sein können.
Erstsemester waren zu Lee Flemings Schreibworkshop nicht zugelassen. Zunächst musste man seine Vorlesungen hören.
Peggy empfand das als eine lächerliche Einschränkung. «Wie soll ich Dichtung verstehen, wenn ich selbst nie ein Gedicht geschrieben habe?», fragte sie Lee in ihrer dritten Woche in seinem gemütlichen Büro unter dem Dach des Haupthauses.
«Was wollen Sie in meinem Workshop, wenn Sie noch nie ein Gedicht geschrieben haben?»
«Sollen Sie uns das nicht beibringen?»
«Die beiden ersten Stunden haben Sie schon verpasst.»
«Kann ich nicht einfach zuhören?»
«Bei einem Workshop kann man nicht einfach zuhören. Da muss man mitarbeiten.»
«Kann ich mich dann einschreiben?»
«Welchen Dichter bewundern Sie?»
«Anne Sexton.»
Lee lehnte sich zurück. «Anne Sexton? Warum?»
«Sie klingt zwar nicht besonders gut, aber sie hat was zu sagen. Ich habe Hopkins oder Dylan Thomas gelesen und finde, die Jungs klingen zwar cool, aber haben sie was zu sagen?»
«Vielleicht haben sie etwas zu sagen, das Sie nicht verstehen?»
«Dann lassen Sie es mich verstehen.»
«Das ist wie ‹Lassen Sie mich leben lernen›.»
«Dann lassen Sie mich in Ihren Workshop.»
«Nein. Sie glauben, dass es bei Gedichten um Sie gehen muss, dabei haben Sie keine Ahnung, wie man liest. Wenn Sie Milton nicht lesen können, dann können Sie auch Dylan Thomas nicht lesen. Hören Sie sich meine Vorlesung über englische Dichtung an.»
«Damit ich Milton lesen kann? Nein danke.»
«Dann werden Sie nie bei mir studieren.»
«Dann wechsele ich das Hauptfach und mache Französisch.»
«Seien Sie nicht kindisch.»
«Ist es kindisch zu wissen, was man will?»
«Ich will, dass Sie meine Vorlesung besuchen», setzte Lee an und unterbrach sich, weil er merkte, dass er etwas Ungewöhnliches und ein bisschen Peinliches gesagt hatte.
Peggy stand da und starrte ihn an, und er starrte zurück.
Sie bot ihm einen Zigarillo an. Sie setzte sich auf die Schreibtischkante, um ihm Feuer zu geben, beugte sich anmutig vor, die Hände schützend um das Streichholz gelegt, ein lächelndes, siebzehnjähriges Mädchen mit gelocktem Haar wie Bettfedern, und er merkte, dass er einen Steifen hatte.
«Vergessen Sie’s», sagte Peggy. «Ich kann auch ohne Ihre Hilfe Stücke schreiben. Ich brauche nicht mal Anne Sextons Hilfe. Ich scheiße doppelt und dreifach auf sie und Milton.»
«Klingt mir nach einer geborenen Schriftstellerin», sagte er. «Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie in meine Vorlesung über englische Dichtung kämen.»
«Ich meine es ernst. Ich will gar nicht in Ihren Workshop, auch wenn das bedeutet, dass ich Sie nie wiedersehe.»
Er blickte um sich, als müsste er auf die Umgebung hinweisen – den Stillwater-Campus, die ganzen acht Morgen –, und lachte.
Peggy besuchte seine Vorlesung nicht. Eine Woche später nahm sie seine Einladung an und kniete sich in den Bug seines Kanus, während er es mit einem Paddel vom sumpfigen, blutegelverseuchten Ufer abstieß. Als Erstes sagte er: «Das hier ist kein Date.» Dann krabbelte er auf sie zu und zog ihre Hüften an seine, fuhr mit den Händen über ihren Hintern und küsste sie, denn wenn er ehrlich mit sich war (was erst viel später kam), kannte er kein anderes Verhalten im Kanu. Das Kanu schaukelte von einer Seite zur anderen, und Peggy war ganz still und ernst. Es war so erregend, dass er nicht durchblickte. Sie war androgyn wie die Jungen, die er mochte, aber nun fing er an zu überlegen, ob er wirklich Jungs mochte oder nur die falschen Mädchen kennengelernt hatte. Er dachte über ihre Genitalien nach und beschloss, dass es keinen Unterschied machte. Ihr Körper war weiblich, weiblich, weiblich. Was auch immer er berührte, es bog sich fliehend von ihm fort. Er tastete sich zwischen ihren Beinen vor und verschwand im Bodenlosen.
Peggy fühlte sich von Gottes Hand gehalten. Nicht, weil er ein berühmter Dichter war und der angesehenste Lehrer am College, sondern weil er ein Mann war, und dazu ein körperlich kräftiger. In all ihren Phantasien war sie der Mann gewesen, der irgendeine flehende Liebhaberin beglücken musste. Aber jetzt war jemand freiwillig bereit, ihre Wünsche zu bedienen. Das hatte sie nicht erwartet, niemals. Es verletzte ihr Arbeitsethos. Sie verspürte den Wunsch zu sprechen, öffnete die Augen, und der Dichter im schwarzen Regenmantel starrte in sie hinein, während der Wind tobte und sie allseits vom Wasser umschlossen waren. Es war ein ganzes Stück sexyer und romantischer als alles, was sie sich jemals vorzustellen gewagt hatte.
Beide waren verwirrt, aber aus völlig verschiedenen Gründen. Peggy hatte geglaubt, sie würde als Jungfrau sterben, und nie einen Gedanken an Verhütung verschwendet. Und jetzt sah es so aus, als würde sie höchstens noch zehn Minuten Jungfrau sein. «Ich bin Jungfrau», sagte sie.
«Das lässt sich leicht ändern», sagte Lee.
«Nein, im Ernst», sagte sie. «Das hier ist eine große Sache. Versprich es mir.»
«Ich versprech dir alles.» Er küsste sie. «Alles.»
Es verwirrte ihn, dass er dergleichen überhaupt sagte, zu wem auch immer – Mann, Frau, Eunuch, Hermaphrodit, Schaf, Baum. Er sah ihr in die Augen und fand, dass sie nicht richtig zuhörte.
Er brachte das Kanu an Land und trug sie ins Haus.
Peggy war jung und ihre Ausdauer in sexuellen Dingen praktisch grenzenlos. Ihr Sexualtrieb war ziemlich ausgeprägt und außerdem aufgestaut, da sie volle fünf Jahre Mädchen betrachtet und daran gedacht hatte, sie zu vögeln. Und Lee war auch kein Schwächling. Da er nur drei Vorlesungen halten musste und sie dazu neigte, den Unterricht zu schwänzen, hatten sie viel Zeit für seine Sitzecke und das Bett, das an Messingketten von der Decke hing, oder das Fell des bengalischen Tigers. Manchmal redeten sie, und manchmal saß er nur da und tippte, während sie die Bücherregale durchforstete und Genet und Huysmans las. Aber meistens dachte sie an das, woran sie inzwischen die ganze Zeit dachte: Sex mit Lee. Sie empfand neue Gefühle, seelisch und körperlich, neue Qualen und Gelüste, und sie konnte sich keine Notizen machen – das hatte keinen Sinn; es war unmöglich, sie in ein Stück einzuarbeiten, und jemand mochte sie finden und lesen –, aber sie registrierte sie sorgfältig. Als Lesbe hatte sie gelernt, Geheimnisse zu wahren. Sie ging zu Fuß durch den Wald, auch wenn sie zwei Stunden bis zu seinem Haus brauchte. Oder sie wartete an der Straße, bis er mit dem Auto kam. In mondlosen Nächten war es in Stillwater so dunkel wie im Inneren einer Kuh. Wenn er keine Zeit für sie hatte, saß sie auf einer Bank mit Blick auf den See und starrte hinüber auf seinen Bambus.
Lee hatte Peggy alles versprochen, aber vergessen, ihr zu versprechen, sie würde nicht wegen Fraternisierung von der Schule fliegen. Dass Lee mit einer Studentin schlief, war ein Skandal und musste aufhören. Lee war in loco parentis, aber zugleich war er unentbehrlich. Obwohl es so aussah, als hätte Peggy ihre Berufung gefunden. Ständig verließen Studentinnen das College, um zu heiraten. Deshalb gingen sie ja schließlich dorthin – um ihren Abschluss in Form einer guten Partie zu machen. Stillwater war angeblich anders, aber jedes College erwischte eben mal ein schwarzes Schaf. Peggy wurde aufgefordert, nach den Weihnachtsferien nicht wiederzukommen.
Die Diskussionen mit ihrer Mutter waren schwierig. Peggy glaubte, eine gute Nachricht zu überbringen. War keine Lesbe. Hatte sich mit einem berühmten Dichter zusammengetan. Kam raus aus diesem drittklassigen College. Ihr Leben war wieder auf dem richtigen Gleis. Oder?
Die Mutter schüttelte mit rot geränderten Augen den Kopf. «Ich wusste, dass du es bereuen würdest, lesbisch zu sein. Aber das jetzt ist auch nicht besser, Schatz. Ich wollte, dass du eine Ausbildung bekommst. Inzwischen bist du siebzehn, und ich kann nichts mehr tun.»
Ihr Vater sagte: «Das spart mir einen Haufen Geld, weißt du? Du bist jetzt Lee Flemings Problem, und ich wünsche ihm viel Glück.»
«Wieso bin ich Lees Problem? Ich werde auf ein anderes College gehen. Ich habe mich schon an der New School for Social Research beworben!»
Ihr Vater rollte mit den Augen. Für ihn war es ein grausamer Scherz, den ihm sein Vorgesetzter, der Herrgott, gespielt hatte. Ein sozial Höhergestellter mit intellektuellen Neigungen und einem Vermögen an Grundbesitz: Wie oft hatte er um einen solchen Ehemann für Peggy gebetet.
Das Abschiedsgeschenk ihrer Mutter war ein Besuch beim Gynäkologen. Peggy war noch nie beim Gynäkologen gewesen und mochte das gar nicht. Er sollte ihr ein Diaphragma anpassen. Stattdessen warf er nur einen Blick auf ihren Gebärmutterhals und sagte: «Miss Vaillaincourt, Sie bekommen bald ein Baby, und ich würde sagen, es dauert nicht mehr lange, sodass Sie die nächstmögliche Gelegenheit zur Heirat ergreifen sollten.» Sie sagte, sie wolle kein Baby, und er wiederholte seinen Satz Wort für Wort mit genau der gleichen Betonung, wie eine Maschine.
Lee sah es kommen. Sie kehrte aus den Weihnachtsferien zurück und sah aufgedunsen aus. Wenn er es recht überlegte, hatte er sie seit September fast jeden Tag gevögelt. Er fragte: «Punky, kriegst du eigentlich nie deine Tage?» Sie brach zusammen und flehte ihn um eine Abtreibung in Mexiko an. «Warum solltest du das tun?», fragte er. «Mein Kind würde meinen Namen tragen.» Sie starrte ihn entsetzt an, als wäre er eine riesige Spinne, dann schlug sie die Fäuste gegen ihren Bauch und stöhnte wie eine Kuh. «Ist dir übel? Das ist in Ordnung, das ist normal.»
Er hatte nicht damit gerechnet, jemals zu heiraten, aber er fühlte sich der Aufgabe gewachsen. Der Gedanke an eine Vaterschaft überraschte ihn angenehm. Und als Mann ging er nicht davon aus, dass unangenehme Pflichten auf ihn zukämen. Er würde dafür zuständig sein, das Kind in der Kunst des Gesprächs zu unterrichten, wenn es erst einmal im Teenageralter war.
Es oblag Peggys Eltern, die Hochzeit zu finanzieren. Peggy kam immerhin so weit, sie zu fragen. Ihre Mutter nannte sie Lees Mätresse und sagte, das Baby würde missgestaltet zur Welt kommen, da die Flemings ihre Verwandten heirateten. Ihr Vater gab ihr fünfhundert Dollar und seufzte.
Lee fragte seinen alten Freund Cary um Rat. Sie waren Nachbarn gewesen und nebeneinander aufgewachsen. Cary war älter, reicher und sanftmütig. Er hatte das Hobby, Blumen zu stecken, und die Angewohnheit, mit heterosexuellen Männern in schwierige Situationen zu geraten. Sie trafen sich im Cockpit, einer Schwulenbar unter einem Eisenwarenladen in Portsmouth.
«Urbanna ist genau der richtige Ort für eine Heirat», sagte Cary. «Du mietest den Strand, und ich organisiere uns ein paar Schwanenboote. Da gibt es den weißesten aller Strände in ganz Tidewater, und wir stopfen die Christ Church so voll mit Magnolien, dass sie platzt.»
«Schwanenboote? Bist du besoffen?»
Cary verschränkte die Arme und sagte: «Dann heirate doch in der Battle Abbey und mach den Empfang im Garten. Mir egal.»
«Schwanenboote würden auf den Fluss hinaustreiben. Die Flügel wirken wie Segel, und sie haben keinen Kiel.»
«Du willst also die Schwanenboote.» Cary zeigte auf ihn und verkündete der leeren Bar: «Fleming will Schwanenboote.»
«Ich möchte auch eine Ehrengarde vom Virginia Military Institute, aber das heißt nicht, dass ich sie bekomme. Ich brauche was für dreihundert Leute, damit sie erfahren, dass meine wunderschöne Braut guter Hoffnung ist, und dann wieder abziehen, während wir auf Hochzeitsreise gehen, und dafür brauche ich – Mann, was brauche ich da? Das frage ich dich. Glaubst du, ich mache das jeden Tag?»
«Die Bruton Parish Church. Dann können sich die überzeugten Heiratsgegner unter uns auf ein paar Mint Juleps ins Williamsburg Inn zurückziehen, und du fährst mit Wie-heißt-sie-noch-gleich runter nach Hatteras.»
«Peggy.»
«Dann fährst du mit Piggylein runter nach Nags Head und schwängerst sie wieder.»
«Sie ist schon schwanger. Doppelt schwanger geht nicht.»
«Dann kannst du entspannt zusehen, wie sie fetter wird.»
«Das ist kein Fett. Das ist ein Fleming. Außerdem fahren wir nach Charleston.»
«Im Januar?»
«Frühjahrs-Semesterferien.»
«Im März ist sie prall wie eine Zecke. Großer Leib, kleine Arme und Beine.»
Die Tür der Bar flog auf, und vier Matrosen kamen herein, drängelten und schoben sich die enge Treppe hinunter. Lee starrte sie sofort herausfordernd an, und Cary zupfte ihn am Arm. «Hoppla, Freundchen. Du bist ein verheirateter Mann.»
«Ich hab doch wohl das Recht auf eine Junggesellenparty, oder?»
Lee schrieb ein Gedicht mit Schwanenbooten, um sich davon zu befreien, und stellte sich dann der Einsicht, dass er sich von Peggy befreit hatte. Die mühelosen Freuden und die freudige Mühelosigkeit des Sex mit Männern, deren mühelos verfügbare Genitalien, ihr unkompliziertes Innenleben ... Er wusste, dass es auch Frauen gab, die so lebten, sogar schöne und sehr interessante Frauen, aber die machten ihn überhaupt nicht an. Er wollte die bedürftig starrenden Blicke vorher und die dankbar ehrfürchtigen Tränen nachher, als wäre jeder Orgasmus eine Begnadigung, ein Aufschub des Todesurteils. Er wollte es nur nicht immer.
Er hatte so viel Sex mit Peggy gehabt wie menschenmöglich, und das war genug. Sie hing in seinem Haus herum und tat ihr Bestes, ihm aus dem Weg zu gehen, als hätte sie Angst vor ihm. Ihr war übel, existenziell und überhaupt. Sie wollte ihm nicht auf die Nerven gehen. Sie fühlte sich abhängig. Und sie war es auch. Sie war abhängig davon, dass er furchtbar viel tat, etwa, dass er sie heiratete, dass er ihr Kind großzog, dass er sie nach New York zur Uni schickte und dass er ihr Dasein finanzierte bis ans Ende ihrer Tage. Sie hatte den Verdacht, dass es nicht ganz so laufen würde.
Auch er wusste, dass er sie nicht fortschicken würde, damit sie ihren Abschluss machte. Aber er kannte den wahren Grund: Das College zahlte ihm zweitausend Dollar im Jahr, und darauf beschränkten sich seine Einkünfte. Er verfügte über keinen Treuhandfonds, hatte nur die Aussicht auf die Erbschaft von seinem Vater, einem lebenslustigen Vierundfünfzigjährigen, der eher bei einem Skiunfall sterben als vor seinem achtzigsten Geburtstag krank werden würde. Es war kein Zufall, dass die berühmten Dichter ihn besuchten und nicht umgekehrt und dass er ihnen Spaghetti vorsetzte. Aber quand même. Die besten Dinge im Leben sind umsonst. Eine Runde Poolbillard mit Matrosen ist schöner als Charleston im Frühling, wenn es die richtigen Matrosen sind.
Peggy fing an, ein Theaterstück zu schreiben. Sie kam bis zu den Namen der dramatis personae. Sie wollte auf den Artus-Mythos zurückgreifen, das Questentier und den Fischerkönig, aber bei Guinevere blieb sie hängen. Sie stellte sich Joan Baez vor, nur ohne gellende Stimme und Gitarre, die Arme ausgebreitet wie die Madonna von Guadalupe, aber das hatte nicht mehr viel mit Artus zu tun. Das war mexikanisch. Damals dachte sie viel an Mexiko. Die Freiheit dort, der ewige Frühling, die Frauen, die wie Wegekuckucke über die kahlen, verbrannten Hügel flitzten. Der Februar war so kalt, dass der Stillwater Lake zufror und ihre früheren Mitschülerinnen auf Schlittschuhen über den See fuhren und durch die Lücke im Bambus verstohlene Blicke auf das Haus warfen. Emily kam sogar bis zur rückseitigen Veranda, öffnete die Fliegentür und klopfte fünfmal laut. Aber sie behielt die Schlittschuhe an und war verschwunden wie der Blitz. Dann taute es, und Peggy war wieder allein.
Für eine Lesbe bedeutete Lees Haus einen kalten Entzug. Es konnten Monate vergehen, ohne dass man eine Frau zu Gesicht bekam. Aber das war auch egal, wenn man vorgehabt hatte, eine bleistiftdünne Verführerin in Schwarz zu sein, und nun im karierten Bademantel am Herd stand und Pfannkuchen buk. Am liebsten mochte Peggy es, wenn Dichter zu Besuch waren. Die hatten nichts dagegen, wenn man bei ihnen saß und zuhörte. Selbst etwas zu sagen, was auch sie interessieren könnte, war unvorstellbar, denn an thematischen Gesprächen waren sie nicht interessiert. Sie hatten ihre eigene Art, non sequiturs zu generieren, und manchmal spielten sie etwas namens Cadavre Exquis, wobei man Geschichten aneinanderreihte, ohne zu wissen, worum es ging. Einer brachte ein Ouija-Brett mit und ließ Geister seine Gedichte schreiben. Er hätte sogar Peggy seine Gedichte schreiben lassen, wenn Lee sie nicht angesehen und die Stirn in Falten gelegt hätte.
Am Anfang fragte sie sich, warum sie alle so reich waren. Wenn einer von ihnen seine Uhr vergaß oder einen Kaschmirpullover zusammengeknäult in einer Sofaecke, meldete er sich nicht, um nachzufragen. Lee erklärte ihr, dass L’art pour l’art eine Ästhetik der Oberschicht war. Um Kunst jenseits allen Zwecks zu erschaffen, konnte man unmöglich ein Leben führen, das von Bedürfnissen und Wünschen bestimmt war. Sie wollte Stücke schreiben, von denen die Leute umgehauen wurden; er wollte überhaupt nichts. Seine Gedichte existierten einfach, und deshalb waren sie gut und ihre Stücke schlecht.
Peggy dachte über die Möglichkeiten der Dichter nach, ihre Publikationen selbst zu finanzieren, und war sich nicht so sicher. Lee hatte einen Freund mit einer Druckerpresse – keine Linotype oder eine der neuen Offsetdruckmaschinen, sondern eine mit beweglichen Bleilettern, die alles, was Lee schrieb, wertvoll aussehen ließen. Und die Stillwater Review machte aus allem ein Gedicht, einfach indem sie es druckte, sogar 41 Wiederholungen von «F*tze», angeordnet in Form des Empire State Building. «Dichter sind nicht auf der Welt, um sie mit Etiketten zu versehen», erklärte er. «Wenn es in diesem Gedicht überhaupt um etwas geht, dann um den Akt des Lesens. Wolltest du es als Beweis für Obszönität anführen, müsstest du sagen, was es bedeutet, und genau darum kann ich es veröffentlichen.»
«Ich mag es nicht», sagte sie. «Es macht aus Fotzen einen Schwanz.»
«Fotzen wurden für Schwänze gemacht. Was du mit deiner tust, ist deine Angelegenheit, aber so sieht’s nun mal aus. Nichts anderes wurde je für Schwänze gemacht. Was mich nie von irgendwas abgehalten hat. Das ist hier schließlich ein freies Land.» Er zündete sich eine Tareyton an und blies einen Rauchring quer durchs Zimmer.
Peggy hatte wenig Erfahrung, aber ein unbehagliches Gefühl sagte ihr, dass die Dinge nicht unbedingt gut ausgehen würden.
Das Frühjahr war wärmer als üblich. Schon im April konnte man die ganze Nacht mit Dichtern ums Feuer sitzen und herumblödeln. Sie hatte gedacht, Dichter wären anders, aber inzwischen wusste sie, dass sie wie gute Kumpel allerorten auch nur Blödsinn redeten. Jedem Säufer auf dem Gehweg vor dem Drugstore konnte man in einer halben Stunde beibringen, ein Dichter zu sein. Sie würden sich weigern, oder vielleicht würden die Klemmschwestern unter ihnen mitmachen, aber sie hätten es alle geschafft, und zwar besser als die College-Mädchen, denn College-Mädchen mussten erst ihre Hemmungen überwinden. Die Leute, die von Revolution redeten, taten so, als reichte es schon, bloß alles Hemmende aus sich rauszulassen, um frei zu sein. Aber man konnte genauso gut ein Säufer vor dem Drugstore sein und alles, was einem durch den Kopf ging, so provokativ wie nur möglich von sich geben und es ewig wiederholen und verfeinern, denn wie sonst sollte man die hundertfünfzigtausend Stunden totschlagen, bis der Vater bei einem Verkehrsunfall starb? Die Dichter erinnerten sie an Kneipenhocker, die sich an ihren eigenen Witzeleien begeisterten und den Barkeeper betrunken machten, weil sie nicht wussten, was Arbeit war. Aber Freiheit bedeutete nicht, alles auszusprechen, was einem durch den Kopf ging. Freiheit bedeutete, Geld zu haben, um nach Mexiko zu fahren.
«Himmel, Peggy. Du kannst nicht im siebten Monat abtreiben. Das ist Kindsmord. Du musst schon dafür sorgen, dass dein Vater kommt und mir die Pistole auf die Brust setzt, denn ich vergesse immer wieder, dich zu heiraten. Und ich will dich doch heiraten.»
«Dann heirate mich doch einfach jetzt.» Peggy hatte gehört, dass es so etwas wie Alimente gab. Sie wusste nicht genau, wie viel das war und ob es zum Leben reichte, aber es konnte nur besser sein, als das Leben einer unverheirateten Teenie-Mutter zu führen. Sie war nicht einmal achtzehn, und es würde noch drei Jahre dauern bis zur Volljährigkeit. Man hätte sie auch in ein Heim für gefallene Mädchen stecken können.
«Du forderst mich heraus», sagte Lee.
«Und zwar mit Sahnehäubchen und Kirsche obendrauf.»
Er rief einen Friedensrichter an, und am nächsten Nachmittag heirateten sie für fünfzehn Dollar.
ZWEI
Als sie das Baby geboren hatte, konnte sie kaum glauben, wie hübsch es war. Rhys! Den Namen hatte sie ganz allein ausgewählt. Die Wehen waren kein Problem, nicht schlimmer als die Krämpfe, bei denen sie immer das Gefühl hatte, ein Kalb zu gebären, dann fünf Stunden Krankenhaus, und schon war er da. In blaue Tücher gewickelt, lag er auf einem kleinen Wagen, während sie Saft trank. Lees Mutter nahm ihn auf und sagte: «Willkommen auf der Welt, kleiner Harry!»
«Was machen Sie da, Mrs. Fleming?», sagte Peggy. «Geben Sie mir mein Baby.»
«Du wolltest dieses Baby doch gar nicht haben, oder? Habe ich jedenfalls gehört.»
«Lee!», schrie sie. «Lee!»
Lee kam vom Flur herein. «Ja, Liebling? Also, nun seht euch das an. Meine Güte. Was für ein Herzchen. Schaut ihn euch doch an. Sieht er nicht putzig aus?»
«Er heißt Rhys», sagte Peggy. «Rhys Byrd Fleming. Gefällt dir das?»
«Aber sein Taufname ist Harry», sagte Lees Mutter.
«Moms, lass das. Sie ist meine Frau. Ich bin sein Vater. Das Baby gehört nicht euch. Es ist mein Baby! Jawohl! Wer ist mein Baby?» Er nahm Rhys und küsste ihn auf die Wange, dann beugte er sich hinunter und küsste Peggy.
«Also, wir kümmern uns gerne um ihn, wenn ihr Hilfe braucht», sagte Lees Mutter.
«Wisst ihr was», sagte Peggy, «ich glaube, es wird Zeit, dass ich ihn zu füttern versuche. Könntet ihr uns ein bisschen allein lassen?»
«Genau, könntest du den Anker lichten, meine Liebe?», sagte Lee.
«Ich bereite dir etwas Säuglingsmilch zu», sagte die Mutter und schaute sich nach einer Packung um. «Sag nicht, dass du ihm die ... nein. Das kann ich nicht glauben.»
«Aber es ist das Natürliche», sagte Peggy. «Es ist gut für ihn.»
«Dann hast du ihn wie einen Klotz am Bein, wie ein Sträfling seine Kugel. Du kannst ihn nicht mehr aus den Augen lassen, und niemand kann dir mit ihm helfen. Das tut keine Frau, die auf sich hält. Als würdest du ein Tier aus dir machen.»
«Schon mal gehört, von wem wir abstammen, Lady?»
«Jetzt kriegt euch nicht gleich in die Haare», sagte Lee.
«Aber genau darum geht es», sagte seine Mutter. «Du kennst die chemische Zusammensetzung nicht. Da könnte alles Mögliche drin sein. Das ist unwissenschaftlich.»
«Die Wissenschaft hat uns die Bombe und DDT gebracht», sagte Peggy.
«Moms», sagte Lee und schob sie Richtung Tür, «bitte lass uns einfach machen. Alles wird gut. Alles ist in Ordnung. Der kleine Rhys Byrd hier ist ein Fleming. Wenn irgendjemand Muttermilch überlebt, dann er. Sie ist einfach, ich glaube ...», sagte er und wandte sich nach Worten suchend Peggy zu, «... etwas nervös. Das ist ihr erstes Enkelkind.»
«Aber sie tut so, als wäre sie mit allen Wassern gewaschen.»
«Na, sie hat mich aufgezogen. Deshalb glaube ich ja, dass jede das schaffen kann.»
Eine Beschneidung gab es nicht. Lee sagte, die Beschneidung hätten sich Moralisten und Cremeverkäufer ausgedacht, damit man sich beim Wichsen wund rieb, und Peggy beugte sich seinem besseren Urteilsvermögen.
Sie lebte sich ein mit Baby Byrdie. Sie erledigte alle Hausarbeiten. Sie wusch mehr Wäsche, als je zuvor in Lees Haus gewaschen worden war, und im September konnte man genau erkennen, wo im Vorgarten die Abwasserrohre verliefen. Das Rispengras wuchs dort dunkler.
Sie passte nicht mehr in die Kleidung, die sie sich als Studentin gekauft hatte, also trug sie Lees Polohemden. Sie kam nur selten dazu, ihr Haar zu waschen, und die Locken wurden immer strähniger. Ihre Brüste waren schwer und wund. Aber sie spürte, dass das, was mit ihr nicht stimmte, bald wieder in Ordnung kommen würde. Was mit ihr nicht stimmte, war bei Byrdie und Lee so stimmig, dass sie es bei sich selbst unerheblich fand. Die beiden waren bei bester Gesundheit und sahen aus, als kämen sie direkt aus einer Werbung für Hemden beziehungsweise Babynahrung. Sie selbst sah aus, als wäre sie die Hausmeisterin.
Lees Besucher saßen am Feuer und blödelten noch, wenn Peggy längst schlief. Sie wusste nicht, was sie machten, nachdem sie schlafen gegangen war, und es interessierte sie auch nicht. Sie war abends so erschöpft, als hätte sie fünf Stunden lang Flag Football gespielt. Mit acht Monaten war Byrdie so schnell unterwegs, dass sie ihm nachjagen musste. In einem Haus wie diesem konnte man nicht