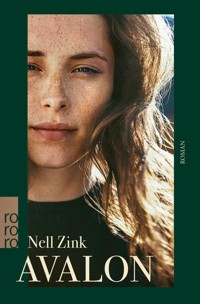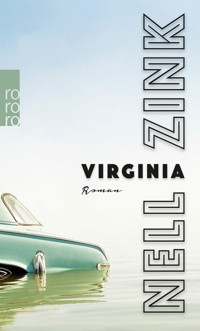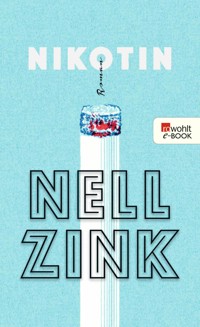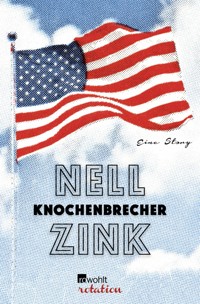20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sister Europe ist der sensationell gelungene Berlin-Roman einer seit einem Vierteljahrhundert in Deutschland lebenden Amerikanerin, die sich hier besser auskennt als die meisten Berliner. Ein geistreiches, ein großes Lesevergnügen. Berlin im Vorfrühling. Eine Zufallsgemeinschaft ganz unterschiedlicher Menschen – ein Kunstkritiker und seine halbwüchsige trans Tochter, ein arabischer Prinz, ein alternder Lebemann mit seinem deutlich jüngeren Internet-Date und eine hinreißende Grande Dame – wandert durch die Stadt, von einem Galadiner im verblüht noblen Hotel Interconti quer durch den nächtlichen Tiergarten, stets verfolgt von einem Kripomann, der Verbotenes wittert. En passant entspinnt sich ein Gespräch voller Witz, Intelligenz, eingebettet in die Topografie und Geschichte der deutschen Hauptstadt, und durch den Plauderton hindurch dringen leise die großen Fragen: nach der Einsamkeit des Menschen, nach der Möglichkeit, sie zu durchbrechen, nach dem eigenen Platz auf dieser Welt. Am Ende finden sich die, die zusammenpassen, und die es nicht tun, finden sich auch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nell Zink
Sister Europe
Roman
Über dieses Buch
Berlin im Vorfrühling. Eine Zufallsgemeinschaft ganz unterschiedlicher Menschen – ein Kunstkritiker und seine halbwüchsige trans Tochter, ein arabischer Prinz, ein alternder Lebemann mit seinem deutlich jüngeren Internetdate und eine hinreißende Grande Dame – wandert durch die Stadt, von einem Galadiner im verblüht noblen Hotel InterConti quer durch den nächtlichen Tiergarten, stets verfolgt von einem Kripomann, der Verbotenes wittert. En passant entspinnt sich ein Gespräch voller Witz, Intelligenz, eingebettet in die Topografie und Geschichte der deutschen Hauptstadt, und durch den Plauderton hindurch dringen leise die großen Fragen: nach der Einsamkeit des Menschen, nach der Möglichkeit, sie zu durchbrechen, nach dem eigenen Platz auf dieser Welt. Am Ende finden sich die, die zusammenpassen, und die es nicht tun, finden sich auch.
Sister Europe ist der sensationell gelungene Roman einer seit einem Vierteljahrhundert in Deutschland lebenden Amerikanerin, die sich hier besser auskennt als die meisten Eingeborenen. Ein geistreiches, ein großes Lesevergnügen.
Vita
Nell Zink, 1964 in Kalifornien geboren, wuchs im ländlichen Virginia auf und lebt seit fast einem Vierteljahrhundert in Deutschland. Sie studierte am College of William and Mary Philosophie und wurde an der Universität Tübingen in Medienwissenschaft promoviert. Mit ihrem 2019 erschienenen Roman Virginia war sie für den National Book Award nominiert. Sie lebt in Bad Belzig, südlich von Berlin.
Tobias Schnettler lebt als Übersetzer in Frankfurt am Main. Unter anderem hat er Bücher von Garth Risk Hallberg und Andrew Sean Greer übersetzt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel «Sister Europe» bei Alfred A. Knopf, New York City.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Sister Europe» Copyright © 2025 by Nell Zink
Covergestaltung Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung Koen van den Broek, «Wilshire BLVD #1» (Ausschnitt), Öl auf Leinwand, 180 x 120 cm, 2009. Courtesy image, Studio Koen van den Broek
ISBN 978-3-644-02264-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
I
«Es regnete vierzig Tage und vierzig Nächte», erzählte Demian seiner jüngeren Tochter Maxima («Maxi»), die mit leichtem Fieber früher als sonst ins Bett gegangen war. Am Morgen würde es sich bestimmt zu etwas Größerem ausgewachsen haben. Er war Deutscher, ihre Mutter aber nicht, und weil Maxi auf eine deutsche Schule ging und sich mit ihren Freundinnen auf Deutsch unterhielt, hatten sie als Familie beschlossen, zu Hause Englisch zu sprechen. «Das Eis schmolz und schmolz, bis es ganz von Wasser bedeckt war und auf einem See schwamm, der gar nicht hätte da sein dürfen. Und dann plötzlich rutschte es direkt in den Ozean. Platsch!» Mit beiden Händen stellte er eine Kiste nach, die von einem schiefen Regal rutschte. «Stell dir vor, ein Eisblock so groß wie Grönland!»
Sie nahm den Daumen aus dem Mund und fragte: «Wie groß ist Grönland?»
Er wusste es nicht. Es war bekannt dafür, kleiner zu sein, als es auf der Mercator-Projektion aussah, aber doch sicherlich groß, weil sein Schmelzen den globalen Meeresspiegel um rund sieben Meter würde ansteigen lassen. Ohne auf ihre Frage einzugehen, fuhr er mit der bestellten Geschichte über einen Tsunami fort, der ihr Haus traf. «Das Eis plumpste in den Ozean und erzeugte eine Welle, die so gigantisch war, dass sie über den Nordatlantik bis nach Norwegen schwappte.» Er fand, es könne nicht schaden, eine kleine Erdkundelektion einzubauen. «Die Riesenwelle umrundete Schottland und durchquerte die Nordsee, von England nach Holland, gelangte bis nach Hamburg und dann hundertfünfzig Kilometer die Elbe hoch. Als sie die Mündung der Havel erreichte, trat sie auf die Bremse und bog scharf nach links ab. Alle Enten in den Sümpfen flogen hoch. Allez hop!» Er hüpfte, indem er seinen Rumpf ein paar Zentimeter von der Matratze hob, und ließ sich gleich wieder fallen, damit sie weiter mit seinem Haar spielen konnte. «Dann ist sie die Havel rauf bis nach Potsdam, und als sie den Wannsee erreicht hat, ist sie rechts auf den See abgebogen. Und dann war sie vor unserem Haus – ein gigantischer Tsunami, der den ganzen Weg von Grönland bis hierher zurückgelegt hat!»
Sie sah zufrieden aus und sagte: «Mega.»
«Giselher und Almut» – so hießen ihre betagten Vermieter – «kamen rauf, um das Ganze mit ihren Smartphones zu filmen.» Einen Moment lang störte ihn das Faktenwidrige daran; die beiden waren schon seit Jahren nicht mehr die Treppe hinaufgestiegen. Doch das hieß nicht, dass sie es nicht mehr konnten, wenn die Motivation nur groß genug wäre.
«Waren sie tot?» Sie klang hoffnungsfroh.
Er wollte seine Erzählung nicht unterbrechen, um zu erklären, dass mit dem Tod eine gewisse Regungslosigkeit einherging und er somit etwas Schlechtes war, ganz besonders in diesem Fall (die Erben würden sofort das ganze Haus an sich reißen), also antwortete er: «Nein. Es ist nichts Schlimmes passiert. Die Welle war müde, weil sie Tausende Kilometer gereist war und Treibgut mitgebracht hatte.» Ihr Blick verriet ihm, dass er Treibgut genauer definieren musste. «Sie hatte Dreck dabei und Schrott und Strandgut und Eisberge und Häuser und Autos und Fähren und Feuerwehrautos …» Er hielt inne, obwohl er sah, dass ihr die Liste gefiel. Ihm fehlte die Lust, weitere Objekte aufzuzählen, weil er sich unwillkürlich eine Flottille von Leichnamen ausmalte, die aufgedunsen an der Oberfläche trieben, als wären sie schon seit Tagen tot. «Als sie Berlin erreichte, war sie so erschöpft, dass sie nur noch fünf Zentimeter hoch war. Sie konnte sich kaum noch bewegen! Sie suchte vor allem nach einer Stelle, wo sie die ganzen Sachen ablegen konnte.»
«Wo hat sie sie denn hingelegt?»
«In Siemensstadt.» Er machte sich nicht die Mühe, darüber nachzudenken, dass er perverserweise ein Arbeiterviertel genannt hatte. Niedrig gelegene Flächen in Flussnähe waren oft Industriegebiete, das war nicht seine Schuld.
«Waren auch Bäume dabei?» Sie wollte eindeutig, dass auch Bäume dabei waren, also nickte er. «Was hatte sie sonst noch dabei?»
«Da gab es Ameisen und Heuhaufen und Chlor und Puppen und Elefanten und Freundschaften und Ziegen und Hügel und Krankheiten und Bei-Rot-über-die-Straße-Geher und koreanische Fernsehserien» – seine Aufzählung geriet ins Stocken, als sei der Selbstzweifel dabei, ihm die Kontrolle zu entreißen – «und Lichtmasten und Geld und Nudeln und Optionen und Fortschritt und Matschboden und retrograde Amnesie und Vernunft und Bäume und das Universum und Votivgaben und Wale und Xylofone und Yahoos und Zebras.»
Er verstand ihr leises Seufzen als Bitte um noch mehr Bäume. Er wollte gerade darauf eingehen, doch dann sah er, dass sie eingeschlafen war. Ihre Augen waren geöffnet; die alphabetische Liste (auf Englisch war sie nämlich alphabetisch gewesen) hatte sie gegen ihren Willen hypnotisiert.
«Schlaf jetzt», sagte er. Sie schloss die Augen. Ihr Mund klappte auf, und ihre Hand ließ sein Haar los. Er spürte, wie väterlicher Stolz in ihm aufwallte, weil sie solchen Wert auf Bäume legte oder überhaupt auf Naturphänomene, auch wenn das in ihrem Alter (viereinhalb) alles Mögliche bedeuten konnte. Vorsichtig stand er auf, schlich auf Zehenspitzen durch den Flur und betrat die elterliche Suite – ein Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer, die durch einen Ankleideraum mit Bad miteinander verbunden waren –, um sich für den Abend anzuziehen.
Er wählte sein edelstes, konservativstes Outfit – einen Dreiteiler aus blauer Wolle, den er in München gekauft hatte, und dazu ein maßgeschneidertes weißes Hemd. Das Hemd hatte einen Bubikragen. Immer wieder erhielt er Komplimente für seine Hemden mit den runden Kragen, und immer verriet er ganz genau, wo er sie bestellte: bei einem Mütterchen in Slubice. Bei der Auswahl der Krawatte zögerte er. Er wollte nicht auffallen, doch er rechnete mit einem eher exzentrischen Publikum und hatte das Gefühl, selbst auch ein wenig unkonventionell aussehen zu müssen, oder zumindest nicht wie ein Banker.
Er lief durch den Flur, ohne Krawatte, die Weste und das Hemd aufgeknöpft. Seine Frau Harriet saß am Küchentisch, aß ein Stück Apfelkuchen vom Blech, das sie am Nachmittag gekauft hatte, und las auf ihrem Telefon eine lange E-Mail. Ihr kinnlanges blondes Haar war zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden. Abgesehen von ihren Elsa-aus-Die-Eiskönigin-Hausschuhen (ein Geschenk von Maxi) trug sie ausschließlich Schwarz, bis hin zu den schwarzen Socken und dem Halstuch. Sie blickte auf und legte das Telefon mit dem Display nach unten auf den Tisch.
«Ist Nicole schon zurück?», fragte er. «Sie muss mich modisch beraten.»
«Sie hat gerade geschrieben, dass sie bei Einbruch der Dunkelheit da ist.»
«Und wann ist das?»
«In einer Stunde vielleicht.»
Es war Dienstag, der 21. Februar 2023, und um 16:30 war das schwache Glimmen der Sonne noch am strukturlosen Himmel über dem Grunewald zu sehen. Die Küche im ersten Stock ihrer geteilten Villa ging auf einen der naturbelassensten Seen im Berliner Stadtgebiet hinaus, den Schlachtensee. Ab Mitte April würde die Aussicht von den Blättern verdeckt sein. Im winterlichen Dämmerlicht sah man, wie das schwarze Wasser vom Wind und vom verhaltenen Regen erzitterte.
«Das ist zu spät», sagte er. «Was meinst du, krawattenmäßig – vielleicht die Hermès mit den kleinen Leoparden?»
«Auf dich achtet eh niemand», sagte sie. «Das ist kein formelles Event. Das sind Reiche. Zieh ein gemustertes Hemd an, damit keiner denkt, du gehörst zum Catering.»
Demian ging in sein Zimmer zurück und nahm die Alternativen in den Blick. Schließlich blieb er bei weißem Hemd und Dreiteiler und wählte dazu eine dunkelblaue Krawatte und gelbe Socken. Wieder präsentierte er sich Harriet und sagte: «Ich zieh meine neuen roten Sneaker an. Was sagst du?»
«Süß.»
Sie hatte gar nicht richtig hingesehen. Er drückte seinen rechten Daumen gegen die Rückseite seines Telefons und trat an die Fensterfront. Die Welt da draußen sah nass und stürmisch aus, doch die Wetter-App behauptete, der meiste Niederschlag sei für diese Woche durch. Es könnte noch ein, zwei Liter pro Quadratmeter regnen. Ihm fiel ein, dass man von glänzenden Lederschuhen den Matsch besser abbekam, für den Fall, dass er durch Matsch laufen musste. Diese Änderung seiner Schuhwerksplanung kam ihm nicht wichtig genug vor, um sie mit seiner Frau zu teilen, die inzwischen mit Noise-Cancelling-Kopfhörern auf dem Kopf konzentriert auf eine Videokonferenz starrte. Wenn ihr Arbeitstag zu Ende ging, würde er mit ihrer schönen gemeinsamen Freundin Livia bei einem Gourmet-Dinner sitzen. Er hatte keine Schuldgefühle. Das Mahl musste er sich durch die Teilnahme an einer literarischen Preisverleihung hart erarbeiten.
Er kannte den Preisträger gut: einen alterslosen (achtundsiebzig, mit beinahe makelloser Haut, weil er nur selten die Sonne sah) arabischen (er war schon mit elf von der Sinai-Halbinsel nach Norwegen geflohen, schrieb aber mit unverminderter und äußerst produktiver Intensität über seine Jugend, ohne je literarische Kompetenz in einer zweiten Sprache erlangt zu haben) Fabuliermeister, dem er erstmals an einem dänischen Strand begegnet war.
Demian war damals jung und leicht zu beeindrucken gewesen, traurig und schüchtern – achtzehn Jahre alt und ein begeisterter Leser von Lyrik, auch von arabischen Versen in Übersetzung. Tagelang hörte er Masuds blumigem, stockendem Englisch zu, außerstande, seine ständigen Einladungen abzulehnen. Er war mit gerade so viel Gepäck unterwegs, wie auf sein Fahrrad passte, und der Dichter und seine Frau hatten ein Haus mit Grillstelle und Weinkeller gemietet. Mit ihrer Erlaubnis stellte er sein Zelt in ihrem Garten auf. Er kam sich dadurch ein wenig wie ein Beduine vor, so, als würde er sich ihnen annähern. Zwischen den Mahlzeiten unternahmen der Ältere und der Jüngere lange Spaziergänge auf den Sandbänken zwischen der Insel Mandø und der Küste, nachdem sie sich die Gezeitentabelle angesehen hatten, um nicht von der Flut abgeschnitten zu werden. Masuds Ehefrau kochte, wenn auch nicht besonders gut. Was sie sonst noch tat, konnte Demian nicht genau sagen. Als er sie fragte, ob sie gerne am Strand spazieren ging, zog sie sich den Schleier vor die Nase, und er fragte sie nicht noch einmal. Sie spielte die Rolle der Abwesenden mit solcher Hingabe, dass er nicht allzu überrascht war, als Masud ein Jahr später in der Bretagne mit einer anderen Frau auftauchte – sie hatten sich für den Sommer verabredet. Zwischen den Mahlzeiten unternahmen sie Spaziergänge, und die Frau machte irgendwas. Er sah und hörte nie etwas von Kindern und fragte sich, ob die vielen Scheidungen mangels Nachwuchs zustande kamen. Oder wegen Impotenz? Oder gab es vielleicht jede Menge Kinder, die gerade zu Hause bei ihren Müttern waren? Er würde nicht danach fragen. Selbst zu einem Zeitpunkt, als er mit Fug und Recht sagen konnte, sich Masuds Geschichten 250 Stunden lang angehört zu haben, wusste er nur sehr wenig über sein Leben. Der Dichter fesselte ihn mit dem Zauber der Wüste, während sie durch das mit Wurmhäufchen besetzte Nordseewatt wanderten. Masud wurde als literarische Stimme der nomadischen Hirten Arabiens gefeiert – stolze Söhne der Wüste, eine edle Kaste entspannter Sybariten, die nicht für ihre Strenggläubigkeit bekannt waren. Als er die Bücher las, stieß Demian zu seinem Entsetzen auf einen krassen und hartnäckigen Rassismus gegen Schwarze. Ließ sich das entschuldigen? Er entschuldigte es, auf Grundlage der Tatsache, dass es einem antischwarzen Rassisten schwerfallen würde, in Norwegen allzu viel Schaden anzurichten, wo antimuslimischer Rassismus eine tödliche Bedrohung war (zugegeben, ein großer Teil davon war intersektional und richtete sich gegen Somalis). War es herablassend, seine eigenen ethischen Maßstäbe zu senken, weil der Mann ein Genie war, oder war es eurozentrisch, sie nicht zu senken, und was war schlimmer?
Er wusste aus eigener Erfahrung, dass Harriet nicht die Geduld hatte, um sich solchen oder sonst irgendwelchen Schwachsinn anzuhören. Sie war eine Pragmatikerin aus Ohio, profilierte Bauingenieurin aus einer Dynastie mennonitischer Baumeister, und Preisverleihungen – sogar (oder ganz besonders) solche für Architekten – ärgerten sie. Sie war auf öffentliche Bauvorhaben spezialisiert, und es war ihr gesetzlich verboten, Gefälligkeiten anzunehmen. Sein Leben hingegen war ein einziger großer Reigen aus Gefälligkeiten: Hier wurde mal ein Name gegenüber dem Vorsitzenden einer Preisjury fallen gelassen, dort gab es den Schlüssel zu einem ungenutzten Strandhaus auf Sardinien. Die Menschen mochten ihn mehr, als sie sie mochten, deshalb empfand er gesellschaftliche Termine als angenehm. Er war pflegeleicht, gut aussehend und verbindlich, und er nahm Dinge und Menschen auf eine Weise ernst, die ihnen allen schmeichelte. Seine gut gelaunte Ernsthaftigkeit hatte ihn zu einem gefragten freien Kunst- und Architekturkritiker gemacht. Ganz egal, was für eine lächerliche Vision irgendein verblendeter Künstler oder bankrotter Architekt auch vorschlug, er konnte mit einem Pitch und einer Liste potenzieller Finanziers darauf reagieren. Für ihn stand außer Frage, dass es für jedes Projekt auf der Welt, wie hirnverbrannt es auch sein mochte, eine Organisation mit schier unbegrenzten Mitteln gab, die sich dazu überreden ließe, es zu finanzieren, und einen Kurator, der bereit wäre, die Lorbeeren dafür zu ernten. Seine Überzeugung verfestigte sich durch die Beobachtung, dass selbst die größenwahnsinnigsten, für Instagram optimierten Kunstprojekte lächerlich billig waren, wenn man sie mit den Hobbys gewählter Volksvertreter oder zuverlässig durchgeknallter Superreicher verglich.
Er hatte sich diese Ernsthaftigkeit im ersten Jahr an der Uni angewöhnt, als einer seiner Mitstudenten ihm den Tipp gegeben hatte, dass die Zeit, wenn man sich beteiligte und die Texte las, schneller verging. Dinge und Menschen ernst zu nehmen, machte ihn ein wenig deprimiert – nie so, dass er im Bett bleiben musste, aber doch in einem Zustand bescheidener, unprätentiöser Melancholie, die sich in vielem zeigte, was er tat, wie er etwa eine einfache Tsunami-Geschichte für seine Tochter in eine düstere Fabel verwandelte.
Als junger Kunstliebhaber hatte er sich von stellvertretender Selbstkasteiung und Gewalt angezogen gefühlt und viele Performancekünstler, manchmal auch das Publikum, bluten und weinen gesehen. Dann hatte er Harriet getroffen, eine solide kreative Macherin. Er ahnte, wenn das Leben aus Gewalt bestand, konnte Kultur eine Alternative dazu sein: keine Lösung (Harriet war eine Problemlöserin), aber zumindest ein kurzer Moment der Erholung. Trotzdem ließ seine unterdrückte Liebe zur Gewalt Darstellungen symbolischer Gewalt vor seinem inneren Auge schillern. Er war einer der wenigen Kritiker, die die Baustelle der Wüsten-Utopie The Line besucht hatten, einer futuristischen Stadt, die die Berge an der saudi-arabischen Küste des Roten Meeres durchschneiden würde wie eine gigantische Version von Heizers Land-Art-Werk Double Negative. Er hatte die Vorbereitungen für den ersten SpaceX-Start in Boca Chica verfolgt und war bei der Einweihung der neuen Bibliothek der Nation in Ankara vor Ort. Es half, dass seine Frau wirkliches Geld verdiente, denn The Line stellte sich schnell als eine Handvoll Bulldozer-Fahrer heraus, die in Zelten hausten, während der Weltraumbahnhof und der präsidiale Komplex in Naturschutzgebieten errichtet worden waren, was es ihm verbot, sie in seinen Artikeln zu feiern. Manchmal hatte er auch eigene Visionen. Zum Beispiel stellte er sich ein Hypercar wie den nervigen Lamborghini seines Nachbarn vor (nur in Berlin wurden solche Dinger auf der Straße abgestellt!), am Grund eines Schwimmbeckens voller Honig. Das Werk würde Millionen kosten, wegen des nötigen Honigs, und je nachdem, wo man es realisierte, würde das ehemals so laute Auto früher oder später gänzlich unter einer dicken Schicht toter Insekten verschwinden.
Er erzählte niemandem von seinen Kunstideen. Sie entsprangen einem Ort tief in ihm, der noch von seinem inneren Kind beherrscht wurde. Dieses Kind, das nichts von Kunst oder anderen möglichen Anwendungen der Freiheit verstand, aber nach Liebe und Akzeptanz im Austausch für seine Aggression und seinen Hass gierte, fürchtete, dass die Menschen über seine Ideen lachen und sie stehlen könnten. Umgekehrt fand der erwachsene Demian – der die vielen begabten Künstler, die er kannte, offen bewunderte und Wichtigtuern mit offener Skepsis gegenübertrat, der mit seinem Status als dekorativem Anhängsel gut leben konnte – die Ideen des Kindes einfallslos.
II
Seine Tochter Nicole, fünfzehn Jahre alt, manövrierte vorsichtig zwischen einer Schlange geparkter Autos und einer von solchen hindurch, die noch auf Parkplatzsuche waren. Sie suchte Augenkontakt mit einem weiteren Fahrer, doch auch der schüttelte nur den Kopf. Jetzt präsentierte sie sich schon seit ganzen acht Minuten, doch bisher hatte niemand für sie angehalten. Im Gegenteil, immer wenn sie sich einer Beifahrertür näherte, trat der Fahrer aufs Gas, fuhr so dicht wie möglich an das Auto vor ihm heran und machte ein unbeteiligtes oder sogar offen feindliches Gesicht.
Sie trug ein Kleid, das ihr bis zu den Waden reichte, und eine Leidensmiene. Die feuchte Kälte der heraufziehenden Nacht schien aus allen Richtungen zugleich anzugreifen, sie wellte ihr Haar, verschmierte ihr Make-up, ließ das Kleid wie Latex an ihr kleben. Sie hörte einen Signalton, eine Message auf ihrem Telefon. Einen Moment lang ignorierte sie ihn. Sie hatte das leise Gefühl, dass sie es hätte ausschalten sollen, es konnte ihr ja jemand nachspionieren. Dann überlegte sie es sich anders, drehte sich mit gesenktem Kopf um und las die Nachricht ihrer Mutter in der schmalen Lücke zwischen zwei SUV. «Bin zurück bevor es dunkel wird», schrieb sie als Antwort.
Sie steckte ihr Telefon ein und blickte auf. Ein Mann auf dem Gehsteig sah sie direkt an, er schien interessiert. Ein gedrungener Glatzkopf in schlabbriger Hose und Nylon-Bomberjacke, die sich pilzförmig um seinen Bauch wölbte. Es war ihr erster vielversprechender Kontakt, seitdem ihr Versuch, auf den Strich zu gehen, zehn Minuten zuvor begonnen hatte.
Sie grinste und präsentierte wieder diese unfreiwillige Leidensmiene mit vor Angst funkelnden Augen.
«Hau ab», sagte der Mann. «Verpiss dich! Weg!» Ein Mädchen mit gräulicher Haut, rundem Gesicht und der Jahreszeit unangemessenen kniefreien Skinny Jeans kam von der anderen Straßenseite dazu, um ähnliche Aussagen zu treffen. Eine weitere junge Frau in fransigem weißem Minirock, der zu ihrem strohigen Haar passte, und mit fleckigem Spray-Tan anstelle einer Strumpfhose, trat hinter einem Lieferwagen hervor, stakste steif auf Nicole zu und bot an, ihr das Gesicht aufzuschlitzen.
Die drei unfreundlichen Menschen ließen ihre Nervosität um eine weitere Stufe ansteigen, und so tat sie das einzig Vernünftige und lief auf die befahrene Straße. Der Fahrer, dem sie den Weg versperrte, hatte gerade Gas gegeben. Er trat auf die Bremse und starrte sie böse an, doch sie stützte sich, ohne ihn zu beachten, bloß für einen Moment auf seine Kühlerhaube und hinterließ einen Handabdruck aus kaltem Schweiß – ein säuberlicher Umriss ihrer Hand, von durchsichtigen Tröpfchen eingefasst. «Schwuchtel!», brüllte er. Sie trat links um das Auto herum und ging schwankend die Kurfürstenstraße Richtung Westen entlang, den Kopf erhoben, die Augen panisch vor Angst.
Es war schwer zu sagen – vor allem für sie selbst –, was zur Hölle sie hier eigentlich tat. Die Logik, die sie hergeführt hatte, ließ sich leicht zusammenfassen. Sie wollte ehrliche Antworten. Sie hatte schon ein paar Freundinnen gefragt, ob sie als Mädchen durchgehen könnte. Doch ihr sofortiges «Ja!» war natürlich nicht ernst zu nehmen. Das hatten sie schon behauptet, als sich Nicoles modische Experimente noch auf weit ausgeschnittene T-Shirts und Sandalen mit schmaleren Riemchen beschränkten. Ihre Eltern unterstützten sie ebenfalls zu einhundert Prozent. Jeder schmeichelte ihr, schützte und schonte sie. Aber es war sinnlos. Denn wenn sie in den Spiegel sah, empfand sie Körperdysphorie. Darum ging es doch! Sie war nicht in Ordnung, wie sie war, und schon gar nicht schön! Deshalb mussten ihre Eltern endlich mal in die Gänge kommen und ihr Pubertätsblocker erlauben, bevor sie noch älter wurde!
Aber würden die überhaupt wirken? Würde sie jemals schön sein? Wer würde ihr die Wahrheit sagen, über ihr Gesicht, ihre Hände, ihre Fesseln – ihre Knochen?
Die offensichtliche Antwort: Wildfremde. Fremde mit Hang zum Arschlochsein. Heteromänner.
Nicht gerade Männer in irgendeiner dunklen Kneipe, die ihr hinterherlaufen würden, um sie draußen zusammenzuschlagen. Sie wollte spontane Reaktionen von ausgewiesenen Frauenhelden, an einem belebten, öffentlichen Ort, wo sie sich sicher fühlte. Und was war schon dabei, sich für ein paar Minuten auf der Kurfürstenstraße als Stricherin auszugeben?
So hatte sie es sich jedenfalls gedacht – dass es einfach sein würde.
Als sie sich die Situation ausgemalt hatte, sah sie keine Probleme. Eine kurze Tour über den Laufsteg und für jeden Typen, der ihr hinterherpfiff, gäbe es einen Punkt. Wie sie sich dabei fühlen würde, hatte sie allerdings ganz falsch eingeschätzt.
Sie hatte ein glitzerndes schwarzes Stretchkleid aus Polyester angezogen, mit silbernen Metallfäden und einem paillettenbesetzten Ausschnitt. Ein Kleid, wie sie zu Tausenden für Silvesterpartys produziert werden, um nach einmaligem Gebrauch weggeworfen zu werden. Sie hatte es einen Monat zuvor in einem Kaufhaus erstanden (einem freundlichen, in dem jeder alles anprobieren durfte, und das Damenschuhe in Größe dreiundvierzig führte), um achtzig Prozent reduziert. Die Stiefel waren ihre allerersten mit Absatz – nicht billig, aber weil sie keine Erfahrung in diesen Dingen hatte, hatte sie welche mit stählernen Gelenkfedern bis in die Absätze genommen, bei denen jeder Schritt auf Beton wie ein Glockenschlag hallte, und dazu mit Sohlen aus glattem, hartem Leder.
Sie hatte die Sachen gekauft, weil Harriet weder ein Kleid noch ein einziges Paar hochhackige Schuhe besaß. Sie hatte die Wäscheschublade ihrer Mutter durchsucht und dort nicht, wie erhofft, ein Geheimversteck mit sexy Dessous entdeckt, sondern nur eine ungeordnete Masse Sport-BHs und Slips aus Baumwolle, im selben tristen Schwarz wie der Rest ihrer Kleider. In ihrem Badezimmerschrank gab es kein Make-up, keine Kosmetika, kein Parfüm, sie wusch sich das Gesicht beim Duschen mit verdünnter Handseife. Die beiden hatten harte Worte ausgetauscht, wobei Harriet – die sich aus den Fängen einer Sekte befreit hatte, in der lange Kleider und weiße Hauben vorgeschrieben waren, um in einem von Männern dominierten Berufsfeld Stärke zu beweisen – ihre Verachtung für die Idee artikulierte, dass Verhaltensänderungen nötig seien, um eine Frau zu werden. Sie selbst war alles andere als transfeindlich, aber auf eine Weise, die ihre Tochter unendlich nervte: Sie akzeptierte sofort, dass sie beide weiblich waren, und tat es mit einem gelangweilten Schulterzucken ab.
Manche ihrer Freundinnen behaupteten, ihre Mutter sei Autistin, andere fanden sie einfach nur peinlich – ein unterdrückter Trans-Mann, der aus Selbsthass seine Identität leugnete. Nicole wusste aber, wenn es nach Harriet gegangen wäre, hätte sie die Hormontherapie schon im letzten Jahr beginnen können. Die Schuld an ihrer verzögerten Umwandlung lag ganz allein bei ihrem Vater. Sie hätte jetzt schon Ansätze von Brüsten haben können, anstatt des klebrig-kalten Gummibusenpaars, das ihr Push-up-BH in ein schief sitzendes Desaster verwandelte. Schon seit Monaten war sie aus Protest ohne BH herumgelaufen und hatte sich darauf konzentriert, ihre Stimme und ihre Bewegungen zu modulieren und ihre Gesäßmuskulatur in Form zu bringen.
Sie hatte das Laufen zu Hause geübt, kreuz und quer durch die weiträumige Wohnung, die Treppe rauf und runter, bis sie fand, dass sie es ganz gut hinkriegte. Der Straßenbelag war allerdings uneben, der Asphalt leicht wellig und an vielen Stellen geflickt. Und die Strecke war um Größenordnungen weiter als alles, woran sie sich zu Hause gewagt hatte. Ihre Zehen pochten, und ihre Wadenmuskeln schmerzten. Sie trat auf den Gehsteig. Die Straße war noch immer voller Autos. Sie suchte den Blickkontakt mit den Fahrern, doch die wandten sich ab. Ihr dämmerte, dass sie vielleicht gar nicht nach menschlicher Wärme suchten, sondern bloß nach einem Parkplatz.
Irgendwann – sie konnte nicht sagen, wo genau – hatte sie den Straßenstrich hinter sich gelassen. Wenn eine Straße von niemandem genutzt wurde, war dieses Revier dann noch zu haben, oder bloß irrelevant?
Wenigstens konnte sie ihrem Misserfolg nachträglich die Peinlichkeit nehmen und behaupten, sie habe nur in ihren Stiefeln laufen üben wollen. Sie beschloss, die Kurfürstenstraße bis zum Ende entlangzugehen und am Bahnhof Zoo die S7 zu nehmen. Neben anderen Dingen musste sie die schwer auf ihr lastende überschüssige Energie loswerden. Die Vorstellung, von all den Pendlern am Bahnhof gesehen zu werden, ließ ihren Kopf vor halbekstatischer Ambivalenz schwirren. Cross-Dressing war wie ein Teller gebratenes Hirn für einen verhungernden Vegetarier. Es war nicht das, was sie brauchte. Aber es hatte unbezweifelbar etwas mit dem zu tun, was sie brauchte.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte ihrer Identitätssuche noch ein greifbares Ziel gefehlt. Sie war in ihrem Kopf umhergeschwirrt, war immer wieder ungebeten aufgetaucht, plötzlich und sengend wie eine Sonneneruption. Euphorie wechselte sich mit tränenersticktem Selbsthass ab, und ein spielerisch-erotisches Was-wäre-Wenn mit tiefem Ekel. Suchend beobachtete sie Frauen und Mädchen, verzweifelt nach Antworten Ausschau haltend. Lag die Antwort in der Performance, oder lag sie im weiblichen Fleisch? Gab es überhaupt etwas Schlimmeres als weibliches Fleisch, wenn es nicht mehr performte? Heimlich beobachtete sie Männer und Jungs, voller Sorge, missverstanden zu werden. Sie hatte sich die Augenbrauen gezupft, die Beine rasiert und am nächsten Morgen Fieber vorgetäuscht, um nicht in die Schule zu müssen. Sie hatte pinken Nagellack aufgetragen und mit Nagellackentferner wieder abgerieben. Doch die Verpflichtung, die Umwandlung auch nach außen hin zu vollziehen, war unmissverständlich. Du kannst dich nicht zurücklehnen, dir in aller Ruhe über alles klar werden, und erwarten, bei Bedarf sofort Hormone und eine OP zu bekommen. Wenn sie wollte, dass ihr Körper korrigiert wurde, musste sie etwas dafür tun. Es machte ihr Sorgen, dass sie im Schlaf noch immer männlich war. Ihre Therapeutin versicherte ihr aber, dass die Morgenlatte eine Funktion für werdende Mädchen erfüllte, als innerer Dilatator, der ihre zukünftige Neovagina auf eine brauchbare Größe brachte. Das verwirrte sie nicht im Geringsten, nachdem sie die auf links gedrehte Dilatation als Metapher für ihr gesamtes Leben akzeptiert hatte.
Während sie Richtung Westen ging, verbreiterte sich die Straße zu einem Boulevard. Hier waren nur noch wenige Fußgänger unterwegs, wofür sie dankbar war. Unter dem zu engen Tucking-Höschen aus einem Online-Geschäft juckten ihre Eier. Sie hatte nicht das Gefühl, außerhalb ihres Körpers zu sein – im Gegenteil –, doch es fiel ihr trotzdem schwer, ihre eigene Perspektive beizubehalten, durch ihre eigenen Augen auf die Welt zu blicken. Sie fühlte sich beobachtet und ausgehöhlt. In ihrem Partykleid und mit scharlachrotem Schmollmund wurde ihr an diesem Dienstagnachmittag allmählich klar, dass Outfits, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, besser Situationen vorbehalten bleiben, in denen es viele Ablenkungen gibt und man um Aufmerksamkeit zu ringen hat, wie zum Beispiel Nachtclubs. Die Umgebung hier bestand aus grauen Betongehsteigen mit granitenen Bordsteinkanten und daran angrenzend Asphalt in dunkleren Grautönen, grauen, mit Schwarz durchsetzten Bäumen und aschfarbenen Fassaden. Ihr sensibles, schmerzendes Fleisch mit seinen spröden, roten Highlights war wie eine klaffende Wunde, die sich auf spitze Füße gehievt hatte und jetzt durch die Gegend torkelte. Ihr Gesicht war ein Portal, das Schmerz in eine unbelebte Welt entließ, und mit jedem Schritt rutschte ihr Kleid weiter nach oben, kletterte ihre Strumpfhose hinauf wie ein Holzfäller einen Baum. Das Kleid war nicht gefüttert, und sie hatte nicht daran gedacht – wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen –, ein Unterkleid anzuziehen. Es stieg immer weiter, während der Schritt ihrer Strumpfhose Richtung Knie nach unten wanderte. Die öffentliche Demütigung war nachgerade perfekt.
Sie starrte hinab, wie ein Kind, das versucht, nicht auf die Ritzen zu treten, und wühlte sich durch mehrere Schichten Stoff. Sie blieb stehen und drehte sich, damit ihr der Wind nicht mehr ins Gesicht blies. Nach einem letzten flüchtigen, vergeblichen Zerren an ihrer Unterwäsche merkte sie, wie sie fror. Sie kapitulierte und knöpfte ihren Wollmantel zu, so, dass das Kleid darunter versteckt war. Es war der längste Mantel, den sie besaß – ein übergroßes Überbleibsel vom letzten Jahr, aus dunkelblauem Tweed, mit Raglan-Ärmeln und ihrem Deadname in schwarzem Filzstift auf dem blassblauen Futter des Kragens. Im Schutz, den der Mantel ihr bot, lüftete sie den Saum des Kleides bis zur Hüfte, rückte sich die Unterwäsche zurecht und zog die Strumpfhose hoch. Nichts davon war diskret. Sie war, entschied sie, auf authentische Weise das totale Chaos. Sie wünschte sich, ihre Freundinnen könnten sie sehen, holte ihr Telefon hervor und machte kokett ein Victory-Zeichen, während sie eine Reihe Selfies knipste, die sie dann stirnrunzelnd und mit hängenden Schultern wieder löschte. Sie drehte sich um 360 Grad, um zu sehen, ob jemand sie beobachtet hatte. Wieder sah sie einen Mann, der ihr schon ein paar Straßen zuvor aufgefallen war.
Entweder spazierte er gerade arglos in ähnlichem Tempo die Kurfürstenstraße entlang Richtung Bahnhof Zoo, oder er folgte ihr und beobachtete sie; sie war sich nicht sicher. Er trug eine kastanienbraune Fleecejacke unter einem schwarzen Anorak, dazu Jeans und Turnschuhe. Sein Bürstenschnitt war grau meliert, die Augen hinter den horizontalen Balken einer eckigen Sonnenbrille verborgen, sein Mund von einem struppigen Schnurrbart halb verdeckt.
Sie ging ein paar Schritte, blieb stehen, und sah, wie er sich einem Schaufenster zuwandte, das er interessiert betrachtete. Weil sie gerade selbst an dem Geschäft vorbeigekommen war, wusste sie, dass es sich um eine Autovermietung handelte – keine Auslage, für die Leute normalerweise anhalten. Sie ging weiter und drehte sich noch zweimal um. Er schien noch immer gefesselt von Autopostern.
Ein Mann, der sich nach der Arbeit nach einem neuen Fahrzeug umsah – warum nicht. Sie verschränkte die Arme eng vor der Brust und stapfte schmerzerfüllt auf den Bahnhof Zoo zu. Ihre Hacken klackerten rhythmisch zum Lärm des Feierabendverkehrs.
III
Toto verließ seine Hinterhofwohnung in der Grolmannstraße in Charlottenburg früher als nötig, damit sein Spaziergang zum InterConti besonders unanstrengend verlief. Er hatte sogar vor, für zwei Stationen die U-Bahn zu nehmen, von Uhlandstraße bis Wittenbergplatz, um ganz sicherzugehen, dass er nicht verschwitzt ankam.
Eine ungewöhnliche Nervosität hatte ihn erfasst. Genau wie seinem Freund Demian war es ihm wichtig, das Richtige anzuziehen. Allerdings lebte er allein. Um zu prüfen, ob nicht seine Krawatte hinten unter seinem Kragen hervorragte, hatte er seinen Rasierspiegel benutzt. Anstelle einer Frau, die ihm sagte, ein gemustertes Hemd sei wunderbar, hatte er die Stimmen seines Gewissens und der Eitelkeit gehört, die Demians Bemerkung wiederholten, dass ihre Gastgeber Royals waren – von der altmodischen Sorte, eine Herrscherfamilie mit eigenem Land – und dass er eine Prinzessin treffen werde. Es war ihm nicht gelungen, die Seidenkrawatte zu binden, also hatte er sie wieder abgenommen. Er hatte es mit einer Bolokrawatte aus dem Besitz seines Vaters versucht, das dann aber verworfen. Er hatte zwei Knöpfe offen gelassen, in den Spiegel gesehen und die Stirn gerunzelt. Dann hatte er sein Hemd bis oben zugeknöpft und war zu dem Schluss gekommen, dass er so zwar nicht toll aussah, ihm aber niemand den guten Willen absprechen konnte.
Demians Einladung war zwei Wochen zuvor gekommen, ein kostenloses Michelin-Stern-prämiertes Essen im Austausch dafür, sich eine einstündige Literaturpreisverleihung anzutun. Toto war nicht ganz klar, ob die Royals wussten, dass er anwesend sein würde. «Die Prinzessin hat Masud angefleht, noch ein paar weitere Leute zu finden», hatte Demian geschrieben. «Sie dachte, sie hat Freunde, aber sie hat nur zwanzig Rückmeldungen bekommen, und es soll ein Essen für achtzig sein!»
In der Theorie war der Februar der Höhepunkt der Gesellschaftssaison, eine Zeit, in der die Menschen, von denen sie hoffte, dass sie zu ihrem Essen kämen, in der Stadt sein würden, um zu arbeiten, um Partys zu schmeißen, Projekte einzuschätzen, die Sitze in den Opernhäusern zu besetzen, gegenseitig ihre Gesetzesvorlagen zu lesen und das Land am Laufen zu halten, doch es war nicht einfacher, sie zu fassen zu kriegen, als zu jeder anderen Zeit. Die Leute mussten ja unbedingt Ski fahren, in der Sonne liegen, in Übersee unterrichten und an Konferenzen und Gipfeln teilnehmen, ausnahmslos in deutlich lieblicheren Gefilden. Im weiteren Verlauf des Jahres würde das Verhältnis von Oberschicht-Berlinern zur Anzahl ihrer Wohnungen weiter sinken, bis es im August gegen null ging, doch im Verlauf eines Jahreszyklus schien es nur selten – so empfand Toto es – über eins zu vier zu liegen. Das Phantom des kulturellen Prestiges war, so kam es ihm vor, doch ein Herdentier.
Wie Harriet war auch er kein Deutscher. Ursprünglich aus Nord-Texas stammend, hatte er einen BA in klassischer Archäologie mit Nebenfach Schlagzeug an der Texas Tech absolviert und nach nur drei Jahren mit neunzehn seinen Abschluss gemacht. Nach seiner letzten Sommergrabung in Baalbek, wo die Sonne ihm durch die dunklen T-Shirts hindurch Blasen auf den Rücken brannte, war er über Amsterdam nach Hause geflogen. Dort hatte er eine deutsche Touristin kennengelernt. Im Herbst war er dann mit einem Studenten-Visum zu ihr nach Berlin gezogen und hatte sich an der Freien Universität eingeschrieben, die tief in der Wildnis von Dahlem lag.
Wie hatte er das Berlin der Achtziger geliebt, besonders die Mauer. Seine niedrigen Erwartungen an Urbanität hatten sich in Dallas-Fort Worth herausgebildet, einer Megacity, deren Teile ineinander übergingen und sogar in den Zentren ausfransten. Durch eine Freundin hatte er den ungeordneten Großraum Chicago kennengelernt, der immerhin an einen furchteinflößenden See grenzte. Trotzdem wurde hier nie eine kritische Masse an innerstädtischer Konzentration erreicht. Im Rahmen ausgedehnter Zwischenstopps entdeckte er, dass New York ansprechend verdichtet war, genau wie London. Doch beide Metropolen zerflossen ins Umland, und jeden Tag fielen die Vorstädter in die City ein. Einzig Westberlin bot die ideale Kombination aus offenem Raum und unüberwindbaren Grenzen.
Auf der westlichen Seite der Mauer war noch einige Meter tief ostdeutsches Hoheitsgebiet, und an manchen Stellen – wie am Potsdamer Platz – reichte es noch viel weiter in den Westen. Diese Nähe erfüllte ihn mit einem unbeschreiblichen Gefühl von Freiheit. Der Kalte Krieg war überlebensgroß, drohte immerzu, die Menschheit zu zerstören und den Planeten in einen nuklearen Winter zu stürzen. Die Supermächte standen sich entlang eines Spalts gegenüber, der vor Waffen starrte. Doch im Schatten dieses Spalts gab es einen mäandernden Streifen Niemandsland, auf dem er Fahrrad fahren konnte. Die sozialistische Stadt auf der anderen Seite war ein Paradies für Schnäppchenjäger. Gebrauchsgüter wie Spülmittel oder Farbe waren merkwürdig ineffektiv, aber so billig, dass er Monate brauchte, eine Liste zusammenzustellen, um die fünfundzwanzig Mark aufzubrauchen, die er bei jedem Besuch tauschen musste. Unterhemden aus dem Reich des Bösen zu tragen, fand er aufregend. Die Berliner Mischung aus Sicherheit und Armut schien ihm einmalig auf der Welt.
Seine Erfahrung war begrenzt. Er hatte Amsterdam gesehen, aber nicht Barcelona, und die Nordsee statt der Ägäis. Wäre er auch dann in Berlin geblieben, wenn er die Preise für harten Alkohol – von Vier-Gänge-Menüs samt Wein ganz zu schweigen – im postfaschistischen Spanien oder Griechenland gekannt hätte?
Er fühlte sich zu schnell zu Haus. Weil er groß gewachsen war, mit blondem Haar und rosafarbener Haut, wurde er vom ersten Tag an überall als Deutscher wahrgenommen. Fälle und Geschlechter beachtete er gar nicht erst, und so sprach er schon bald ein nicht mehr zu korrigierendes Pidgin: schnell, flüssig und den Ohren der gebildeten Deutschen ein unfassbarer Gräuel. Es wurde nicht besser dadurch, dass man lieber mit ihm Englisch sprach.
In jenen Zeiten kamen seine Eltern und seine jüngere Schwester ihn besuchen, statt er sie. Sie trafen sich in den Bayerischen Alpen, wo sein Vater in der U.S. Army gedient hatte. Von diesen lukrativen Treffen abgesehen, bei denen er zum Essen eingeladen wurde und Geldgeschenke bekam, blieb er arm. Als antriebsloser Musiker, der niemals übte, der nicht einmal ein eigenes Instrument besaß, war er nicht dafür qualifiziert, für Sessions oder Auftritte gebucht zu werden. Er hatte seine Kurse in Lubbock, Texas, bestanden, wo Präzision und Geduld wichtiger waren als Geschwindigkeit – neuere Klassikstücke verlangten typischerweise, dass er zwanzig Minuten lang regungslos dastand, um dann zweimal auf eine Glocke zu schlagen –, doch hatte er sich nie die Mühe gemacht, ein Instrument wirklich zu beherrschen. Er lehnte es ab, als Barkeeper zu arbeiten, genau wie alle anderen Jugendkultur-/Szene-Jobs, bei denen er mit offenen Flaschen Alkohol in einem Raum sein musste. Dafür kannte er sich selbst zu gut. Tagsüber arbeitete er in einem Lagerhaus in Kreuzberg, wo er Kartons und Holzkisten fertig machte und die von den Kunden bestellten Fahrzeug- und Maschinenbauteile in Holzwolle oder Schaumstoffpolster bettete.