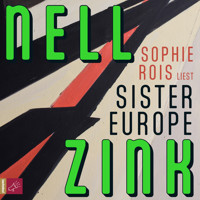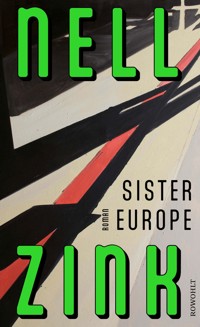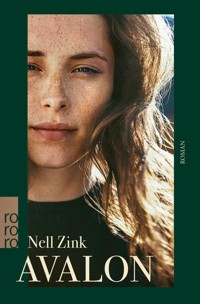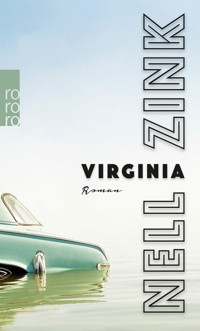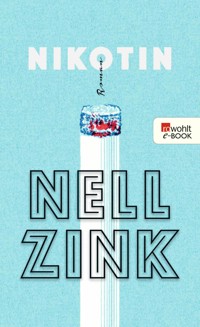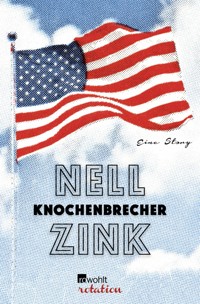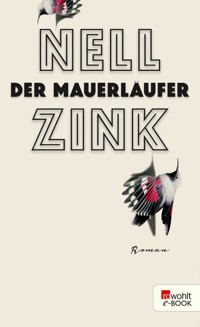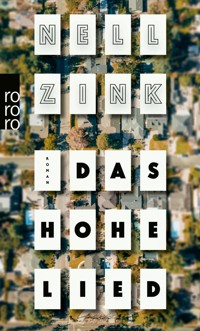
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pam, Daniel und Joe sind die wahrscheinlich schlechteste Indie-Rock-Band auf der Lower East Side. Doch dann widerfahren ihnen zwei Wunder - eine Tochter für Pam und Daniel, eine überraschende Hit-Single für Joe. Zusammen kämpfen sich die drei durch die ausgehenden Neunziger, teilen sich ihre wachsenden Erfolge, arbeiten zusammen, um Joe zum Superstar zu machen und der kleinen Flora eine glückliche Kindheit zu bescheren. Doch am 11. September 2001 fällt der terroristische Angriff auf die Stadt mit einem vernichtenden persönlichen Verlust für das Trio zusammen. Danach wächst Flora in einer stark veränderten, zunehmend gespannten politischen Großwetterlage heran. Sie beginnt sich für Umweltthemen zu engagieren und die sich weitende Kluft zwischen der politischen Klasse und dem einfachen Bürger zu überbrücken. Doch als das junge Jahrhundert mit der Kandidatur von Donald Trump eine weitere neue Bedrohung erfährt, sieht sich ihre Familie gezwungen, längst verloren geglaubte Kräfte zu mobilisieren. «Das Hohe Lied» ist zugleich ein epischer, drei Generationen umspannender Familienroman, ein schonungsloses Gesellschaftsporträt der USA heute und, vor allem anderen, eine anrührende Beschwörung dessen, was im Menschen gut ist und ihn im Leben vorantreibt. Das Buch der Stunde, von einer der scharfsinnigsten US-Autorinnen der Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Nell Zink
Das Hohe Lied
Roman
Über dieses Buch
Pam, Daniel und Joe sind die wahrscheinlich schlechteste Indie-Rock-Band auf der Lower East Side. Doch dann widerfahren ihnen zwei Wunder – eine Tochter für Pam und Daniel, eine überraschende Hit-Single für Joe. Zusammen kämpfen sich die drei durch die ausgehenden Neunziger, teilen sich ihre wachsenden Erfolge, arbeiten zusammen, um Joe zum Superstar zu machen und der kleinen Flora eine glückliche Kindheit zu bescheren. Doch am 11. September 2001 fällt der terroristische Angriff auf die Stadt mit einem vernichtenden persönlichen Verlust für das Trio zusammen.
Danach wächst Flora in einer stark veränderten, zunehmend gespannten politischen Großwetterlage heran. Sie beginnt sich für Umweltthemen zu engagieren und die sich weitende Kluft zwischen der politischen Klasse und dem einfachen Bürger zu überbrücken. Doch als das junge Jahrhundert mit der Kandidatur von Donald Trump eine weitere neue Bedrohung erfährt, sieht sich ihre Familie gezwungen, längst verloren geglaubte Kräfte zu mobilisieren.
«Das Hohe Lied» ist zugleich ein epischer, drei Generationen umspannender Familienroman, ein schonungsloses Gesellschaftsporträt der USA heute und, vor allem anderen, eine anrührende Beschwörung dessen, was im Menschen gut ist und ihn im Leben vorantreibt. Das Buch der Stunde, von einer der scharfsinnigsten US-Autorinnen der Gegenwart.
Vita
Nell Zink, 1964 in Kalifornien geboren, wuchs im ländlichen Virginia auf. Sie studierte am College of William and Mary Philosophie und wurde, später im Leben, in Medienwissenschaft an der Universität Tübingen promoviert. Mit ihrem 2019 erschienenen Roman «Virginia» war sie für den National Book Award nominiert. Sie lebt in Bad Belzig, südlich von Berlin.
Tobias Schnettler lebt als Übersetzer in Frankfurt am Main. Unter anderem hat er Bücher von Garth Risk Hallberg und Andrew Sean Greer übersetzt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel «Doxology» bei Ecco Press, Harper Collins, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Doxology» Copyright © 2019 by Nell Zink
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt,
nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Ryan Herron/iStock
ISBN 978-3-644-00246-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Justin Taylors Katze Emma
Danksagung
Ich danke dem Nederlands Letterenfonds für ein sechswöchiges Stipendium in Amsterdam und dem Borris House Festival of Writing & Ideas (Irland) sowie dem LitLink Festival (Kroatien) für Auftritte, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Wie immer danke ich meiner wunderbaren Agentin, Susan Golomb, und meiner großartigen Lektorin, Megan Lynch.
I.
Ohne dass es jemand wusste, litt Joe Harris zeit seines Lebens an einem hochfunktionalen Williams-Syndrom. Er wies den typischen breiten Mund auf, die sternförmige Iris, die gestörte räumliche Wahrnehmung, die Extroversion in Gesellschaft, die Angewohnheit, immerzu Geschichten zu erzählen, den Herzfehler und die musikalische Begabung. Bis zu seinem Tod hatte er nicht mehr Falten als eine Actionfigur. Er wurde nie auf das Syndrom getestet, weil die geistige Behinderung, die als das entscheidende Merkmal galt, bei ihm nicht vorhanden war. Doch sein Talent, andere zu irritieren, war schier grenzenlos. Er sagte immer, was er dachte, und vertraute jedem, den er traf.
Zum Beispiel spazierte er einmal mit seiner Freundin Pam durch den Washington Square Park, als einer dieser älteren Männer von der Sorte, die vielleicht erst vierzig ist, auf sie zukam und sie bat, kurz mal seinen Asthma-Inhalator zu halten. Pam ging augenrollend weiter, doch Joe hielt die Hand hin, in die der Inhalator sogleich mit so viel Kraft gedrückt wurde, dass er zu Boden fiel und in zwei Teile zerbrach. Der Mann erklärte, es werde Joe fünfzehn Dollar kosten, den kaputten Inhalator zu ersetzen.
Joe erwiderte: «Ich habe keine fünfzehn Dollar dabei. Aber Sie könnten mit zu meiner Arbeit kommen! An den meisten Tagen verdiene ich mehr als das. Gestern zum Beispiel habe ich viel mehr verdient. Und wissen Sie, was ich gestern noch gemacht habe? Bestimmt eine Million Papierservietten mittig gefaltet! Nach meiner Schicht kann ich Ihnen so viel Geld geben, wie Sie brauchen. Ist nur knappe anderthalb Kilometer entfernt von hier. Ich kann Ihnen auch Kuchen umsonst geben, falls wir noch alten Kuchen haben. Bin gerade unterwegs dorthin.» Er berührte den Mann am Arm. Der Mann brüllte, Topfschnitt-Schwuchteln sollten bloß die Finger von ihm lassen, und rannte davon. Joe hob den Inhalator auf und rief: «Sie haben Ihr Dingsda vergessen!»
Sein Vater unterrichtete als Professor für amerikanische Geschichte an der Columbia University. Seine Mutter war ein ewig-junges und permanent überdrehtes Partygirl gewesen, das die ganze Nacht durchtrinken, jedes Lied singen, die Klavierbegleitung dazu faken und sich mit jedem über alles unterhalten konnte. Sie fiel 1976, während sie lachend einen Hang hinauflief, bei einem Picknick des Fachbereichs in Wave Hill tot um. Die Studenten gaben vor, es tue ihnen schrecklich leid, während ihr Ehemann vorgab, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Joe hielt ihre Hand und sagte: «Tschüs, Mommy!» Er war erst acht.
Bei der Trauerfeier in der Cathedral of Saint John the Divine klatschte Joe während des synkopischen Teils des Lobpreises in die Hände und hob dann bei «des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes» bedeutungsvoll die Stimme. Professor Harris verstand sofort, dass die Heilige Familie damit neu definiert worden war als Abbild ihrer eigenen. Der Junge plauderte sich durch den Empfang und erzählte die lustigsten Geschichten, die sie mit Mom erlebt hatten. Die Erwachsenen tätschelten ihm den Kopf und blickten einander vielsagend an. In ihren Augen war Joe nicht einfach nur klug für sein Alter. Sie hatten genaue Vorstellungen davon, was mit ihm zu tun sei, und meist ging es dabei um irgendein Internat auf einem anderen Kontinent. Sie machten sich Sorgen, sein Dad würde vielleicht keine neue Frau finden.
Professor Harris änderte gar nichts, der Theorie folgend, dass es Joe, den er liebte, weniger schmerzen würde, wenn sich nichts änderte.
Als Sohn eines Universitätslehrers wurde Joe an der staatlichen Schule durchgewunken. Noch vor seinem Abschluss fing er an, im Abyssinian Coffee Shop in der Fourteenth Street zu kellnern. Es war ein kleines, altmodisches Diner mit einer Kassiererin vorne und einem Hilfskoch hinten. Er musste sich nichts merken außer einfachen Codes wie «R» für Rührei und «P» für Pfannkuchen. Die Tagesangebote waren die ewig gleichen Kombinationen, und er hatte nie mit Geld zu tun, außer wenn er sein Trinkgeld einsteckte. Die meisten Gäste gaben ihm einen Dollar für ein Mittagessen oder Frühstück, einen Vierteldollar für einen Kaffee und zwei Dollar für ein Abendessen. Sie waren großzügig, weil er wie vierzehn aussah. Sie dachten, er spare fürs College. Der Geschäftsführer mochte ihn, weil er gut fürs Geschäft war und Pommes und Limonade auf eine Weise anpries, dass sie unendlich verlockender klangen als Chips und Leitungswasser. Außerdem klaute er nicht.
Mit dem Trinkgeld in der Tasche fühlte er sich reich. Er hatte das Glück, als Naivling in einer Zeit im Village unterwegs zu sein, als es dort nicht viele Möglichkeiten gab, sein Geld auszugeben. Dealer und Zuhälter prallten an seiner Geschwätzigkeit ab. Er fürchtete sich vor lauten Geräuschen und sich schnell bewegenden Objekten. Nie fuhr er U-Bahn oder ging bei Rot über die Straße. Bei Menschen funktionierten seine Selbstschutzmechanismen nicht, aber vor Fahrzeugen – wie auch vor der gefährlichen Untergruppe von Personen, die zugleich laut waren und sich schnell bewegten – hatte er einen solchen Respekt, dass er alles in allem sicherer durch New York lief, als es ein normaler Mensch gekonnt hätte.
Kurz nach dem Tod seiner Mutter fing er an, Ukulele zu spielen. Als Teenager stieg er auf E-Bass um, weil der ebenfalls vier Saiten hatte und gut genug für Paul McCartney war. Zu seinem sechzehnten Geburtstag fuhr sein Vater mit ihm zu den Musikläden in die Forty-Eighth Street, wo er sich einen zitronengelben Music Man StingRay-Bass aussuchte. Zu Hause spielte er ihn ohne Verstärker zu Schallplatten und Radio. An Tagen, an denen er kein neues Lied hörte, das ihm gefiel, schrieb er ein eigenes. Dabei ging es ihm nicht um sich selbst. Es war ihm egal, wer die Lieder schrieb, solange es welche gab. Er sang seine Lieblingslieder auf der Straße, gestikulierend und lauter, als er eigentlich singen konnte. Seine Stimme war dröhnend und heiser, sie klang nach Mühsal, ließ überwundene Hindernisse erahnen, das Drama des Starruhms, den Künstler als Agonisten, was zum Teil ein Nebeneffekt dessen war, dass er gegen den allgemeinen Lärm und den Verkehr da draußen ansingen musste.
Als er einundzwanzig wurde, erhielt er Zugriff auf seinen Treuhandfonds. Das heißt, sein Vater konnte den Fonds von nun an für Joes Ausgaben anzapfen und ließ ihn aus ihrer zweigeschossigen Wohnung mit gedeckelter Miete im West-Village in eine Dreizimmerwohnung in einem unscheinbaren Gebäude in der Nineteenth Street umziehen, zwischen der Fifth und der Sixth Avenue. Sie teilten sich eine Putzfrau, die zugleich als Spionin agierte und Professor Harris versicherte, dass Joe sich vernünftig ernährte und seine Kleider wechselte. Mit einer eigenen Wohnung konnte er sich endlich einen Bassverstärker besorgen. Pam half ihm, die Kleinanzeigen und schwarzen Bretter zu durchforsten. Sie stieß auf eine passende Ampeg-Combo in Hell’s Kitchen, nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Er spielte am Klangregler des Music Man herum, blickte zum Verkäufer auf und brüllte über den Lärm hinweg: «Scheiß die Wand an! Ich wusste gar nicht, dass der Knopf da irgendwas macht!»
Pamela Bailey wurde ein Jahr nach Joe geboren, 1969. Sie wuchs als Einzelkind im Nordwesten von Washington, D.C., auf, zwischen dem National Zoo und der National Cathedral.
Ihre Mutter Ginger war Hausfrau und in ihrer Kirche – also der Kathedrale – sowie bei den Freunden der örtlichen Bibliothek aktiv. Sie hatte die, wie sie es nannte, «irische Empfängnisverhütung» praktiziert, indem sie erst nach ihrem Collegeabschluss heiratete, nicht davor. Im Allgemeinen mochte sie die Iren nicht besonders, aber sie räumte ein, dass sie die reichen Spitzengardineniren den armen Barackeniren à la Kennedy vorzog. Pams Vater Edgar war seit Jahren bei der Defense Logistics Agency in Anacostia angestellt. Als Jugendliche hatte Pam ihn unter Verdacht gehabt, in Vietnam Gräueltaten begangen zu haben. Er war unter anderem dafür verantwortlich gewesen, die amerikanischen Truppen dort mit Betonbausteinen zu versorgen. Zu ihrer Verteidigung ließ sich sagen, dass er tatsächlich wesentlichen Anteil daran gehabt hatte, die Invasion von Grenada zu ermöglichen, indem er den Transport von Ersatzreifen koordinierte.
Ginger und Edgar waren weiße angelsächsische Protestanten der post-calvinistischen Variante. Sie glaubten nicht an Vorbestimmung, aber sie verhielten sich so, als wäre sie geltendes Recht. Jedes Abweichen vom rechten Weg wurde als fatale Abkehr von dem einen Pfad zur Erlösung betrachtet. Ein oft zitierter Leitsatz lautete: «Wer an der Rute spart, verzieht sein Kind», obwohl sie ihn mit einer gewissen Ironie aussprachen, denn sie benutzten nie eine Rute, immer nur den Gürtel. Ähnlich ironisch sagten sie: «Kinder sollte man sehen, nicht hören.» Natürlich erwarteten sie von Pam, dass sie sich angemessen an einer Unterhaltung am Abendbrottisch beteiligen konnte. Vielleicht hätten sie noch ein weiteres Kind gebraucht, zum Üben.
Sie ging auf eine staatliche Schule und hatte nie viele Hausaufgaben auf. Sie spielte gerne mit Jungs. Mit neun entdeckte sie Dungeons & Dragons für sich. Mit zwölf entwickelte sie ein im Weltraum angesiedeltes Rollenspiel, das ihr 2000 Dollar einbrachte, als ihr Vater es in ihrem Namen an Atari verkaufte. Doch die Pubertät meinte es nicht gut mit ihr. Ihr rötliches Haar betonte die Pickel und die Sommersprossen. Ihre Freunde sprachen nicht mehr über Schwerter und Magie, sondern planten ihre Karriere bei den U.S. Army Rangers, wo sie Armbrüste aus Aluminium bekommen würden, die lautlos töten konnten. Ihr erwachender kritischer Geist ließ sie eine Welt voller Einschränkungen erkennen, wo sie mit Freiheiten gerechnet hatte. Die Seventies hatten sie glauben gemacht, als Erwachsene würden sie allgemeine Solidarität und LSD erwarten. Die Eighties traten aus einem Nebel von Konkurrenzdenken und Aids heraus. Zwischen ihrer Kindheit und ihrer Jugend lag die Kluft zwischen zwei Generationen.
Sie beschloss, Retro-Hippie-Erdmutter zu werden. Den Anfang machte sie mit einer schulfinanzierten weiblichen Freizeitaktivität, Modern Dance. Die Kursleiterin nutzte die Zeit, um Klassenarbeiten zu korrigieren. Ihre Schülerinnen standen vor der Fluchttür der Sporthalle und teilten sich Zigaretten. Beigebracht wurde ihnen nichts. Zum Auftritt am Ende des Schuljahres trug Pam einen schwarzen Bodysuit zur Strumpfhose und kroch zu Leo Kottkes Zwölf-Saiten-Version von «Eight Miles High» auf die Bühne. Eigentlich sollte sie zu Boden starren, doch sie hob den Blick, um zu sehen, ob ihre Eltern gerührt waren. Sie lasen in ihren Taschenbüchern.
Mit dreizehn entdeckte sie ein Rollenspiel mit größerem Einsatz. Ihre Figur: betrunkener Punk in einer zerbröckelnden, ethnisch getrennten, von Crack verseuchten Stadt.
Sie brach zu Abenteuern in Innenstadt-Bars auf. Türsteher ließen sie umsonst in Hardcore-Punk-Konzerte. Sie besaß einen fotolosen Führerschein aus West Virginia, auf dem stand, dass sie neunzehn war, damit sie bei einer Razzia nicht den Kopf hinhalten mussten, und mehr zählte für sie nicht. Erwachsene Männer mit Job und Geld gaben ihr Getränke aus, bis das grelle Licht der letzten Runde oder des Klos sichtbar machte, dass sie sogar für Kokain zu jung war. Um sich die Zeit zu vertreiben, bis die Metro wieder fuhr, verließ sie die Clubs in Begleitung von Jungs, die behaupteten, Drogen dabeizuhaben. Dann rauchte sie mit ihnen Crystal Meth oder Crack und nutzte den Energieschub für den Fußmarsch nach Hause.
Meistens lernte sie Jungs kennen, die sie nicht ausstehen konnte, und sah Bands, die sie nicht mochte. Sie war ständig so müde, dass sie, wenn ihr die Band auf der Bühne nicht gefiel, einfach den Kopf auf den Tisch legen und einschlafen konnte.
Die Band, die sie liebte, hieß Minor Threat. Sie hatten den Anspruch, «straight edge» zu sein, und jeglichen Drogen und zwanglosem Sex abgeschworen. Bevor sie ausging, um sich für Petting einen Rausch zu ertauschen, malte sie sich mit schwarzem Filzstift Xe auf die Handrücken, um zu zeigen, dass auch sie Teil der Straight-Edge-Bewegung war. Sie war belesen genug, um zu wissen, dass törichte Konsistenz die Plage aller Kleingeister ist. Sie hatte gesehen, was das Streben nach Integrität mit ihrem Vater und ihrer Mutter gemacht hatte. Von einem Job abhängig zu sein, der darin bestand, die Truppen zu versorgen, hatte sie zu faschistischen Kriegstreibern werden lassen, und wenn sie sie «Ich liebe dich» sagen hörte, machte sie das krank. Die Integrität von Minor Threat dagegen erregte sie, und sie hätte alles dafür gegeben, ihren Sänger Ian MacKaye «Ich liebe dich» sagen zu hören. Doch sie stand ihm nur ein einziges Mal gegenüber, und da bot sie ihm Sex an. Schließlich glaubte sie, das wäre das Kostbarste, was sie besaß. Als er sie ignorierte, begriff sie ihren Irrtum. Sex ist keine knappe Ressource. Mädchen, die Sex anbieten, gibt es wie Sterne am Himmel.
Indem die Punk-Bewegung sie lehrte, Originalität wertzuschätzen, eröffnete sie ihr den Weg ins Reich der Kunst. Wie sie sich danach sehnte, alles zu geben und schließlich dafür berühmt zu werden, etwas erschaffen zu haben, was es noch nie gab!
Im Sommer vor der zehnten Klasse gründete sie eine eigene Band, die Slinkies. Weil in einer Garage zu proben bedeutet hätte, dass jemand seine Eltern bat, das Auto rauszufahren, blieben sie in ihren Zimmern. Sie probten leise, auch wenn ihre Familien das anders sahen.
Beim ersten und letzten Auftritt der Slinkies, an einem Sonntagnachmittag im jüdischen Gemeindezentrum in Bethesda, stöpselten sie ihre Instrumente in die Anlage der zuvor aufgetretenen Band. Keiner von ihnen wusste, wozu ein Monitor diente. Sobald das Schlagzeug einsetzte, konnte Pam ihre Gitarre nicht mehr hören, also drehte sie den Lautstärkeregler der Gitarre hoch. Sie war noch immer nicht richtig zu hören, also drehte sie den Verstärker hoch. Sie sang, so laut sie konnte, und konnte auch das nicht hören. Die Bassistin hockte neben ihrem Verstärker und versuchte, sich selbst zu hören, und das Feedback muss gigantisch gewesen sein, doch niemand auf der Bühne konnte hören, was sie gerade spielte, nicht einmal sie selbst. In diesen prasselnden Tornado aus Lärm hinein grölte Pam mit der Stimme eines unmusikalischen Auktionators ihre Knittelverse über Sabotage. Der Saal leerte sich schnell, bis auf zwei Jungs in schwarzen Mänteln, die sich alle drei Lieder anhörten und anschließend behaupteten, die Slinkies würden glatt als Germs in ihrer Spätphase durchgehen. Das war nicht das, was sie hören wollte. Der Sänger der Germs, Darby Crash, hatte sich schon 1980 umgebracht, und somit hieß das, sie klangen nicht nach Avantgarde.
Ginger und Edgar waren würdevolle Leute, die nicht zum Brüllen neigten. Doch wenn sie unter der Woche morgens um halb sechs ohne ihren Rock ins Haus stolperte, kam ihr Vater nicht umhin, darauf zu schließen, dass sie die Schule schwänzen würde, und das trieb ihn zum Wahnsinn. Sobald er zur Arbeit gefahren war, brüllte ihre Mutter sie an und hörte erst wieder damit auf, wenn Pam zur Schule aufbrach. Manchmal, wenn niemand brüllte, vermisste Pam es und brüllte dann einfach selbst. Zwei Jahre lang gab es keine Unterhaltung in ihrem Haus, in der nicht gebrüllt wurde.
Ihr Vater entwickelte die unangenehme Angewohnheit, ihr mit dem Rauswurf zu drohen. Dann protestierte ihre Mutter, und er lenkte ein. Um die widersprüchliche Botschaft komplett zu machen, deutete sie an, die Verteidigung ihrer Tochter sei bloß ein Zeichen für ein Übermaß an mütterlicher Liebe, denn eigentlich verdiene Pam es wirklich, rausgeworfen zu werden. Keiner der Elternteile fand diese Drohung besonders hart. Keiner von ihnen meinte sie ernst, auch wenn sie erwarteten, dass Pam auszog, sobald sie achtzehn war. Die Kultur der weißen angelsächsischen Protestanten hatte ihren Ursprung in der Armut trostloser, feudalistisch geprägter Gegenden. Generationenübergreifende Solidarität war im Land der Angelsachsen, wo Bräute eine Aussteuer mitbringen und jüngere Söhne in entfernte Gebiete auswandern mussten, als wären sie Biber, nicht praktikabel gewesen. Pams Großeltern, die noch lebten, als sie klein war, wohnten in Florida und Arizona. Die in Florida schenkten ihr jedes Weihnachten zehn Dollar, die sie ausgeben durfte, wofür sie wollte. Die in Arizona besaßen einen Airstream-Wohnwagen mit einem Aufkleber, auf dem stand WIR VERPRASSEN DAS ERBE UNSERER KINDER.
Sie bewarb sich nicht an Unis. Stattdessen erklärte sie ihren Eltern in ihrem vorletzten Highschool-Jahr, sie wolle nach New York ziehen und sich zur Künstlerin ausbilden lassen.
Sie sagte nicht, in welchem Medium, einfach nur «zur Künstlerin». Sie bat um ihr Atari-Geld von damals, als sie zwölf war. Es hatte stagflationsmäßig Zinsen gebracht und würde reichen, so rechnete sie sich aus, um damit eine Wohnung in Manhattan anzumieten. Das Geld war als Sparbrief in ihrem Namen angelegt. Weil ihre Eltern nicht dümmer waren als ihre Tochter, bewahrten sie den Brief in einem Schließfach auf und verrieten ihr nicht, bei welcher Bank. Sie sagten, das Geld sei für ihre Ausbildung gedacht. Es gab Meinungsverschiedenheiten darüber, was eine Ausbildung eigentlich ausmachte. Das Gebrüll im Haus erreichte außergewöhnliche Dauer und Tonlagen.
Das Ergebnis war, dass Pam im September 1986, als ihr letztes Highschool-Jahr offiziell begann, zur Greyhound-Haltestelle marschierte – sie ging zu Fuß, weil sie nur die siebzig Dollar hatte, die sie im Pfandleihhaus für den Stereo-Receiver und den Videorecorder ihres Vaters bekommen hatte – und in einen Bus mit Ziel Port Authority stieg.
Als sie das Autobahnkreuz vor dem Eingang zum Lincoln Tunnel erreichten und sie von ihrem Platz in dem stinkenden Bus aus die Türme von Manhattan sah, war dies der aufregendste Moment ihres Lebens, sämtliche Erlebnisse rund um Sex, Musik, Natur und Drogen definitiv eingeschlossen.
An der Ecke Forty-First Street und Eighth Avenue trat sie auf den Gehsteig hinaus. Die Erfahrung, die sie auf den Innenstadtstraßen von D.C. gesammelt hatte, sagte ihr, dass sie an diesem Ort keine Zeit zu verbringen brauchte. Sie sah Prostituierte, denen kürzlich ins Gesicht geschlagen worden war. Sie ging Richtung Osten. Für jemanden, der in Bautechniken ungeschult war, schien die Stadt aus rohem Fels gehauen zu sein. Auf allen Seiten umgaben sie blanke Felswände. Höhlenbehausungen wimmelten von Feen, Dieben und Barbaren, wie in einem Dungeons-&-Dragons-Abenteuer. Sie beschleunigte ihr Tempo. Am Times Square bog sie in südliche Richtung auf den Broadway ab. Statt von Huren war sie jetzt von Strichern und Dealern umgeben. Als sie die Fourth Street erreichte, hatte sie Gänsehaut. Sie sah Männer, die mit einem kleinen Gummiball das New Yorker Handball spielten. Sie hatte noch nie jemanden Handball spielen sehen.
Sie blieb stehen, um ihnen zuzuschauen. Niemand blieb stehen, um ihr zuzuschauen. Sie war eine langbeinige Fremde in schwarzer Jeans und einem Männerunterhemd mit V-Ausschnitt, samt Rucksack und Schlafsack, siebzehn Jahre alt, verirrt, weiblich und unsichtbar. Sie war genau da, wo sie sein wollte.
Kurz nach ihrer Ankunft fing sie an, für eine EDV-Beratungsfirma namens RIACD zu arbeiten. Alles an dieser Firma war von Missmanagement geprägt, von dem Wortspiel im Namen, der kein Akronym war und nur von Ausländern richtig als «REACT» ausgesprochen wurde, bis zur Ein-Mann-Marketingabteilung. Die Firmenadresse, weit südlich auf der John Street im Financial District, brachte dem Unternehmen den Anschein von finanzieller Solidität ein und zugleich schief abgehängte Decken und gluckernde Toiletten.
Eine Ausnahme vom allgemeinen Missmanagement war möglicherweise der über dreißig Jahre laufende Mietvertrag, unterzeichnet im Jahr 1985. Der Gründer von RIACD, Yuval Perez, war vor der Einberufung zum Militär aus Israel nach New York geflohen, nachdem er 1982, kurz vor dem Einmarsch im Libanon, achtzehn geworden war. Vermietern Geld zu schulden machte ihm keine Angst. Verträge nahm er als Bedrohung nicht ernst.
Nur Missmanagement konnte eine solche EDV-Beratung dazu bringen, eine Schulabbrecherin mit «Bestrahlungskopf» zu engagieren, damit sie sich anhand eines Usenet-Tutorials die Programmiersprache C beibrachte, deshalb hatte Pam nichts daran auszusetzen. («Bestrahlungskopf» war der Welt einfachste und zugleich schlechteste Punkfrisur. Mit einer Schere schnitt man sich selbst das Haar sehr kurz, und weil es automatisch ungleichmäßig wurde, sah man damit aus wie ein Krebspatient.) Sie begegneten sich in einer Bar, wo Yuval sie einem Eignungstest unterzog und gleich für den nächsten Tag anstellte. Der Test bestand zum Teil darin, sich eine Reihe von neunundneunzig Stiften vorzustellen, die von links nach rechts durchnummeriert waren, von eins bis neunundneunzig, und die in einhundert Löchern steckten, die ebenfalls von links nach rechts durchnummeriert waren, wobei das Loch ganz rechts leer war. Man sollte sagen, wie die komplette Reihe ein Loch nach rechts zu bewegen sei, indem man die Reihenfolge umkehrte. Der erste Schritt eines typischen Programmierers bestand darin, von weiteren Löchern auszugehen.
Pam war mit Knappheit aufgewachsen. Sie ging niemals davon aus, dass es irgendetwas zusätzlich gab. Damals war Sparsamkeit in diesem Geschäft eine Kardinaltugend. Computer waren langsam und kamen schnell an ihre Grenzen. Programme liefen ohne Grafik oder Menüs. Knauserigkeit wurde «Eleganz» genannt. Ästhetisch betrachtet ähnelte das der Eleganz, sich das Haar abzuschneiden, anstatt es zu waschen, und jeden Tag dieselben Stiefel ohne Socken zu tragen. Die ultimative Eleganz war erreicht, wenn sämtliche Programme eines Rechners nackt und barfuß zusammenlebten und sich einen einzigen Mantel teilten.
Ihr erstes Projekt nach dem C-Tutorial war ein selbsttätig handelndes System für die American Stock Exchange. Sie schrieb das Programm an einem einzigen Tag, und das Kompilieren funktionierte gleich beim ersten Versuch. Es lief unter SCO Xenix auf einem 286er, der in einem Heizungskeller stand. Die Händler mochten es und bestellten sie ein, damit sie Anonymität einbaute – nicht Sicherheit; der Morris-Wurm war noch nicht losgelassen. Sie wollten Fantasie-Benutzernamen, damit sie im Streitfall dummen, automatisierten Aufträgen die Schuld geben konnten.
Sofort wurde Pam übermütig – und das für alle Zeiten. Regelmäßig vernachlässigte sie die Eingabevalidierung, und einmal schrieb sie ein legendäres Interface, das abstürzte, wenn ein Nutzer ein Zeichen mit Akzent eingab. Allzu häufig kam es vor, dass sie das System eines Kunden zurückließ, ohne das Debugging abzustellen. Und doch betrachtete Yuval sie als Schlüsselkraft. Gewissenhaftere Berater mit überlegener Sozialkompetenz brachten diese oft bei ausgedehnten Mittagessen mit Klienten zum Einsatz, indem sie den Gedanken äußerten, Merrill Lynch oder Prudential stünden besser da, wenn sie sie direkt anstellen würden. Aufgrund von Pams Ausrastern, Zusammenbrüchen und Fehlern – die im Allgemeinen als Aspekte ihrer Weiblichkeit betrachtet wurden – bestand niemals die Gefahr, dass ein Kunde sie abwerben könnte.
Sie war eine von zwei Frauen bei RIACD. Neuen Kollegen fiel es oft schwer, ihr in die Augen zu sehen, wenn es zu den Eins-zu-eins-Begegnungen kam, die sie so gern herbeiführten, indem sie ihr den Weg zur Damentoilette versperrten, während andere sie mit den krassen Beleidigungen konfrontierten, die in Queens als Flirten durchgingen. Und doch behandelten sie alle die Empfangsdame von RIACD, eine engelsgesichtige jemenitische Jüdin in übergroßen Oberteilen und langen Röcken, nicht älter als Pam, mit tiefem und aufrichtigem Respekt. Pam folgerte daraus, dass es im Fantasieuniversum eines Amerikaners mit mediterranen Wurzeln und seines Jungfrau-Huren-Komplexes das Beste war, sich auf die Seite der Jungfrauen zu stellen. Sie erklärte den neuen Kollegen, sie sei lesbisch. Die Sexisten dieser Zeit waren mit Howard Stern vertraut. Seine sadomasochistische Radio-Talkshow hatte die abweisende Lesbe mit mächtigen Tabus besetzt.
Es kostete sie keine Dates, weil sie ohnehin nie einem Anzugträger begegnete, mit dem sie ausgehen wollte. Sex gehörte zu der Freizeitwelt, in der sie auch ihre Kunst betrieb. Für sie war Kunst, im Idealfall, kommerziell und konnte den Künstler ernähren und ihm ein sicheres Zuhause bieten. Sie liebte die strenge Schönheit des Programmierens, doch sie betrachtete es nicht als Kunst. Es war zu geregelt. Es machte die Anzugträger allzu froh. Sie brauchte es, um Geld zu verdienen. Eine Künstlerin musste Geld im Überfluss haben. Ohne Geld würde sie von Manhattan abprallen wie ein Vogel von einer Fensterscheibe.
1989, als sie Joe begegnete, war ihr aktuelles Kunstprojekt eine Band namens The Diaphragms. Schon der Name war ihr peinlich. Sie fand, er klang nach den frühen Eighties. Simon, der Sänger und Bassist, behauptete, durch sein Mannsein sei er ironisch gebrochen. Er kam aus Yorkshire und hatte ein Stipendium, um an der NYU Oper zu studieren. Er besaß ein klobiges, klebriges graues Keyboard, in das eine analoge Drum Machine integriert war. Sie spielte eine Gibson-SG-Gitarre. Die Band sollte ein No-Wave-Power-Duo sein. Jeder außer Simon wusste, dass ihre Musik beschissener Casio-Core war.
Natürlich hatten The Diaphragms im CBGB gespielt. Jeder konnte dort zumindest einmal spielen. Alles, was man tun musste, war, sich für die Audition Night einzutragen. Sie waren um sieben Uhr an einem Mittwochabend dran. Ihre zwanzig besten Freunde bestellten pitcherweise Bier, doch der Geschäftsführer war trotzdem der Meinung, ihr Set sei noch ausbaufähig. Als Pam ihn fragte, an welche Aspekte er dabei dachte, sagte er achselzuckend: «Euer Set. Die Lieder. Wie ihr die spielt. Die Arrangements. Na ja. Alles eben.»
Sie probten jedes Wochenende in einem Raum in Hell’s Kitchen. Zwischen acht Uhr morgens und zwölf Uhr mittags kostete der nur zehn Dollar pro Stunde. Sie kamen gleich um acht, denn es dauerte ewig, ihren Set zu proben. Es war schwer, die Lieder auswendig zu lernen oder auch nur voneinander zu unterscheiden. Sie hatte achtmal mit Simon geschlafen und bekam mindestens zehnmal mit, wie er sie in der Öffentlichkeit als seine «Ex» bezeichnete. Noch peinlicher wurde die Sache dadurch, dass er weiterhin ihr Mitbewohner war. Sie teilten sich eine überteuerte Wohnung in einem Haus mit Pförtner in der Bleecker Street, in der Nähe der Folk-Clubs und der italienischen Bäckereien, in jenem touristischen östlichen Teil des West Village, den die Gentrifizierer, die ins noch weiter östlich gelegene East Village zogen, verächtlich «Little Jersey» nannten. Eine windige Gipswand unterteilte den vormals einen Schlafraum in anderthalb. Simon bewohnte den halben. Sein Mietanteil war einfach zu gering. Niemals wäre er freiwillig ausgezogen. Sie war oft beruflich unterwegs, und jedes Mal, wenn sie zurückkam, wusste sie, dass er in ihrem Bett geschlafen hatte. Sie waren keine Freunde. Sie hasste ihn. Sie hatten den Mietvertrag gemeinsam unterschrieben.
Als sie Joe begegnete, sprach er zuallererst ihr Frisurproblem an. «Du siehst super aus bis auf die Haare!», sagte er. «Deinen Körper finde ich toll. Er ist so länglich. Und du hast einen unglaublichen Mund. Deine Augenbrauen sehen mürrisch aus, als ob du eine romantische Seele hättest. Du solltest flüssigen Eyeliner tragen und lange Haare bis zum Po!»
Zu diesem Zeitpunkt kannte er sie noch keine zehn Sekunden, vielleicht nicht einmal fünf. Er hatte ihr auf die Schulter getippt, als sie an einer Bude für einen Fünfzig-Cent-Kaffee anstand.
«Das würde ewig dauern», sagte Pam. «Haar wächst nur einen Zentimeter im Monat.»
«Rechnen ist nicht mein Ding», sagte Joe.
«Meins auch nicht, aber wenn wir zehn Zentimeter pro Jahr sagen, und von meinem Kopf bis zu meinem Po sind es neunzig Zentimeter, dann reden wir hier von neun Jahren.»
«Neun Jahre!» Er fuhr sich nachdenklich über das eigene Haar. Es war mausbraun und gewellt und in der Form eines umgedrehten Topfes geschnitten. «Wie alt, glaubst du, sind meine Haare?»
«Du bist voll der Mutant», sagte sie und machte Anstalten zu gehen. Sie hatte ihren Kaffee bestellt, ihn aber weder bekommen noch bezahlt. Bevor sie Joe einfach da stehenlassen konnte, griff er nach ihrem Arm.
Sie war gerade in der Stimmung, es zu dulden. Sie wartete vor einem mobilen Verkaufsstand am unteren Broadway und wollte um vier Uhr nachmittags dünnen Kaffee kaufen, nachdem man sie aus der Merrill-Lynch-Zentrale eskortiert hatte, weil sie so ein Arschloch in Anwesenheit seiner Untergebenen «Wichsbirne» genannt hatte. Er hatte geantwortet, er werde dafür sorgen, dass RIACD sie feuere. Sofort hatte sie Yuval angerufen, der angemerkt hatte, dass der Begriff «Wichsbirne» von manchen Ethnien durchaus als beleidigend verstanden werde, und zwar von jeder einzelnen auf der Welt, und sie hatte ins Haustelefon von Merrill Lynch geschrien, wenn er endlich mal ein paar Cent dafür ausgeben würde, RIACDs plattformunabhängige Programmiersprache zu vermarkten (ihr Nebenprojekt für ruhige Tage im Büro), würde niemand von ihnen sich je wieder mit Fuzzis wie dieser Wichsbirne abgeben müssen. Dann hatte sie gespürt, wie eine kräftige Hand ihren Arm packte. Das alles war eine halbe Stunde zuvor passiert.
Joes Berührung war dazu ein angenehmer Kontrast. Er strahlte sie an, als hätte er sein Leben lang nach ihr gesucht und sie endlich gefunden, aber auf eine irgendwie unbeteiligte Art, als wäre sie nicht die Frau seiner Träume, sondern etwas weniger Wichtiges, die perfekte Grapefruit etwa. Er schien über sie nachzudenken.
«Du solltest mich nicht anfassen», sagte sie. «Klar?»
Er ließ ihren Arm los und trat einen Schritt zurück. Zu ihrem Entsetzen fing er an, laut zu skandieren. «Yo! Mutant MC, Finger von der Lady, heiß wie Kaffee, schön wie Schnee–»
«Mach dich nicht zum Affen», sagte sie, gab dem Kaffeemann schnell seine fünfzig Cent und entfernte sich, mit dem heißen Getränk gegen Joe gewappnet, von dem Verkaufsstand. «Hör auf zu rappen. Niemals rappen. Und wenn du mal nicht anders kannst, dann versuch auf keinen Fall, schwarz zu klingen.»
«Aber so klingt Rap einfach.» Traurig senkte er den Blick und starrte auf den Gehsteig.
Fast hatte sie ein schlechtes Gewissen. Sie sagte: «So hab ich das nicht gemeint. Dann rapp eben, wenn du willst. Nur nicht da, wo dich jemand hören kann.»
«Ich bin sogar Sänger», sagte Joe. «Willst du einen Song hören? Ich schreibe fast jeden Tag einen.»
«Klar», sagte sie.
Gemeinsam spazierten sie Richtung Norden, und er sang sein Lied des Tages, laut und mit den Händen gestikulierend.
Mit Joe Zeit zu verbringen beruhigte Pam. Sie konnten endlos reden, und ganz egal, was sie sagte, er störte sich nicht daran. Niemand machte sie an, wenn sie ihn sahen, und wenn ihn jemand anmachte, dann nur sehr kurz. Wenn sie ohne ihn unterwegs war und nervös wurde, kaufte sie einen Becher Kaffee. Heißer Kaffee ins Gesicht hält einen Typen schneller auf als eine Kugel, lang genug jedenfalls, dass ein dünnes Mädchen in Springerstiefeln abhauen kann.
II.
Daniel Svoboda lebte in einem Zustand andauernder Ekstase. Er besaß keinen Mietvertrag. Seine Miete betrug einhundert pro Woche, bar auf die Hand.
Er war ein Eighties-Hipster. Aber das ist verzeihlich, denn er war der Sohn wiedergeborener Christen, die als Milchbauern in Racine, Wisconsin, lebten.
Der Eighties-Hipster hatte nichts mit dem bärtigen und verweichlichten Konsumjunkie gemein, der im neuen Jahrhundert als «Hipster» bekannt wurde. Er war auch kein Fifties-Hipster. Er wusste nichts von Heroin oder der bewussten Aneignung schwarzer Kultur. Er war ein Nebenprodukt des kurzen, schillernden Augenblicks der amerikanischen Geschichte, als die Arbeiterklasse kostenlos Geisteswissenschaften studieren konnte. Nach vier Jahren am Fuß des Elfenbeinturmes, wo er Krumen obsoleter Theorie aufschnappte, stieg er wieder hinab, um sich erneut der Welt des Motorsports mit freiliegenden Rädern und des Jell-O-Salats zuzuwenden, der er entstammte. Augen, die an Raffael und Mapplethorpe geschult waren, konzentrierten sich jetzt auf Holly-Hobbie-Stickereiprojekte und fotokopierte Polaroids von DIY-Geschlechts-OPs. Reflexhaft suchten sie die erhabene Schönheit und die Gewalt, die Foucault und Bataille sie als ihr Geburtsrecht zu betrachten gelehrt hatten, und sie wurden nicht enttäuscht.
Ein Eighties-Hipster konnte ein Viertel nicht gentrifizieren. Dazu war er von zu niedrigem Stand. Seine Anwesenheit ließ die Mieten sinken. Seine Wohnungen waren überbelegt und schmutzig. Vermieter konnten froh sein, wenn er die Miete zahlte. Er dachte nicht daran, leerstehende Grundstücke zu okkupieren und in Nachbarschaftsgärten zu verwandeln oder bessere staatliche Schulen zu fordern. Alles, was er wollte, war, nicht bis zur Rente in derselben Fabrik zu schuften wie sein Vater.
Der Eighties-Hipster war postsensibel. Weil in Armut aufgewachsen und mit politischer Rechtschaffenheit bestens vertraut (für Frauen am College war dies die Zeit des lesbischen Feminismus), kannte er sich mit Sensibilität aus. Er hatte sie verinnerlicht. Er präzisierte sie. Seine Sprechakte spiegelten sein Bewusstsein dafür, dass seine Sensibilität ihn zum Teil einer verschwindend kleinen Minderheit machte. Er wies auf alltägliche Vorurteile und Ungerechtigkeit hin, indem er sie überbetonte. Man beachte seine gewohnheitsmäßige Beschäftigung mit den Verbrechen Hitlers und Stalins oder den unseligen Bandnamen «Rapeman», benannt nach dem Helden eines japanischen Comics.
Nach außen hin, seinem Kleidungsstil und Auftreten nach, wirkte der Eighties-Hipster angepasst. Der Mod, der Glamrocker, der Rockabilly, der Punk, selbst der Prep riskierte den Zorn der Homophoben und trotzte ihm, doch der Eighties-Hipster konnte noch im hintersten Winkel der Ozarks ein Bier bestellen.
Der Eighties-Hipster war die kurzlebige Gischtkrone auf der schmutzigen Welle der höheren Bildung der Arbeiterklasse, und es ist richtig, um ihn zu trauern, auch wenn er zu viel Zeit damit verbrachte, nach authentischen Snuff-Videos und Fotos von nackten Khoisan-Frauen zu suchen.
An einem Novembersamstag im Jahre 1990 besuchte Pam Joe, um mit ihm Musik zu hören. Es regnete in Strömen, die eine solche Wucht entwickelten, dass Frauen in Stöckelschuhen die Arme von Männern ergriffen, um es über die Straße zu schaffen. Autos pflügten Bugwellen in die schlammigen Pfützen.
Joe hatte einen Gast. Als er Pam die Tür aufmachte, kam ein Mann mit einer quadratischen schwarzen Plastikfolie in der Hand aus dem Schlafzimmer und sagte: «Mann, du hast ja die Sassy-Sonic-Youth-Flexi!»
«Die Zeitschrift habe ich sofort abonniert, als ich davon gehört habe, dass es sie gibt», sagte Joe.
«Die macht’s nicht lange», sagte Pam, während sie ihren Mantel aufhängte. «Was soll da die Zielgruppe sein? Dreizehnjährige Mädchen, die gern vögeln? Genau das, was die Anzeigenkunden suchen.»
«Freut mich», sagte der Fremde, trat einen Schritt vor und hielt ihr die Hand hin. «Daniel Svoboda.»
«Pam Diaphragm», sagte sie. «Sassy ist das letzte Röcheln der heterosexuellen Mainstream-Pädophilen.»
«Ich lese es nur wegen der politischen Berichterstattung», sagte Daniel, in Anspielung auf die Leser des Playboy.
«Ich habe das erste Mal von einem Glatzkopf davon gehört, der für Eastern die Bordunterhaltung macht», sagte Pam. «Können wir uns jetzt die Flexi anhören?»
«Ich bin Sonic-Youth-Komplettist», sagte Joe. Er nahm Daniel die Single ab und legte sie auf den Plattenteller. «Die einzige Platte, die ich nicht habe, ist die ‹I killed Christgau with my Big Fucking Dick›-Single, die man nur als Abonnent von Forced Exposure bekam.»
«Das ist keine echte Platte», sagte Daniel. «Die hat sich Byron Coley ausgedacht.»
Byron Coley war der Redakteur von Forced Exposure und Robert Christgau der Haupt-Musikkritiker der Village Voice, doch Daniel fühlte sich nicht berufen, Pam das zu erklären. Auch sah er, einen herablassenden Moment später, keine Notwendigkeit, ihr zu erklären, dass die Schallplatte dennoch existierte.
Sie fühlte sich zu ihm hingezogen. Er hatte nicht nach ihrem richtigen Namen gefragt. Seine Kultiviertheit und sein Wissen schienen es mit ihrem aufnehmen zu können. Sie setzte zu einer freundlichen Bemerkung an. Dann bremste sie sich. Es heißt, man kenne einen Mann erst dann wirklich, wenn man seine Freunde gesehen habe, aber der Freund war in diesem Fall Joe, und der zählte vielleicht nicht. Außerdem war es empirisch erwiesen, dass eine Frau sich immer zu dem sexuell attraktivsten Mann im Raum hingezogen fühlt. Auch hier legte Joe die Messlatte nicht sonderlich hoch. Stattdessen sagte sie: «Der eigentliche Big Fucking Dick ist doch Christgau.»
«So weit würde ich nicht gehen», erwiderte Daniel. «Aber Musik lässt sich nicht nach einer Gaußkurve benoten. Mittelmäßigkeit ist nicht die Norm. Die meisten Platten sind entweder super oder scheiße.»
«Ich kann mit Noten irgendwie nichts mehr anfangen. Hast du gerade erst deinen College-Abschluss gemacht?»
«Ja. Du müsstest mal mein tolles Studienbuch und meine Abschlussergebnisse sehen. Die qualifizieren mich glatt dafür, als Korrektor zu arbeiten.»
«Ich bin Programmiererin, aber ich habe die Highschool nie abgeschlossen.»
«Still, ihr Turteltauben», sagte Joe und setzte die Nadel auf. «Prepare to rock.»
Daniel wohnte in einer illegalen Wohnung, auf deren Existenz er durch räumliches Denken geschlossen hatte. Sie befand sich über einem Geschäft am Rande Chinatowns, in der Chrystie Street auf Höhe der Hester, gegenüber einem umzäunten, verdreckten Park. Zwischen einer tropfenden Klimaanlage und einem vor Dreck schwarzen Gehsteig verkaufte Video Hit heißen Kaffee, Durianfrüchte, fermentierten Tofu, Einhunderter-Abos für die neuesten Actionfilm-VHS aus Hongkong, aus mikroskopischem Staub in Tierform gepresste Zitronenkekse, Glückskatzen und die Kontakte zu Frauen aus der Nachbarschaft, deren Fotos die Wände oberhalb der Kasse schmückten.
Es war sein erster wirklicher Rückzugsort. Als Kind hatte er sich mit zwei Brüdern ein Zimmer im ersten Stock geteilt. Altersmäßig waren die drei nicht weit auseinander. Der eine war ein Ringer, der Arzt werden wollte. Der andere war ein adoptierter Somali mit Epilepsie und nur einem Bein. Gegen den Ringer hatte er keine Chance, und gegen den Somali durfte er es gar nicht erst versuchen.
Streng genommen handelte es sich um ein Loft: ein halbfertiger Lagerraum mit hohen Decken über dem Ladengeschäft. Der einzige Zugang war die Ladentür, die jede Nacht für fünf Stunden mit einem unüberwindbaren Stahlgitter verschlossen wurde, für das er keinen Schlüssel besaß. Wenn er um ein Uhr nachts nicht zurück war, musste er bis sechs Uhr warten. Er war jung. Er kam damit klar. Die Etage über ihm war durch ein Loch in der dazwischenliegenden Brandmauer mit der Schmuckfabrik nebenan verbunden. Zu jeder Tages- und Nachtzeit hörte er Schritte in der Fabrik. Victor und Margie, seine Vermieter, hatten versucht, Waren in dem Loft zu lagern, doch der Fußboden hing durch, und sie wollten ihr Geschäft nicht mit einem Pfeiler verunstalten. Zum Lagern nutzten sie den Keller, der durch eine Falltür im Gehsteig erreichbar war.
Sie waren Immigranten aus Hongkong. Als er ihnen vorschlug, ihn oben einziehen zu lassen, betrachteten sie das als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, ohne etwas dafür tun zu müssen. Sie wollten nicht an Chinesen vermieten, die die Wohnung übervölkert hätten. Daniels bescheidenes Auftreten überzeugte sie davon, dass er ihnen keinen Ärger bereiten würde.
Er war bereits auf Rent-Partys in SoHo gewesen, wo man unter «Loft» ein weiß lackiertes, mit großen Fenstern versehenes Reich der Reinlichkeit und des Wohlstands in einem historischen Gebäude mit Gusseisenfassade verstand. Sein Gebäude war aus minderwertigem Backstein erbaut, mit Holzbalken, die von getrockneter Fäulnis schwarz waren. Man konnte ein Buttermesser in den Türrahmen schieben und es umdrehen. Er vermutete, das Haus war 150 Jahre alt.
Die Treppe war steil und die Tür davor so schmal, dass man sie für eine Schranktür halten konnte. Einmal, kurz nach seinem Einzug, stellte ein Arbeiter einen neuen Wasserkühler davor auf, sodass Daniel oben eingeschlossen war. Erst nach lautem Schreien und Gegen-die-Tür-Hämmern schob Victor den Kühler so weit zur Seite, dass er zur Arbeit gehen konnte. Er kaufte sich eine Feuerleiter mit Haken für die Fensterbank. Wenn er zu Hause war, sicherte er die Tür von innen mit einem Vorhängeschloss.
Er stellte sich vor – ein wenig romantisierend –, dass sein an eine Falle erinnerndes Geheimversteck ursprünglich für illegale Aktivitäten eingerichtet und nach einer Razzia verlassen worden war. Er erinnerte sich vage, bei der ersten Besichtigung ramponierte Möbel und staubige Papierschnipsel gesehen zu haben, die er sich gerne genauer angesehen hätte. Doch als er einzog, war der Raum gefegt und jeder bewegliche Gegenstand entfernt worden, inklusive des Linoleumfußbodens.
Er installierte eine Miniküche mit Spüle und Herdplatte. Er duschte mit einer Handbrause, in einer Zinkwanne stehend. Das Waschwasser kippte er in die Toilette, die eine ordentliche Spülung immer gut vertragen konnte. Zur Straßenseite hin befolgte er Verdunklungsregeln, ließ die Rollos am Tag unten und zog in der Nacht blickdichte Vorhänge zu. Die Fenster nach hinten gingen auf einen kleinen und manchmal sonnigen Innenhof hinaus, der wundersamerweise unvermüllt war, kühl und frisch, keine giftige Reinigung, keine Restaurants, die ranzige Abgase verbreiteten, und keine Lebewesen außer Ratten und Tauben. Sie quietschten und gurrten, aber ansonsten beeinträchtigten sie sein Leben nicht.
Er arbeitete nachts, als Korrekturleser einer großen Anwaltskanzlei in Midtown. Der Job erforderte ein Auge für Details. Er hatte seinen klaren Blick vier Jahre lang auf Kosten des Steuerzahlers trainiert, während er seinen Bachelor of Arts in Kunstgeschichte an der University of Wisconsin in Madison machte. Er wusste, dass es in seinem Studienfach Jobs gab, aber abgesehen vom Lehrkörper der Uni war er noch nie jemandem begegnet, der einen solchen Job hatte. Der Auslöser für sein überflüssiges Studium – oder die Schuldige daran – war eine sexy Vertretungslehrerin, die zwei Tage lang von Kunst und Revolution schwadroniert hatte, weil ihr eigentlicher Geschichtslehrer mit einer Grippe ausgefallen war. Er vergaß sie nie. Jederzeit hätte er einen berührenden Aufsatz darüber improvisieren können, wie Mrs. Ellis ihn dazu inspiriert hatte, an eine Kraft zu glauben, die noch stärker war als Jesus Christus.
Doch in der elften Klasse war es zu spät, damit anzufangen, selbst Kunst zu praktizieren und ein Portfolio zu erstellen, das ausgereicht hätte, um an irgendeiner weltlichen humanistischen Hochschule angenommen zu werden. Er konnte ein Instrument spielen – Klarinette –, aber er beherrschte es nicht wirklich, weil er weder Unterricht noch Vorbilder hatte und weil ihm das Instrument nie als möglicherweise nützlich für künstlerische Musik erschienen war, zu der er in seiner Naivität auch Progressive Rock zählte. Er gab es auf, als er mit dem Studium anfing, weil er keine Lust hatte, seine Freizeit auf Paraden und bei Footballspielen zu verbringen. Außerdem fürchtete er, Hasenzähne davon zu bekommen. Er war nicht eitel, hatte aber – auch hier machte sich der Einfluss von Mrs. Ellis bemerkbar – das Gefühl, dass er mit dem wenigen an Schönheit, was ihm zur Verfügung stand, sparsam umgehen musste.
Seine positiven körperlichen Eigenschaften waren, geordnet nach ihrer Seltenheit in der Gesamtbevölkerung: breite Schultern und schmale Hüften; ein attraktiver Mund (volle Lippen, gerade Zähne, geruchlos); dickes, lockiges Haar (dunkelbraun). Weniger gute Eigenschaften: mittelschwere Aknenarben; hängende Wangen; haarige Füße; haariger Rücken; haariges Gesicht (er musste sich bis hoch zu den Augen rasieren). Nicht klar einzuordnende Eigenschaft: eine Größe von einem Meter siebenundachtzig, ein auf unangenehme Weise alles überragender Riese zwischen den asiatischen Immigranten und ihrem Mobiliar, aber unauffällig nach den Maßstäben von Midtown oder des Financial District.
Seinen Traumjob in seinem Lieblingsplattenladen in Madison bekam er nie, aber in dem Subway-Sandwichschuppen, in dem er arbeitete, hatte er oft mit Musikern zu tun. Indem er sein Studium vernachlässigte, gelang es ihm, sich in der Hierarchie des Uni-Radiosenders hochzuarbeiten, bis er schließlich eine zweistündige Sendung am Montagmorgen bekam und die Leute mit den Residents und Halo of Flies wach schocken konnte.
Er war mit Ersparnissen von 800 Dollar nach New York gekommen, die ausdrücklich dazu gedacht waren, die Seven-Inch-Single herauszubringen, die Daniel Svoboda bekannt machen würde. Nicht als Musiker. Er wollte ein Plattenlabel gründen.
Dank seiner Radioerfahrung und gezielter Bestellungen nach Mailorderanzeigen in Forced Exposure und Maximum Rocknroll wusste er, dass seine Single musikalisch nicht besonders gut sein musste. Es brauchte nur Hall auf den Vocals, Chorus auf der Gitarre und Kompression auf allem anderen. Der Sound würde «warm» und «satt» sein. Der angesagte Sound aus dem mittleren Westen war Grunge mit um eine Oktave abgesenkten Vocals. Auf den Bandpostern waren Funny-Car-Dragster zu sehen, die Stichflammen in die Luft schossen. Ihm schwebte etwas anderes vor: eine gehauchte Frauenstimme über treibenden, offen gestimmten Gitarren, wie bei My Bloody Valentine, nur schneller. Das Schlüsselelement war die Sängerin mit der atemlosen Kleinmädchenstimme – ein zartes, schmächtiges Ding mit zugeschnürter Kehle, das seine Textzeilen hauchte wie Jane Birkin das «Je t’aime … moi non plus», aber unter einem Berg Gitarrennoise begraben. Ihrer künstlerischen Abstammung nach stand sie irgendwo zwischen Goethes Mignon und André Bretons Nadja. Er musste unbedingt herausfinden, ob Pam singen konnte.
Auf seinen Vorschlag hin trafen Pam und Joe sich mit ihm an einem Samstag vor dem Music Palace, einem großen Kino in der Bowery. Weihnachten war nicht mehr weit. Die Straßen waren voller Menschen, die nach Schnäppchenpreisen für die neuesten in China hergestellten Produkte suchten, wie etwa Trockentüchern oder diesen kleinen Plastikrechen mit Eimern, mit denen Kinder im Sommer am Strand spielten. Sie kauften in der Drogerie nebenan einen Sixpack Michelob und versteckten ihn in Pams Rucksack. Das Kino war fast leer. Ein paar Männer schliefen in den hinteren Reihen oder drückten sich bei den Toiletten hinter der Leinwand herum – sie waren gerade erst aus Asien gekommen und wussten nicht, wohin sie sonst sollten.
Das Double Feature bestand aus einem in Mexiko spielenden Actionfilm und einem Kung-Fu-Fantasystreifen über das mittelalterliche China. Die Filme liefen von morgens bis abends. Der Actionfilm hatte bereits angefangen, sodass sie sich erst in der Pause unterhalten konnten. In der Hoffnung, Daniels Neugier zu wecken, erwähnte Pam, wie sehr sie die Proben hasse.
Er sagte: «Was für Proben?»
Joe sagte: «Sie spielt in diesem total beschissenen Power Duo, das überhaupt keine Songs hat.»
«Ich sage immer: Wenn schon scheiße, dann wenigstens laut», sagte Pam. «The Diaphragms haben einen Proberaum und eine Drum Machine, aber keinen Stolz. Ich würde direkt morgen bei der Probe vortreten und sagen, es ist vorbei, aber der Bassist ist leider auch mein Mitbewohner.»
«Ooh», machte Daniel.
«Das ist die Hölle. Und das Schlimmste ist, dass wir wirklich scheiße sind. Ich hab den Verzerrer so hochgedreht, dass ich die Gitarre nur anzugucken brauche, und schon gibt’s Feedback. Ich loope sie durch ein Delay und begleite mich dann selbst. Klingt das schon bescheuert genug?»
«Vielleicht. Kannst du Barrégriffe spielen?»
«Du meinst, ob ich Gitarre spielen kann? Ja, klar. Ich kann sogar singen. Aber irgendwas ist mit dieser Band. Ich will gar nicht, dass sie gut ist. Ich will, dass sie scheiße ist, sodass Simons Band scheiße ist. Es ist das Selbstzerstörerischste, was ich je getan habe, und das will was heißen. Ich muss damit aufhören.»
Daniel zögerte. «Ich will gar nicht in einer Band spielen», wagte er sich vor, nicht ganz sicher, ob man ihm glauben würde. «Wirklich nicht. Man könnte sagen, ich bin eher der Typ Mitläufer. Ich mag eine bestimmte Art von Musik, und ich will, dass die Leute sie hören. Am College hatte ich eine Radiosendung. Ich will ein Label gründen.»
«Und was für Sachen?»
Joe unterbrach sie: «Lasst uns eine Band gründen! Wir heißen Marmalade Sky. Ich am Bass, Pam an der Gitarre und du am Keyboard. Alle singen. Wir haben dreistimmige Harmonien. Wir proben bei dir zu Hause. Ich schreibe die Songs. Prepare to rock!»
Daniel sagte: «Da bist du bei mir an der falschen Adresse, Mann. Ich kann nicht Keyboard spielen. Ich könnte höchstens Schlagzeug faken.»
«Alle Lieder haben immer viel zu viel Schlagzeug», sagte Joe. «Du spielst Keyboard.»
«Ich bin dabei», sagte Pam. «Nächster Halt Marmalade Sky.»
«Und wie heißt mein Label?», wollte Daniel von Joe wissen.
«Lion’s Den, wegen Daniel in der Löwengrube.»
«Das klingt nach Reggae, und ‹Marmalade Sky› klingt nach schlechter britischer Psychedelia.»
«Beides zusammen trifft genau, was wir spielen werden, nämlich Free Dub-Rock Fusion.»
«Er könnte recht haben», sagte Pam. «Er ist so lange ohne Verstärker ausgekommen, er ist der Charlie Haden des Punk-Rock. Also, sozusagen.»
«Pam ist die schlechteste Leadgitarristin des Universums», sagte Joe. «Ihre Finger bewegen sich, als wäre es eiskalt und sie hätte ihre Handschuhe verloren. Aber bei Marmalade Sky spielt sie gewaltige Power Chords, die sie auch wirklich spielen kann, und ich die Melodie.»
«Ich spiele, als hätte ich die Handschuhe an», korrigierte sie ihn. «Das liegt an Simons schlechtem Einfluss. Er will, dass alles so klingt, als hätte man’s durch kandiertes Heroin gezogen.»
«Er ist dein Mitbewohner, und ihr spielt zusammen in einer Band?», fragte Daniel. «Ihr müsst ja gut befreundet sein.»
«Aber so was von extrem dicke.» Sie verdrehte die Augen.
«Für mich klingt das so, als solltest du ihn loswerden. Also, für mich als unbeteiligten Dritten.»
«Ich wollte damit nicht sagen, dass er auf Drogen ist. Aber da gibt’s noch ganz andere Abgründe.»
«Kannst du nicht bitte Keyboard spielen?», fragte Joe Daniel.
«Das willst du nicht wirklich hören, wenn ich da rumstümpere.»
«Du musst», flehte er. «Wir können keine Band sein, wenn wir nicht alle mitmachen!»
«Ich will die Band auf meinem Label rausbringen, nicht mitspielen.»
«Es macht überhaupt keinen Spaß, Rockstar zu sein und Mädchen flachzulegen und all das, wenn du nicht in der Band bist. Du musst irgendwas spielen!»
«Das bringt auch mehr Geld», merkte Pam an. «So ein Manager kriegt zwanzig Prozent, aber als Bandmitglied würdest du ein Drittel bekommen.»
«Zwanzig vom Ganzen plus ein Drittel macht siebenundvierzig Prozent für mich», sagte Daniel.
«Und wir holen alles durch Plattenverkäufe und Touren wieder rein!», sagte Joe.
«Ich muss aber arbeiten», sagte Pam.
«Ich auch», sagte Joe. «Ich meinte, wir touren in der Stadt.»
«Ich muss auch arbeiten, aber eher nachts», sagte Daniel. «Also gut, lasst uns darüber reden, wie ich den Job an den Nagel hängen kann, weil ich so viel Kohle mit L’art pour l’art verdiene.»
«Wir werden im Geld schwimmen», sagte Joe, als würde er ihn bloß an eine erwiesene Tatsache erinnern, «weil ich die Songs schreibe.»
Daniel und Pam wechselten einen Blick, der ausdrückte, dass die Band in jedem Fall scheitern würde, und zwar genau deshalb, weil Joe die Songs schrieb. Außerdem enthielt dieser Blick bereits eine von beiden geteilte, amüsierte Zuneigung zu ihm. «Du wirst der nächste Neil Diamond», sagte Daniel.
«Hasil Adkins», sagte Pam.
«Roy Orbison!», sagte Joe.
Als der Kung-Fu-Film zu Ende war, holten sie Pizza und gingen zu Daniels Wohnung, um dort zu essen und Musik zu hören. Das erste Lied, das er auflegte, war «Suspect Device» von Stiff Little Fingers. Joe tanzte, riss die Arme hoch und warf seinen Körper hin und her. Daniel legte Hüsker Düs «Real World» auf, Gang of Fours «Love Like Anthrax» und Mission of Burmas «Forget», bis Joe sagte, er habe keine Lust mehr zu tanzen. Er bot an, ein Lied vorzusingen, das er an diesem Tag geschrieben hatte. Wieder wechselten Daniel und Pam diesen Blick. Joe holte tief Luft, klatschte in die Hände, um einen Rumba anzudeuten, und fing mit so vielen nordafrikanischen Schnörkeln an zu singen, dass jede einzelne Silbe zu dreien oder vieren gedehnt wurde:
This world is small
I see you all
Killing my head
With how you bled
And now you’re dead
Dead, dead, dead.
Das letzte «dead» dehnte er so, dass es ungefähr zehn Silben zu haben schien.
Pam sagte: «Mann, Joe! Hast du seelische Probleme? Gibt es da was, was ich nicht weiß?»
«Die Melodie fand ich ehrlich gesagt okay», sagte Daniel. Er ging in eine Ecke des Raumes, zu einem der Fenster, die zum Innenhof hinausgingen, und kam mit einer verbogenen klassischen Gitarre vom Flohmarkt zurück, falsch besaitet mit Stahl statt Nylon. Sie war nicht gestimmt. Er reichte sie Pam und sagte: «Hier, spiel mal Gitarre dazu.»
Zwanzig Minuten später hatten sie ein Intro, eine Strophe und ein Gitarrenriff. Daniel trommelte dazu leise mit Löffeln auf einem Buch. Pam sang den Text und Joe die Basslinie dazu. Schließlich sagte er: «Das war der A-Part des Songs. Jetzt kommt der B-Part.»
Der Text zum B-Part handelte von Skatern. Daniel sagte: «Moment. Ist das der Refrain oder die Bridge? Hat das überhaupt was mit dem A-Part zu tun?»
Entschieden sagte Joe: «Es geht um Skater. Die sind tot. An der Ecke Fifth und Fifteenth war Schotter auf der Straße, sie haben sich an einer Stoßstange festgehalten, und zack!»
Am nächsten Morgen informierte Pam Simon, sie werde ohne ihn in den Proberaum gehen, weil sie ihn sich allein leisten könne. Zehn Dollar pro Stunde sei nicht viel Geld für eine Programmiererin. Sie sagte, sie sei durch mit den Diaphragms. Die Band habe nie funktioniert. Sie habe jetzt ein neues Projekt, das funktionieren könne. Um ihm gleich jede Hoffnung zu nehmen, sagte sie, er sei bei diesem neuen Projekt unerwünscht.
Der Auftritt machte sie nervös. Sie stand an der Tür, die Gitarre auf dem Rücken und die Tasche mit den Effektgeräten in der Hand, und hielt ihre beleidigende Rede, als würde sie die sofortige Kapitulation erwarten, obwohl sie wusste, dass damit nicht zu rechnen war.
Simon sagte: «Das ist mein Proberaum, nicht deiner. Ich bin schon längst auf der Suche nach einer neuen Gitarristin.»
«Und warum fährst du dann nicht hin?»
«Ich hab noch keine. Aber bald.»
Sie stellte ihr Gepäck ab und sagte: «Simon, ich weiß, die Sache zwischen uns war wunderbar, aber wir müssen uns jetzt trennen.»
«Ich zieh nicht aus. Ich kann mir nicht mal leisten, alleine zu proben. Du hast gerade selber gesagt, dass zehn Dollar nicht viel Geld für dich sind. Also zieh du aus. Du kannst dir eine eigene Wohnung leisten. Geh einfach.» Er wandte sich beleidigt dem Karton mit den Frühstücksflocken zu, der auf dem Tisch stand, und streute ein paar weitere Chex-Quadrate in seine inzwischen warm gewordene Milch.
Daniel wollte nicht am Sonntagmorgen proben. Er sah keinen Grund, früh aufzustehen, durch die halbe Stadt zu fahren und Geld für etwas zu bezahlen, was sie auch bei ihm zu Hause machen konnten, solange sie es mit der Lautstärke nicht übertrieben. Bei Miso-Suppe am Saint Mark’s Place – sein erstes Date mit Pam – sagte er: «Wieso Geld ausgeben, wenn wir einfach leiser drehen können?»
«So funktionieren Röhrenverstärker nicht», sagte sie. «Die müssen warm werden, um richtig zu klingen, und sie müssen richtig klingen, um warm zu werden. Da gibt’s keinen Kopfhörerausgang.»
«Wieso kaufst du dir keinen Transistorverstärker, damit du zu Hause proben kannst?»
«Auf keinen Fall», sagte sie. «Das hab ich schon hinter mir. Wir proben unter realistischen Bedingungen.» Sie beschrieb ihre Erfahrung mit den Slinkies und sagte, sie müssten mit der Zeit gehen, wenigstens bis in die Eighties, schließlich sei es schon 1990. Daran, nur ein wenig hinterherzuhinken, sei nichts Peinliches. Die Sixties hätten die Popkultur auch erst um 1972 herum voll erwischt, gerade als es mit Punk losging. «Hast du mal Birth of the Beatles gesehen?», fügte sie an. «Wir müssen fleißig wie die Bienchen sein, wenn wir es nach ganz oben schaffen wollen.»
«Darby Crash ist einen Tag vor John Lennon gestorben.»
«Todd ist ein Gott», sagte sie. «Aber klar, vielleicht hat Darbys Tod Chapman den Rest gegeben.»
Daniel verkniff sich ein Grinsen. Er hatte nichts gegen John Lennon und hegte keine Sympathien für den Mann, der ihn erschossen hatte, aber zu wissen, dass Todd Rundgren «Rock and Roll Pussy» auf Lennon gemünzt hatte, dass Lennon mit einem offenen Brief an «Sodd Runtlestuntle» im Melody Maker geantwortet und sein Mörder Mark David Chapman das Ganze so wichtig genommen hatte, dass er es bis zum logischen Ende führte und dabei ein Promo-T-Shirt für Todds neuestes Album trug – das war die Art von Wissen, die er bei einer Frau nicht erwartete, schon gar nicht, dass es ihr so wichtig war, dass sie etwas Postsensibles dazu sagte. Langsam fing er an, sich ernsthaft in sie zu verknallen. Er selbst hatte erst an dem Tag von John Lennon gehört, als dieser starb. Seine Familie interessierte sich eher für Up with People.
Am späten Mittwochabend war Pam eine der ersten, die ein Exemplar der Village Voice kaufte, um sich die Wohnungsanzeigen anzusehen. Sie ging zu einer Straßenlaterne, um zu lesen. Was sie sah, zog ihr den Magen zusammen. Seit ihrem letzten Umzug hatte sich das Gebiet, das sie sich leisten konnte, weit von Manhattan entfernt, bis hinter Brooklyn Heights. Die Einzimmerwohnungen in ihrer Preisklasse befanden sich an Orten wie Greenpoint und Astoria. Selbst Park Slope hatte sich offenbar in eine bürgerliche Hölle voller junger Wohnungskäufer verwandelt, die so taten, als wären ihre gipsverputzten Reihenhäuser Brownstones auf der Upper East Side.
Brooklyn war für sie kulturelles Ödland. Ein Sommerspaziergang durch die Flatbush Avenue mit dem leidenschaftlichen Brooklyn-Fan Joe hatte ihre Meinung nicht geändert. In einem Schaufenster hatte sie einen toten Ast gesehen, mit Goldlack besprüht und in einer silbernen Vase, für achtzig Dollar. Sie war einmal bei einer Ausstellungseröffnung in Williamsburg gewesen, unten am Wasser, und es hatte sich ihr so eingeprägt, als könnte es kurz vor ihrem Tod als allerletztes Bild der Leere zurückkehren. Sie hatte nur knapp die Ära verpasst, als Alphabet City von Latino-Verbrechersyndikaten beherrscht wurde und von lebendigen Toten bevölkert war – waschechten Kannibalen –, aber Williamsburg war noch grusliger, weil dort niemand unterwegs war. Es gab keine offenen Gebäude mit finsteren Gestalten davor, die dunkle Kellereingänge bewachten; überall bloß Mauern und Maschendraht und sie und Joe meilenweit die einzigen Fußgänger. Kannibalen hätten sie gleich dort auf offener Straße fressen können, ohne sich die Mühe zu machen, sie in ein Gebäude zu zerren. Als sie bei der Vernissage ankamen, stellte die sich als Ausstellung ortsgebundener Installationen aus Objets trouvés heraus. Keiner der sogenannten Künstler konnte sich Materialien oder ein Atelier leisten. Es war Arte povera im wahrsten Wortsinn. Dann schnitt sie sich an der Scherbe eines zerbrochenen Spiegels, den irgendein Möchtegernkünstler mit Bindfaden an die Decke gehängt hatte, oben am rechten Ohr die Haut auf.
Noch einmal las sie die Anzeigen für Lower Manhattan. Ihre Hände und Füße waren kalt vom Adrenalin, als wäre sie in eine Falle getappt. Es sah ganz so aus, als könnte sie ihren Mietvertrag in der Bleecker Street nicht aufgeben. Und wenn Simon es ebenfalls nicht tat, würde sie sich mit ihm arrangieren müssen.
III.
Die Operation Desert Shield marschierte unaufhaltsam auf den Krieg zu. Die USA brachten ihre Streitkräfte gegen Saddam Hussein in Stellung und bereiteten sich darauf vor, sein Land in Schutt und Asche zu legen. Oft formulierte Pam laut ihren Wunsch, das Selective Service System möge Simon zum Kampf um Kuwait einziehen.
Daniel hatte so viel über die Zwangseinberufung geredet, dass ihr gar nicht klar war, dass es keine gab. Er stand in Kontakt mit dem American Friends Service Committee, in Joes Interesse genauso wie in seinem eigenen, und bereitete sie darauf vor, den Kriegsdienst zu verweigern. Er nahm Joe sogar zu einem Quäker-Treffen mit, wenn auch nur ein einziges Mal.
Offiziell herrschte Rezession. Die Vorstände der großen Unternehmen klagten, die Zeiten zweistelliger jährlicher Wachstumsraten seien vorbei. Sogar RIACDs Wall-Street-Kunden waren knapp bei Kasse. Sie hatten vernetzte PCs installieren lassen und danach die Angestellten gefeuert, die durch diese PCs überflüssig wurden. Wenn Pam zwei Jahre zuvor in einem Unternehmen gelandet war, hatte sie sicher sein können, fleißige Sekretärinnen zu sehen, die zackig in den Büros ihrer Vorgesetzten ein und aus gingen, Akten von einem Raum zum nächsten trugen, die Abspielgeschwindigkeit von Diktiergeräten mit Fußpedalen regelten oder auf IBM-Selectric-Schreibmaschinen Briefe tippten. Jetzt saßen dieselben Sekretärinnen