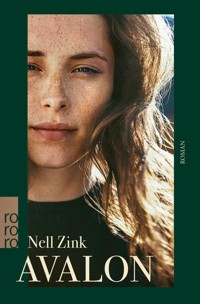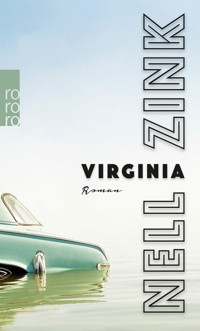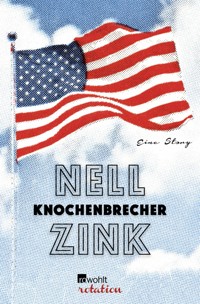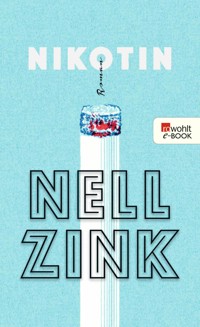
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nell Zink, listige Humoristin und Autorin des fulminanten, von der Kritik gefeierten Debüts «Der Mauerläufer», nimmt in ihrem neuen Roman das gespaltene Amerika aufs Korn. Penny Baker, soeben mit dem College fertig, jetzt arbeitslos und zudem durch den kürzlichen Tod ihres Vaters neben der Spur, beschließt, erst mal dessen verfallendes Elternhaus in Jersey City zu renovieren, um wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Doch Überraschung: Sie findet es besetzt von ein paar netten, noch rauchenden Anarchisten, die ihrer WG den Namen «Nicotine» verpasst haben. Erster Eindruck: «Als hätte man ungefragt einen Haufen Bettwanzen, die immerhin den Abwasch machen.» Mit der Zeit jedoch geben ihr die Bewohner und andere Hausbesetzer aus der Nachbarschaft einen Sinn für Zugehörigkeit und Gemeinschaft, den Penny dringend braucht, und bald zieht sie nebenan ein und engagiert sich in den politischen Kämpfen der Besetzer. Nur hat der Rest der Familie andere Pläne: Ihre Mutter und ihr spießiger Halbbruder, dem sie noch nie ganz grün war, würden die jungen Chaoten am liebsten von der Polizei räumen lassen. Doch Penny nimmt den Kampf für sie auf – vor allem für Rob, den aus Überzeugung asexuell lebenden Mann, in den sie sich verliebt hat. Dies ist ein Roman über den Kampf zwischen Habenichtsen und Immer-mehr-Wollern, zwischen Idealismus und Pragmatismus – ein Buch über Amerika heute, das kaum witziger, böser, klüger sein könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Nell Zink
Nikotin
Roman
Über dieses Buch
Nell Zink, listige Humoristin und Autorin des fulminanten, von der Kritik gefeierten Debüts «Der Mauerläufer», nimmt in ihrem neuen Roman das gespaltene Amerika aufs Korn.
Penny Baker, soeben mit dem College fertig, jetzt arbeitslos und zudem durch den kürzlichen Tod ihres Vaters neben der Spur, beschließt, erst mal dessen verfallendes Elternhaus in Jersey City zu renovieren, um wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Doch Überraschung: Sie findet es besetzt von ein paar netten, noch rauchenden Anarchisten, die ihrer WG den Namen «Nicotine» verpasst haben. Erster Eindruck: «Als hätte man ungefragt einen Haufen Bettwanzen, die immerhin den Abwasch machen.»
Mit der Zeit jedoch geben ihr die Bewohner und andere Hausbesetzer aus der Nachbarschaft einen Sinn für Zugehörigkeit und Gemeinschaft, den Penny dringend braucht, und bald zieht sie nebenan ein und engagiert sich in den politischen Kämpfen der Besetzer.
Nur hat der Rest der Familie andere Pläne: Ihre Mutter und ihr spießiger Halbbruder, dem sie noch nie ganz grün war, würden die jungen Chaoten am liebsten von der Polizei räumen lassen. Doch Penny nimmt den Kampf für sie auf – vor allem für Rob, den aus Überzeugung asexuell lebenden Mann, in den sie sich verliebt hat.
Dies ist ein Roman über den Kampf zwischen Habenichtsen und Immer-mehr-Wollern, zwischen Idealismus und Pragmatismus – ein Buch über Amerika heute, das kaum witziger, böser, klüger sein könnte.
Vita
Nell Zink, 1964 in Kalifornien geboren, wuchs im ländlichen Virginia auf. Sie studierte am College of William and Mary Philosophie und wurde, später im Leben, in Medienwissenschaft an der Universität Tübingen promoviert. Sie lebt in Bad Belzig, südlich von Berlin.
Impressum
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel «Nicotine» 2016 bei Ecco, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Nicotine» Copyright © 2016 by Nell Zink
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-00065-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Ein dreizehnjähriges Mädchen steht in einer Mülllandschaft und brüllt auf ein Hausschwein ein. Der verwaschene Himmel über der Skyline des kolumbianischen Cartagena ist wolkenverhangen und verschmilzt mit dem Karibischen Meer.
Die Sau schüttelt die Hängebacken. Anstatt in ihren Pferch aus Tamariskenästen zu gehen, wendet sie sich gegen das Mädchen. Das Mädchen haut ihr mit einer Metallstange auf die Nase. Die Sau stößt ein kehliges Quieken aus. Eine zweite, größere Sau taucht auf, schlägt die gelben Hauer mit einem lauten Klacken aufeinander, während sie im Abfall schnüffelt. Sie hebt den Kopf und schaut auf das Mädchen, das anfängt, sich zu bepinkeln, und sich dabei krümmt und schreit. Die Pisse hinterlässt Streifen im dunklen Dreck auf ihren Beinen.
Um einen Haufen leerer Waschmittelflaschen kommt ein mittelalter Amerikaner in weißem Hemd und Chinos, dem ein Fernglas um den Hals hängt. Er nimmt einen schweren Ast aus dem Zaun. Er treibt die Säue in den Pferch, während das Mädchen davonspringt. Er ruft ihr hinterher: «¡Momento, momento! Quédate, maja. ¿Como te llamas?» Er stapft ihr nach.
«Amalia», sagt das Mädchen.
«Ven conmigo. Te doy de comer», sagt der Mann und hält ihr die Hand hin.
Sie lässt die Metallstange fallen und folgt ihm, als besäße sie nichts anderes als diesen steifen, groben, blutbespritzten Kittel. Und tatsächlich besteht ihr ganzer Besitz nur aus diesem ehemals weißen Kittel, und sie kehrt nie auf die Müllkippe zurück.
Zwei Jahrzehnte später, zwei Stunden ins Jahr 2005 hinein.
Eine Zigarette kämpft in völligem Dunkel gegen intensive Feuchtigkeit an. Beim Einatmen erhebt sich ein schwaches Glühwürmchen aus Tabak und leuchtet hell auf. Dann fällt es zurück und erlischt beinahe.
Die unsichtbare Raucherin rekelt sich nackt auf einem Haufen Tierfelle. Sie ist zwölf, hat braune Haut, schwarze Augen und langes, dichtes, dunkles Haar. Ihr Haaransatz sitzt sehr tief, kaum mehr als drei Zentimeter über den Brauen, und die Nase ist geschwungen wie eine Sechs. Sie hat kurze Beine, eine breite Taille und hohe, kleine Brüste.
Fünf große, bleiche Männer stapfen schweigend auf einem schmalen Pfad durch den wochenalten Schnee. Sie tragen nichts als Eskimostiefel. Hinter ihnen steigt der Rauch eines verfeuerten Weihnachtsbaums aus dem Schornstein. Von den Schindeln des zweistöckigen Bauernhauses, das am Fuß der Klippen der Palisades nicht weit südlich von Nyack, New York, kauert, blättert die rote Farbe. Die Nacht ist bewölkt, wenngleich mondhell.
Der erste Mann in der Reihe trägt eine Petroleumfackel in einem Bambushalter. Er ist einundsiebzig, der Älteste hier, und hat weißes Haar und einen weißen Bart. Die Fackel zieht eine ölige Spur schwarzen Rauchs hinter sich her. Er hält sie so, dass der Wind den Rauch von den anderen wegtreibt. Die Stiefel der Männer knirschen im Schnee, ein gleichmäßiges Geräusch, so als fräßen Raupen Blätter.
Die Gruppe gelangt zu einer dunklen Kuppel – einer Schwitzhütte auf einem hölzernen Podest, einem einfachen Bau aus Weidenästen, die mit Hirschfellen bedeckt sind.
Der weißhaarige Mann steckt die Fackel in den Schnee. Sie beleuchtet einen einteiligen blauen Skianzug und ein Paar pelzbesetzte Eskimostiefel, die ein paar Schritte entfernt in Hüfthöhe auf dem verharschten Schnee liegen. Stirnrunzelnd hebt er die Klappe. Die Raucherin drückt die Zigarette am Rand eines dreifüßigen Eisenkessels aus und lässt sie zwischen die darin liegenden heißen Steine fallen.
«Ist das der Koala?», sagt ein jüngerer Mann und starrt in die Hütte. Er sieht dem älteren Mann sehr ähnlich, ist groß, schlank und muskulös und trägt den gleichen Bart, aber sein Haar ist noch schwarz.
Der alte Mann, sein Vater wie auch der des Mädchens, schlägt vier der Felle von dem Weidengerüst, das jetzt zu einem Viertel offen liegt, und sagt: «Du enttäuschst mich, Penny.»
«Lass das!», sagt sie. «Ich fange an zu frieren!»
«Du solltest im Bett liegen.»
«Ich konnte nicht schlafen. Im Haus lässt du mich nicht rauchen, und draußen ist es eiskalt.»
Er wendet sich der Gruppe zu. «Tut mir wirklich leid, Leute. Jetzt muss ich die Hütte erst mal lüften, und es wird dauern, bis sie wieder auf Temperatur ist. Wahrscheinlich eine Stunde.» Er redet wieder mit dem Mädchen. «Beweg deinen Hintern ins Haus», sagt er. «Sofort.»
Penny schlängelt sich über das Eis heraus, greift sich den Skianzug, zieht ihn an und schließt den Reißverschluss. Sie schlüpft in die Schuhe, schlägt Pulverschnee von den Pelzschäften. Sie rennt die dreißig Meter den Hügel hinab zum Haus. Vier Männer folgen ihr: ihre beiden Halbbrüder und zwei Freunde des Vaters. Hinter den Fenstern im Erdgeschoss brennt Licht. Ein paar der anderen sind noch wach und reden in der Küche.
Sie geht vom Eingang gleich die Treppe nach oben und ins Bett, streift im Schein einer Nachtleuchte den Skianzug ab. Sie schlüpft unter die schmale Polyestersteppdecke. Die Flanellbettlaken sind von einem ausgeblichenen Dunkelrot. Sie dreht das Gesicht zur Wand und liegt zehn Minuten still.
Sie setzt sich auf, ist zu unruhig, um zu schlafen. Sie überlegt, nach unten zu gehen und ihre Mutter um Wasser zu bitten. Nackt und barfuß wagt sie sich in den Flur.
Hinter der Tür eines Schlafzimmers am Treppenabsatz hört sie ein Paar beim Sex. Sie reißt die Tür auf und schaltet das Licht ein. Sie sieht den dunkelhaarigen Mann von zuvor – ihren Halbbruder Matt – nackt auf seiner Freundin liegen und sagt: «Wie war das mit dem Fasten vor der Schwitzhütte? Kein Essen, kein Sex, kein Alkohol.»
Matt sagt zu seiner Freundin: «Ich schwör dir, ich bring die Göre noch um.»
«Ich schwör dir, ich bring die Göre noch um», äfft Penny ihn leiernd nach. Er löst sich von seiner Freundin und klettert vom Bett. Er stürzt sich auf seine viel jüngere Halbschwester.
Er wird wissen, dass sie an Nacktheit gewöhnt ist. Aber so etwas wie seinen Penis in diesem Zustand hat sie noch nie gesehen. Auch nicht solche Wut. Sie merkt, dass es eine Verbindung zwischen beidem gibt, die charakteristisch für ihn und nicht gut oder angenehm ist. Mit ihrer Altklugheit ist es vorbei. Sie umklammert noch mit einer Hand den Türknauf, als er sie hochhebt und unter dem Arm zu ihrem Zimmer trägt, während sie ihm gegen die Beine tritt. Er schlägt die Decke zurück und lässt sie aufs Bett fallen.
Es folgt ein schweigendes Gerangel, typisch für Geschwister, aber irgendwie nicht ganz okay. Mehr wie ein Vater, der sein Kind kitzelt, aber auch das nicht ganz okay: ein nackter Mann von Mitte dreißig, der eine Jugendliche mit Macht aufs Bett drückt. Sie hebt einen Fuß, um ihm in den Magen zu treten, und streift dabei mit der Wade versehentlich seinen Penis. Sie stößt den monoton schrillen, spontanen Schrei eines zehn Jahre jüngeren Kindes aus, der dem über sie gebeugten Matt wie Tinnitus in den Ohren tönt.
Reflexhaft legt er ihr die Hand über Mund und Nase und sagt: «Um Himmels willen.» Sie ballt eine Faust und boxt ihn auf die Brust. Ihm macht das nicht mehr aus, als träfe ihn ein verirrter Tischtennisball. Dann merkt er, dass sein vom Sex noch feuchter Schwanz an der Haut ihres Oberschenkels klebt. Mit dramatisch übertriebener Geste lässt er sie los, indem er beide Arme hochwirft, als wäre ein Schnappverschluss aufgesprungen.
Er steht auf. Sie wirft sich auf den Bauch und schluchzt, krümmt und windet sich dabei wie eine Raupe, was ihn an Gelächter oder einen Orgasmus denken lässt. Er deckt sie zu, tröstet sie und sagt: «Jetzt komm schon, sei still, du verrücktes Huhn. Beruhige dich.»
Als er in den Flur tritt und die Tür hinter sich schließt, sieht er ihre Mutter Amalia um die Ecke aus dem Treppenhaus kommen. «Hey, Matt!», sagt sie. «Was war das?» Sie ist braun und stämmig, drei Jahre jünger als ihr Stiefsohn.
«Penny hatte einen Albtraum und schrie los. Wir sind zu Tode erschrocken. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Gute Nacht.» Er geht zurück zu seiner Freundin und schließt die Tür.
Pennys Gesicht ist erhitzt. Ihre Augen sind gerötet, über die Wangen laufen Tränen. «Hast du schlecht geträumt?», fragt Amalia und setzt sich auf die Bettkante.
«Matt hat versucht, mich zu vergewaltigen», sagt sie, dreht sich um und setzt sich auf, damit Licht auf ihr tränenüberströmtes Gesicht fällt.
«O Gott. Das ist ja wirklich ein Albtraum! Du hast das ganze Haus aufgescheucht!»
Penny schüttelt den Kopf und lässt sich auf das Kissen zurückfallen. Amalia küsst ihre Wangen, vergräbt das Gesicht im dicken Haar ihrer Tochter und rümpft die Nase. «Wonach riecht das? Rauchst du Zigaretten? Sei ehrlich.»
«Ja.»
«Warum klaust du mir Zigaretten? Warum fragst du mich nicht?»
Penny schweigt. Irgendwo in ihrem Kopf, wo die Logik angesiedelt ist, rebelliert sie gegen die Absurdität, um Erlaubnis für etwas fragen zu sollen, das verboten ist. Nach außen hin verrät ihre Miene nur Zerknirschung.
Als Amalia gegangen ist, steht Penny auf und zieht ihren Skianzug an. Sie stiehlt sich aus der Eingangstür und geht durch den Schnee hügelan zu dem Grillplatz, wo der alte Mann, der jetzt einen blauen Overall und auf dem Kopf eine peruanische Skimütze trägt, die Steine für die Schwitzhütte wieder erhitzt.
«Daddy», sagt sie.
«Komm her, meine Kleine. Tut mir leid, dass ich so sauer geworden bin.» Er versucht, den Arm um sie zu legen. Sie entzieht sich ihm. Er versucht, ihr ins Gesicht zu sehen. Sie verbirgt es. «Sag. Was ist los?»
«Matt hat versucht, mich zu vergewaltigen.»
«Und? Mit Erfolg?»
«Nein.»
«Na, dann hat er es auch nicht versucht.»
«Daddy!»
«Stell dir vor, du versuchst ein Mäusekind mit einer Schere zu zerschneiden. Los. Mal es dir aus.»
Sie schnieft, malt es sich aus und sagt: «Geht nicht.»
«Richtig. Etwas hält dich davon ab. Wenn du überhaupt so weit kämst, es zu versuchen, wäre die Maus schon halbiert. Und deshalb ist mir klar, dass Matt nichts dergleichen getan hat. Jetzt schalte mal dein narratives Selbstgerechtigskeitsmaschinchen ab und erzähl mir, was passiert ist.»
«Matt hat mich in mein Zimmer geschleppt –»
«Wo war Naomi währenddessen? Fang am Anfang an. Ich will es ganz genau wissen. Ich will jedes unbedeutende Detail erfahren, so als würdest du einen Traum beschreiben, der keinen Sinn ergibt.»
Penny nickt. «Okay. Naomi und Matt waren in ihrem Zimmer und haben eine Menge Lärm gemacht, also hab ich die Tür geöffnet und sie gebeten, ein bisschen leiser –»
Er wirft den Kopf in den Nacken und lacht.
«Was ist daran so lustig?»
«Du hast sie nicht bei geschlossener Tür gefragt? Du weißt doch, Sex ist etwas Privates, und es ist einfach nur höflich, dabei auch mal laut zu sein. Das solltest du in deinem Alter doch wissen, und ich glaube, du weißt es auch. Ich glaube, du hast die Tür aufgemacht, weil du sie ärgern wolltest.»
«Aber das gibt ihm nicht das Recht –»
«Was zu machen? Was hat er gemacht?»
«Okay, er wurde wütend und hat mich ins Bett gesteckt, aber das war ziemlich komisch.»
«Jetzt stellst du dich dumm und tust so, als wärst du ein kleines Kind. Es ist mein Fehler, dass ich dich nicht wie eine Erwachsene behandelt habe, als du mir meine Schwitzhütte zugequalmt hast. Und auch Matts Fehler, dass er dich nicht wie eine Erwachsene behandelt hat, als du ihn beim Vögeln mit Naomi gestört hast. Glaubst du im Ernst, dass es für ihn nicht genauso seltsam war?»
Penny schweigt verlegen. Sie wendet sich ab und tritt nach einer ausgehöhlten, schmelzenden Schneewehe, die im Licht der qualmenden Petroleumfackel orange leuchtet.
«Du kannst nicht beides haben. Du bist kein Kind mehr, und niemand sollte dich so behandeln. Auch du selbst nicht. Wir sind hier alle gleich. Du übernimmst Verantwortung und entschuldigst dich, und ich rede mit Matt. Sind wir uns da einig?»
«Ich hasse Naomi», sagt Penny und starrt auf ihre Stiefel.
«Nicht wir müssen sie liebhaben», sagt Norm. «Das ist Matts Aufgabe, der muss sie lieben, ehren und respektieren. Wir alle sind Individuen.»
«Was an ihr magst du denn nicht?»
«Mal sehen», sagt er und drückt einen Stein mit einem langen Holzscheit tiefer in die Glut. «Sie will auf Teufel komm raus meinen Ältesten heiraten.»
«Was ist daran verkehrt?»
«Sie geht ihm ständig um den Bart, um ihm zu gefallen, und sie scharwenzelt um mich und deine Mutter herum. Sie ist eine Langweilerin. Sie wird ihn nicht halten können. Ich bin ja nun wirklich Jude genug, um mir zu wünschen, dass er sich mit einem netten Mädchen zusammentut und mir ein paar Enkel schenkt. Das wäre doch nett, was? Überall kleine Neffen und Nichten?»
«Babys sind niedlich», sagt Penny.
«Also wenn es etwas gibt, von dem ich hoffe, dass du es verstehst, dann, wie man im Leben aus den Fehlern anderer lernt, anstatt sie selbst zu machen. Im Moment hast du die Chance, von Naomi zu lernen. Es ist völlig sinnlos, Menschen zu lieben, wenn man sich dafür verstellen muss. Denn dann kann man noch nicht mal ‹Ich liebe dich› sagen.»
«Das sagt sie aber ständig.»
«Sie sagt ‹liebe› und ‹dich›, gut, aber wo ist das ‹Ich›? Das ist weg, auf der Strecke geblieben!»
Penny nimmt sich selbst einen Stock und stochert in der Glut, um sie anzufachen. Sie lächelt ihren Vater an, und der lächelt zurück.
«Ich», sagt er nachdrücklich und schlingt die Arme um seinen Oberkörper. «Liebe», fährt er fort, reckt die Arme hoch nach oben und schaut in den Himmel. «Dich!», schließt er und beugt sich vor, um sie fest zu umarmen. Er wiegt sich hin und her. Sie drehen sich und trampeln im Schnee herum.
«Jetzt ich», sagt Penny und kopiert das Ritual; dabei wackelt sie so sehr, dass ihr Vater das Gleichgewicht verliert und fast ins Feuer stolpert.
«Und jetzt ab ins Bett», sagt er. «Bei der nächsten Gelegenheit werde ich Matt sagen, dass du erwachsen bist, mit aller Würde, die das mit sich bringt, und dass er dich nicht herumkommandieren kann, warum auch immer, egal wie idiotisch du dich anstellst. Von jetzt an muss er verhandeln. Sind wir uns da einig?»
«Sind wir», sagt Penny.
Matt trottet missmutig hinauf zur Schwitzhütte, zum alljährlichen Schwitzritual. Es ist fast vier Uhr morgens, und er läge lieber im Bett und schliefe.
Sein Vater stellt ihn zur Rede. «Hast du dich an Penny vergriffen?»
Die beiden Männer geben ein bemerkenswertes Bild ab. Im Licht der ein paar Schritte entfernten orangefarbenen Flammen erinnern sie an zwei feindselige Raubkatzen – der eine jung und nackt, der Inbegriff von Kraft; der andere nunmehr eher zum Knuddeln mit seinem dick gefütterten Overall und der albernen Mütze.
Matt verdreht die Augen. «Die Buschtrommel arbeitet ja schnell», sagt er und streift seine Eskimostiefel ab. «Aber nein, ich hab mich nicht an ihr vergriffen. Ich war ein bisschen kribbelig, das Koks klang gerade ab, und sie ist einfach in unser Zimmer geplatzt, das war’s.»
«Rühr sie nicht mehr an. Sie ist zwölf Jahre alt, und sie ist meine Tochter.»
«Himmel, Norm. Krieg dich ein.» Matt taucht ab in die Hütte. Er legt ein paar Schaffelle aneinander und legt sich schwerfällig darauf.
Norm zieht sich aus, um ihm zu folgen. «Wann willst du Naomi heiraten?», fragt er, während er durch den Eingang kriecht. Er greift sich ein Wolfsfell, dreht sich um und setzt sich aufrecht darauf.
«Dieses Mädchen liebt mich blindlings, wie ein Hund. Dabei kennt sie mich gar nicht.»
«Niemand kennt einen anderen wirklich, aber manche Frauen geben großartige Mütter ab.»
«Ich brauche keine Mutter. Mach ein bisschen Dampf, mir ist kalt.»
Norm lässt Wasser aus einer Schöpfkelle in den Eisentopf tröpfeln. «Sprich mit mir», sagt er. «Erzähl mir, warum du keine Familie gründen willst.»
«Weil ich glücklich bin», sagt Matt. «Ich habe einen Beruf, der mich erfüllt, und ich bin finanziell und emotional unabhängig.»
«Ich glaube, dass dir etwas entgeht, wenn du nie in irgendeiner Form von Gemeinschaft lebst.»
«Und ich glaube, dass dir was entgeht, wenn du für dein Selbstwertgefühl auf solche Gemeinschaften angewiesen bist. Deine Kunden da, Mann. Du nimmst die verletzlichsten Menschen der Welt aus, also erzähl mir nicht, das wäre deine Gemeinschaft.»
Leise sagt Norm: «Ich helfe, Seelen zu heilen, wenn die Körper nicht mehr heilbar sind.»
«Und sie das Geld sowieso nicht mehr brauchen. Ich bin nicht gekommen, um mir von dir was über das Leben erzählen zu lassen. Ich habe mein eigenes Leben. Ich verdiene mein Brot auf ehrliche Art, und darauf bin ich stolz.»
«Als Müllwagendesigner.»
«Ich entwerfe Prototypen von mobilen Müllpressen, die das Leben der Menschen verändern. Während du ihnen erzählst, dass das Leben schon so in Ordnung ist – auch das Sterben, denn sie sind ja auf der kosmischen Schlange geritten. Du bringst ihnen bei zu resignieren. Weißt du, warum ich keine Gemeinschaft brauche? Weil Müllwagen notwendig sind. Davon muss ich niemanden überzeugen. Und erzähl mir nicht, dein Drogenhandel hätte meine Ausbildung finanziert. Ich könnte das Zehnfache jedes Studienkredits zurückzahlen mit dem, was ich mir durch meine Kreativität und meinen Fleiß erarbeitet habe. Also hör mir auf damit, dass ich Müllwagen designe. Ich rette damit sprichwörtlich Menschenleben, indem ich die Deponiekapazitäten erhöhe und wir das Zeug nicht verbrennen und die Luft mit Dioxinen vergiften müssen, bis jeder Krebs im Endstadium hat und zu dir nach Brasilien kommen muss, um auf der kosmischen Schlange zu reiten. Oder wäre es dir lieber, wir würden den ganzen Scheiß im Ozean versenken?»
Norm lässt mehr Wasser auf die Steine tröpfeln, und die Sicht in der Hütte tendiert gegen null. Der Dampf verbirgt auch seinen Ausdruck tiefster Missbilligung. Matt hat sich auf den Rücken gelegt und schnarcht plötzlich. Er schläft.
Auch die anderen Männer, darunter Norms jüngerer Sohn Patrick, kommen zurück und setzen sich auf die Felle rund um Matt, achten darauf, ihn nicht zu stören. Sie sitzen mit übereinandergeschlagenen Beinen, und Norm nimmt sie mit auf eine spirituelle Reise.
April 2016. Elf weitere Jahre sind vergangen.
Ein Krankenhaus ragt über einem Fluss auf, der durch eine große Stadt im nördlichen New Jersey fließt. Die weiße Fassade wird von langen, gekurvten Bändern aus reflektierendem Blauglas durchbrochen. Die Architektur nimmt die Form des Flusses auf, aber nicht seine Farbe, denn der Fluss ist zwischen schwarzen Ufern von einem fahlen Grün.
Penny sitzt in einem mit schwarzem Kunststoff bezogenen Sessel, umgeben von langweilig beigen Wänden. Sie trägt rote Ballerinas, schwarz glänzende Leggings und einen weißen Baumwollpullover, der ihr über die linke Schulter gerutscht ist. Kein Make-up, ihre Haut ist klar, und die Wimpern sind dicht und dunkel. Ein BH-Träger ist zu sehen, ein guter Zentimeter schwarzes Satin. Ihr Haar reicht bis zu den Ellbogen. Manchmal hebt sie den Kopf und schaut hinaus auf den Fluss. Die Sessellehnen knarren, wenn sie ihr Gewicht verlagert.
Sie liest ihrem Vater vor, der hochgelagert in einem Krankenhausbett liegt. Das mit Hartholz furnierte Kopfende ist champagnerfarben. Zwei Metallhähne, mit SAUERSTOFF und ABSAUGUNG bezeichnet, sind ordentlich in Vertiefungen im Holz eingelassen. Sie liest aus Norman O. Browns Life Against Death.
Ihr Vater lacht über eine Formulierung. Er hustet. Aus seinem Mund beginnt Blut zu fließen.
Ohne das Buch aus der Hand zu legen, läuft sie aus dem Zimmer. Sie steht vor der Tür und schaut nach rechts und links. Auf dem Flur sind viele Menschen, aber sie weiß nicht, wer zuständig ist. «Hilfe!», sagt sie.
Eine Schwester lässt den Wagen los, auf dem Medikamente in Pappbechern stehen. Eine weitere Schwester kommt von ihrem Tisch hinter einem Tresen. Beide hasten an Penny vorbei ins Zimmer.
Während Penny zu einem Wartebereich mit Topfpflanzen schwankt, legen die Schwestern ihrem Vater ein dunkelblaues Handtuch unter das Kinn. Das helle, glasige Blut färbt seinen Bart rosa und das Handtuch beinahe schwarz.
«Was sollen wir tun, Mr. Baker», sagt eine der Schwestern. «Erinnern Sie sich an Ihre Patientenverfügung. Eine Transfusion würde Sie jetzt um zwei Wochen zurückwerfen.»
Er schüttelt den Kopf und krächzt: «Ich will nicht sterben.»
«Blut komplett und Thrombozyten», sagt die erste Schwester. Die andere eilt aus dem Zimmer.
Blut rinnt aus seinem Mund. Er atmet schwer durch die Nase. Die Gesichtsfarbe wechselt von teigig zu grau. Er neigt den Kopf nach links, um das Blut auf das Kissen fließen zu lassen, atmet mit großer Anstrengung. Seine Hände unter dem Handtuch sind bewegungslos, die nackten Arme unter der Haut übersät mit purpurfarbenen Ergüssen.
Er ist zum Bluter geworden, und das Knochenmark kommt nicht dagegen an.
Penny sitzt benommen auf einem Sofa im Wartebereich. Sie ruft ihre Mutter an und sagt angstvoll: «Dad wird sterben.»
«Bring ihn nach Hause», sagt Amalia entschieden. «Lass ihn hier zu Hause sterben.»
Eine Sozialdienstmitarbeiterin des Krankenhauses, eine hübsche Frau mit Locken und einer marineblauen Bluse, bittet Penny in ihr Büro. «Sie sehen erschöpft aus», stellt sie fest.
«Es ist anstrengend», sagt Penny. Sie sitzt auf dem Sofa, wirft die Schuhe achtlos auf den Boden und zieht die Beine unter sich. So wirkt ihr Körper wie der eines Kindes. Das Haar verschattet die Augen und bedeckt die nackte Schulter.
Sie glaubt nicht, dass sie die Richtige sein wird, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Sie weiß, dass Sterben etwas Natürliches und Universelles ist, das jeder kann. Das jeder tun wird. Keine Herausforderung, sondern ein Kinderspiel. Nachdem sie ihre Ängste und Zweifel abgelegt hat, bleibt ihr nichts mehr. Ihr Blick ist so leer wie der einer Taube.
«Von jetzt an gilt der Hospizmodus», sagt die Sozialdienstmitarbeiterin. «Wir greifen nicht mehr ein. Wir sorgen dafür, dass er sich wohl fühlt. Es wird einen weiteren Vorfall wie heute Morgen geben, und dann wird er verbluten. Eine angenehme Art zu sterben. Das Wahrscheinlichste ist, dass er im Schlaf aus dem Rektum bluten wird.»
«Darüber haben wir ja schon gesprochen.»
«Seine Frau sagte mir, dass sie zu Hause für ihn sorgen will. Ist sie Ihre Mutter?»
«Ja.»
«Arbeitet sie?»
«Sie ist Personalleiterin bei einer Investmentbank in der City. Ich bin in einer Umorientierungsphase und habe jede Menge Zeit.»
«Haben Sie Geschwister?»
«Zwei Brüder. Einer lebt auf dieser Insel im Südpazifik. Aber der andere ist in Fort Lee, und er ist selbständig, also kann er tagsüber mal in Morristown vorbeikommen, um mir zu helfen. Und Mom wird während der Nacht da sein.»
Die Sozialdienstmitarbeiterin tätschelt ihr Knie. «Sie wollen Verantwortung übernehmen. Sie sind eine gute Tochter. Aber ich muss hier eine Ermessensentscheidung treffen. Sie sagen, Ihre Mutter stehe voll im Berufsleben und Ihr Bruder habe in Fort Lee eine eigene Firma. Das klingt so, als wären beide ziemlich beschäftigt. Aber Ihr Vater benötigt rund um die Uhr Pflege und Aufmerksamkeit, und auch Sie müssen sich mal ausruhen. Wenn er anfängt zu bluten, braucht er jemanden mit einer ruhigen Hand, der ihm ein Beruhigungsmittel spritzt. Natürlich könnte das ein Profi machen. Wäre das in finanzieller Hinsicht für Sie eine Option?»
«Da müsste ich meinen Vater fragen. Ich kann mich bei Mom erkundigen, wenn sie aus ihrem Meeting kommt.»
«Okay», sagt die Sozialdienstmitarbeiterin. «So, wie das klingt, und angesichts des Zustands Ihres Vaters werde ich einen stationären Hospizmodus befürworten.»
«Aber was ist damit, ihn nach Hause zu holen?»
«Wenn Sie Pflegekräfte organisieren können. Aber um jetzt erst mal auf der sicheren Seite zu sein, werde ich bei ein paar Hospizhäusern anfragen. Welcher Religion gehört er an?»
«Er ist Schamanist.»
«Ich meine, wie wurde er getauft?»
«Jüdisch.»
«Hmm», sagt die Sozialarbeiterin. «Da gibt’s eine lange Warteliste.»
Ein weiterer Tag vergeht.
«Ich will in den Stiefeln sterben wie Ambrose Bierce», verkündet Norm mit dünner, heiserer Stimme. Er liegt noch immer im selben Krankenhausbett. Seine Hände, die sich seit gestern nicht bewegt haben, sind jetzt mit winzigen durchsichtigen Schläuchen und grünen Plastikventilen geschmückt. Sein Haar, der Bart, die Laken: alle vom gleichen Weiß. Die Augen: grau und rot gesprenkelt.
«Der ist nach Mexiko gegangen, um sich Pancho Villa anzuschließen, und du kannst nicht mal aufrecht sitzen», sagt Penny, die am Fußende des Betts steht. Sie beugt sich vor und streichelt den rosafarbenen linken Fuß. Seine Fußnägel haben Streifen und sind dick und braun wie Hufe.
«Ich habe zu lange gewartet», sagt er.
«Vorgestern hast du geblutet, und du hast sie aufgefordert, dir eine Transfusion zu geben», erinnert sie ihn. «Vielleicht kannst du es, wenn ich hierbleibe und deine Hand halte?»
Sie spürt die Schärfe in ihrer Stimme. Sie möchte einfühlsam sein. Sie möchte sich ihm nahe fühlen. Aber sie steckt in einer emotionalen Zwickmühle: Sein Zustand bedeutet, dass sie nichts mehr gemein haben. Jedes Mal, wenn sie über sein Sterben sprechen, entfremden sie sich mehr voneinander.
«Ich muss mich noch von Matt und Patrick verabschieden. Das hält mich zurück. Hast du mit einem von ihnen gesprochen?»
«Mom schon, soweit ich weiß», sagt sie. «Wir anderen stehen über die sozialen Medien in Kontakt. Daher weiß ich, dass sie noch am Leben sind.» (Nur ältere Menschen maßen sich an, anderen ihr Telefongeklingel zuzumuten. Die jüngere Generation ist da dezenter. Norm ist das klar. Deshalb ruft er Matt oder Patrick nicht an.) «Wenn du willst, kann ich dir dein Telefon so einstellen, dass dir ihre Feeds vorgelesen werden.»
«Nein, danke», sagt er. «Versuch sie doch dazu zu kriegen, mich im Krankenhaus zu besuchen, ja?»
«Mom will, dass du nach Hause kommst. Sie will dich dort betreuen lassen.»
Er schüttelt den Kopf. «Ich habe gesehen, wie du reagiert hast, als ich anfing zu bluten. Ich will dich nicht in der Nähe haben, wenn es aufs Ende zugeht.»
Sein Hinweis auf ihre Sorge macht ihr Angst. Die Kraft und der Mut, nach denen sich beide sehnen – und die beiden fehlen –, sind die Kraft und der Mut, sich nie wiederzusehen. Die Angst ist etwas, das sie gemeinsam haben. Die Angst löst das emotionale Paradoxon. Einen Moment lang zerfließt ihr weiches Herz vor Liebe, und sie sagt: «Dad.»
«Geh nach Hause. Ich muss mich ausruhen. Sie wollen mich demnächst verlegen. Aber gib mir erst noch einen Schluck Wasser.»
Sie nimmt einen Plastikbecher voller Eiswürfel und hält ihm den Strohhalm an die Lippen. Er sagt: «Bäh. Mir ist schlecht», und sie stellt ihn wieder weg. Er schließt die Augen, und sein Gesicht erschlafft. Durch die dunklen Lider, violett wie die Ringe unter den Augen, sieht es so aus, als zögen sich die Augen an Stielen zurück wie in einen Panzer.
Flüchtig schießt ihr der Gedanke durch den Kopf, dass er jetzt schon wie tot aussieht. Sie ahnt, dass ihre ganze mühsam aufgebaute Tapferkeit in sich zusammenbrechen wird, wenn er stirbt. Sie wird die ganze unterdrückte Liebe in einem einzigen Weinkrampf herausheulen, und alle ringsum, selbst Fremde, werden ihre Verzweiflung verstehen und respektieren. Sie wähnt sich schon als Teil einer langen Reihe von erschütterten Trauernden bis zurück zu den griechischen Tragödien.
«Ich mach mich auf, Dad», sagt sie.
Er öffnet die Augen wieder und sagt: «Warte. Ich möchte, dass du mir morgen einen Gefallen tust.»
«Klar.»
«Bring mir doch meinen Laptop von zu Hause mit. Da ist eine Spracherkennungssoftware drauf, die ich noch nie benutzt habe. Vielleicht kann ich sie so einstellen, dass ich ein paar Sachen diktieren kann. Ein paar Geständnisse.»
«Das wäre großartig», sagt sie strahlend. «Ich habe noch so viele Fragen, besonders über die Zeit vor meiner Geburt. Über Sachen wie Matts und Patricks Mutter. Ich weiß praktisch alles über deine Philip-Roth-Kindheit und Moms durchgeknalltes Dorf, aber ich weiß nicht mal, wie sie heißt!»
«Was ich brauche, ist eine Zeitkapsel. Ich habe dir noch so viel zu erzählen. Wenn alle anderen weg sind, wie in diesem Gedicht: ‹Wenn du einst alt und grau und Schlafes voll am Feuer döst, dann nimm dies Buch –›»
Penny schnürt sich die Kehle zusammen.
«Alles, was übrig bleibt, bist du. Du und deine Kinder. Du bist zwanzig Jahre jünger als die Jungs und deine Mutter, und wenn ich tot bin, wirst du noch siebzig Jahre leben. Die Eier für deine Kinder sind schon in dir. Ich kann sie beinahe sehen. Fast so, als würde ich meine eigenen Nachkommen kennen, als könnte ich in die Zukunft schauen. Auf nichts und niemanden bin ich so stolz wie auf dich. Es war ein solches Glück, dich zu kriegen.»
Penny steht mit Tränen in den Augen da, zu aufgewühlt, um zu sprechen.
«Hey!», sagt Norm. «Weine nicht, Koala-Girl. Jeder muss mal sterben.»
Ihre Stimme ist ein Elfenzirpen. «Ich hab dich so lieb, Dad.»
Norm stöhnt, als ihn der hünenhafte Fahrer des Krankenwagens und sein kaum kleinerer Helfer von der schweren, hohen Transportliege in sein neues Bett im anglikanischen Hospiz in North Bergen heben.
Das Zimmer ist geräumig. Es gibt eine gepolsterte Bank, auf der Angehörige schlafen können, zwei Sessel und vier um einen großen Tisch platzierte Stühle mit gerader Rückenlehne. Die Morgensonne knallt atombombengrell durchs Fenster. Das Bett ist breit, eine schwere Konstruktion, wie um höchsten Anforderungen zu genügen. In der Vase auf dem Tisch steht ein Strauß Papageienblumen – grün, orange und blau. Auf der Karte von Amalia steht: «Ich liebe dich, Darling!»
Nachdem die Rettungssanitäter gegangen sind, setzt Penny sich in einen der Sessel. Sie stellt die Laptoptasche neben den Rucksack zu ihren Füßen. Auf Norms Bitte hin lässt sie die Jalousien herab. Sie sitzt im Sessel ihm gegenüber, spielt mit der Steuerung des Betts und stellt die Füße darauf ab, was dazu führt, dass sie tiefer in den Sessel rutscht.
Er lächelt und sagt: «Lass das erst mal so. Diese Bettstellung gefällt mir.»
«Wie geht’s dir?»
«Nicht so gut. Mein Nacken ist ganz steif. Vielleicht von der Fahrt im Krankenwagen. Es hat sich angefühlt, als würde ich jeden Moment aus dem Ding rausfliegen.» Er dreht den Kopf hin und her und seufzt.
Sie schlägt ihm eine Akupressur vor. Sie legt die Hände auf seinen Nacken und findet einen bestimmten Punkt zwischen zwei Wirbeln.
«Genau da», sagt er.
Drei Minuten später sagt er, dass es nicht hilft. Als sie ihn loslässt, sieht sie bestürzt, dass der Druck ihrer Finger einen dunklen Bluterguss hinterlassen hat. Sie fragt: «Willst du dich jetzt mit der Sprachsoftware beschäftigen?»
«Nicht gleich. Ich war heute Vormittag ziemlich beschäftigt. Du kannst mir ein bisschen vorlesen. Vielleicht schlafe ich ein, und dann sehen wir uns morgen, wenn ich wieder wach bin. Und vergiss den Laptop nicht, wenn du gehst.»
«Den klaut doch niemand.»
«Bist du dir da so sicher? Hast du hier irgendwo teure Geräte gesehen?»
«Hier sind Handtücher und ein Kissen», sagt sie, nachdem sie in ein paar Schränke geschaut hat. «Möchtest du ein Kissen?»
«Das nehme ich gern.»
Sie faltet es und arrangiert es so unter seinem Kopf, dass es ihn stützt. «Wie ist das?»
«Schon besser», sagt er. «Es ist wohl bloß eine Zerrung.»
Im Lauf der folgenden Stunde geht sie, nimmt den Laptop mit, und er bewegt den Kopf. Das Kissen fällt hinunter.
Er bemerkt es nicht und schläft weiter. Er wacht mit schrecklich steifem Nacken auf.
Früher Abend. Eine blonde Frau in den Fünfzigern, die einen blauen Laborkittel trägt, klopft zweimal an Norms offene Tür und betritt sein Zimmer. Er ist hellwach und starrt auf den leeren Fernsehbildschirm.
Sie stellt sich als stellvertretende Leiterin des Hospizes vor. Sie sagt, es müssten einige wichtige Entscheidungen hinsichtlich seiner Pflege getroffen werden. Natürlich könne man Familienangehörige hinzuziehen, aber das sei nicht zwingend notwendig.
Norm sagt, er fühle sich imstande, allein zu entscheiden. Sie bringt ein hellgrünes Formular zum Vorschein. Sie liest eine lange Liste vor, lauter Dinge, mit denen er Zeit schinden könnte, vom Defibrillator bis zu Antibiotika, und er lehnt alle ab. Sie zeigt ihm, wo er unterschreiben soll, und er zeichnet mit lesbaren Initialen.
Sie schließt mit einer Frage – für seine Begriffe etwas unerwartet: «Und was wollen Sie?»
«Nach all dem? Ich will, dass es wieder 1951 ist, und Sie sind ein Rootbeer mit Vanilleeis.»
«Das ist eine ernst gemeinte Frage. Bitte denken Sie sorgfältig nach.»
«Wie wär’s mit 1968 und einer Überdosis Heroin? Ich will einfach kein alter Mann sein, der im Hospiz stirbt. Aber genau damit bin ich wohl geschlagen.»
Die Ärztin schweigt. Sie blinzelt.
«Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, bin ich körperlich in einem erbärmlichen Zustand», fährt er fort. «Ich bin schwach. Durch die Beschwerden kann ich mich nicht konzentrieren, also werde ich vor Langeweile verrückt. Und das macht meine Tochter wahnsinnig. Ich hasse es, dass sie mich so erlebt, aber sie will einfach nicht gehen.»
«Sie liebt Sie sehr.»
«Sie betet mich an. Es bricht einem das Herz.»
Die Ärztin nickt und lächelt. Behutsam erkundigt sie sich: «Sind Sie religiös?» Er reagiert nicht. Sie fragt: «Haben Sie schon zu beten versucht?»
«Zu wem? Ich glaube nicht, dass in diesem Fall Gott zuständig ist. Das scheint mir eher ein Fall für diesen anderen Kerl zu sein.»
«Mr. Baker –»
«Gott bedeutet Leben. Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, der Tod sei Teil des Lebens. Ich glaube, er ist verdammt eindeutig das Gegenteil davon, um ganz offen zu sein. Deshalb fällt es mir ein bisschen schwer, mich darauf zu freuen.»
«Das bedeutet aber nicht, dass Ihnen keine Hilfe zuteilwird, wenn Sie darum bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Sie müssen den Mund aufmachen und bitten.»
«Ich bin ein erleuchteter Mensch.» Als er ihr Lächeln sieht, fährt er fort: «Nicht wie ein Zen-Buddhist! Erleuchtet im Sinne von aufgeklärt. Rational. Ohne Vorurteile. Ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube an die Religion. Tradition und Ritual können ziemlich viel dazu beitragen, dass man sich mit einer lausigen Prognose abfindet. Ich habe mich mein halbes Leben lang mit dem Schamanismus beschäftigt, und Sie können mir glauben, dass ich jeden Geist um Hilfe gebeten habe, den ich kenne. Aber solange die ihren Arsch nicht hochkriegen und mir helfen, könnten Sie vielleicht irgendein Schmerzmittel für meinen steifen Nacken auftreiben.»
«Zum Personal gehört eine ehrenamtliche Masseuse, die sehr gut ist.»
«Für tantrische Massage? Das könnte vielleicht wirklich helfen.»
«Ich muss Sie doch bitten, Mr. Baker, Ihre Situation ernst zu nehmen. Sagen Sie mir, welche Art Pflege Sie erwarten.»
«Ma’am, ich verstehe Sie einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir hören wollen!»
Sie ist nicht bevollmächtigt, ihm zu sagen, was sie hören möchte – dass er am liebsten auf der Stelle ins Koma fallen und innerhalb einer Woche sterben will –, oder dass dieser Moment, den er gerade in morbider Unbeschwertheit ertränkt hat (sie traut sich nicht, das Thema noch einmal aufzugreifen), genau der richtige gewesen wäre, um darum zu bitten, seine letzten Erdentage tief und fest zu verschlafen.
Man hätte seiner Bitte gern entsprochen. Aber Vollnarkose gehört hier nicht zum offiziellen Programm, weil dieses Hospiz wie eines jener Bordelle geführt wird, die pro forma Strip-Clubs sind. Die Lizenz beinhaltet keinen Schutz der Tänzerinnen, die ihre Freier deshalb genauso verstohlen und ängstlich bedienen müssen wie das Hospizpersonal, wenn es einen schmerzlosen Tod verabreicht.
Und Norm will gar nicht sterben. Noch nicht. Er will sich noch von seinen Söhnen verabschieden. Er sehnt sich nach diesen Abschieden. Bei all dem, was er weiß, ist er überzeugt, dass es die Mühe wert ist, dem Tod mit offenen Augen und wachen Sinnen entgegenzutreten, wenn das bedeutet, dass er seine Söhne noch einmal sehen kann. Er ist ein gefühlsbetonter Mann. Das kann er nicht einfach abstellen.
«Ich liege im Sterben, und das deprimiert mich total», setzt er beharrlich nach, um die Ärztin davon zu überzeugen, dass seine Gefühle dieser Umgebung angemessen sind. «Ich bin für alles dankbar, was Sie für mich tun können.» Er sieht, dass sie immer noch enttäuscht ist. Er verzieht das Gesicht und schaut wieder geradeaus. «Läuft nicht gerade Jeopardy?»
Auf seine Bitte hin schaltet sie den Fernseher ein. Alex Trebek steigt aus seinem Satelliten in der Umlaufbahn herab in seine Box, der Inbegriff von Selbstgewissheit und Fair Play.
Norm entspannt sich. Die Ärztin legt ihm die Fernbedienung mit dem eingebauten Lautsprecher in die gekrümmte rechte Hand und geht aus dem Zimmer.
Am nächsten Morgen trifft Penny in Norms S-Klasse-Mercedes um halb elf im Hospiz ein; sie hat den Laptop dabei.
Er sagt, er habe zu große Schmerzen, um die Sprachsoftware einzurichten. Sie sagt, sie könne schnell tippen und mitschreiben, was er sagt. Er lacht und sagt, dazu bräuchte man eine Stenografiermaschine. Er liest dem Computer laut eine Reihe von Wörtern vor. Sie meint, er solle seine Geschichte erzählen und sie auf Tonband oder Video aufnehmen. Sie sagt, ihr Telefon habe eine Spracherkennungssoftware, und die funktioniere ganz ohne Programmierung. Er bittet darum, ihn in Ruhe zu lassen.
Er fühle sich zu elend, sagt er, um überhaupt noch zu reden, weil der Schmerz in Nacken und Schultern sich weiter ausbreite. «Als würde er über den Brustkorb bis in den Rücken kriechen», lässt er sie wissen. «Als wäre alles verrenkt.»
Penny ruft eine Schwester, die ihr sagt, sie solle versuchen, ihn zum Schlafen zu überreden. Er willigt ein, es zu versuchen. Sie geht in den Aufenthaltsraum, um einen Kaffee zu trinken, und liest, was dort herumliegt. Als sie zurückkommt, ist er wach. Er möchte Mahlers Fünfte hören.
Zwei Tage später, früher Morgen.
Eine andere Ärztin steht zu Norms Füßen, eine Frau von gut sechzig, die eleganten Platinschmuck trägt. Ein laminiertes Plastikschild weist sie als Leiterin des Hospizes aus. Sie trägt einen pfirsichfarbenen Ärztekittel über ihrer mausgrauen Hose und hat ein Klemmbrett unterm Arm.
«Wie geht’s uns denn?», fragt sie.
«Nicht so gut», sagt Norm. «Mein Nacken tut weh wie verrückt.»
«Wo würden Sie den Schmerz auf einer Skala von eins bis zehn ansiedeln, wenn zehn unerträgliche Schmerzen bedeutet?»
«Achteinhalb.»
«Haben Sie sich mal vom Pflegepersonal umbetten lassen?»
«Leider kann ich nur so und nicht anders liegen», sagt er. «Wegen des Nackens.»
Sie blättert nachdenklich durch die Schriftstücke auf dem Klemmbrett und sagt: «Ich will ganz offen mit Ihnen sprechen. Einige Einträge in Ihrer Akte lassen mich befürchten, dass Sie Erfahrungen mit Drogen haben.»
«Erfahrungen habe ich immer gesucht, aber ich habe in meinem ganzen Leben keine Freizeitdroge genommen!»
«Das hier klingt wie ein Drogensüchtiger, der nach Opiaten verlangt.»
«Woher haben Sie das denn? Ich halte überhaupt nichts von Opiaten.»
«Meine Mitarbeiter sind besorgt, und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll» – sie schüttelt den Kopf, als zweifelte sie an den Notizen auf dem Klemmbrett, die ihre eigene Handschrift tragen –, «weil Sie in Brasilien in irgendeinen satanischen Drogenkult involviert gewesen sein sollen.»
«Was haben die gemacht, mich gegoogelt? Ich dachte, ich bin hier in einem Hospiz und nicht bei der NSA!»
«Palliative Pflege bedeutet die Behandlung des gesamten Menschen», weicht sie geschmeidig aus. «Mit all seinen Eigenarten.»
«Dann lassen Sie mir doch palliative Pflege zukommen! Ich weiß nicht, was mit meinem Nacken nicht stimmt, aber die Massage Ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterin hat bestimmt nicht geholfen. Ich kann mich erinnern, dass einige meiner Kunden etwas einwarfen, das Dilaudid hieß. Soll als Nebenwirkung euphorisch stimmen. Haben Sie so was?»
Sie schüttelt den Kopf. «Wir setzen ausschließlich auf moderne Therapien, damit sich unsere Patienten wohlfühlen.»
«Aber ich fühle mich nicht ‹wohl›. Es ist die Hölle. Doch als Gründer eines Satanskults müsste ich mich hier natürlich wie zu Hause fühlen.»
«Mr. Baker, wenn Sie lieber nicht in einer christlichen Einrichtung –»
Er verdreht die Augen. «Merken Sie nicht, dass ich Witze mache?»
Die Ärztin verschränkt die Arme. «Sich wohlfühlen heißt nicht, keine Schmerzen zu haben. Es heißt, nicht so zu sterben, wie die Menschen gewöhnlich sterben. Schreiend. Es heißt, geistig präsent zu sein.»
«Na, dann vielen Dank, dass Sie mir das rechtzeitig erklären, wo ich hier jetzt mit meinem Arsch festhänge, bis ich tot bin.»
«Mr. Baker, ich muss doch sehr bitten!»
«Na gut. Bitten Sie mich. Sie sind hier schließlich die renommierte Spezialistin für Palliativmedizin. Unternehmen Sie was wegen meinem verdammten Nacken.»
Die Ärztin dreht einen Moment lang den Stift zwischen den Fingern. Sie windet sich, als dächte sie mit den Eingeweiden. Schließlich sagt sie: «Es könnten Muskelkrämpfe sein. Es gibt Patienten, die auf ein Muskelrelaxans ansprechen.»
«Und warum probiert es dann nicht mal jemand aus?», bettelt Norm.
Penny verbringt einen unergiebigen Tag mit Norm, von der Arbeit an seinen Erinnerungen ist keine Rede.
Am Abend fährt sie beunruhigt und rastlos nach Morristown zurück. Auf die Signale des Transponders im Wagen hin öffnet sich das Tor.
Das Haus ist sehr groß und H-förmig; von außen weißer Verputz und hohe Fenster mit schwarzen Fensterläden. Der schwarze Einfassungszaun umschließt einen knappen Hektar.
Als sie durch den Nebeneingang in die Küche kommt, trinkt Amalia ein Bier und monologisiert am Telefon mit Norm. Sie schaut Penny an und sagt: «Muss Schluss machen, cariño. Dein Baby kommt gerade nach Hause. Hab dich lieb. Ciao.» Sie umarmt ihre Tochter und sagt: «Ich weiß, Liebes.»
«Du solltest ihn besuchen», sagt Penny. «Er bekommt einfach nicht die richtigen Schmerzmittel.»
Amalia schüttelt den Kopf. «Ganz bestimmt am Sonntag», sagt sie. «Bei der Arbeit ist es völlig verrückt. Wir sind bis über beide Ohren mit einer Fusion beschäftigt. Es könnte so viel einfacher sein. Wenn er zu Hause wäre, könnte ich ihn täglich sehen.»
«Aber was, wenn er anfängt zu bluten? Und versorgt werden muss? Ich weiß nicht recht, Mom.»
«Wenn er es will, dann finde ich einen Weg. Ich helfe dir. Kannst du mit ihm reden? Damit er nach Hause kommt?»
Am nächsten Morgen hat Norm ein neues Symptom. «U ir ei», erklärt er Penny. «Ih ab as ni ge-ol.»
«Langsam, langsam. Ich verstehe nicht, was du sagst.»
«Ih ab as ni ge-ol. Il ir. Oh. Oh, ei.»
«Hast du Schmerzen?»
«Ah!»
Penny stapft mit Tränen in den Augen zum Schwesternzimmer. «Mein Vater hat immer noch Schmerzen», berichtet sie der Schwester, die dort sitzt. «Und jetzt kann er verdammt noch mal nicht mehr reden.»
«Bitte drücken Sie sich manierlich aus», sagt die Schwester und schaut von ihrem Handy auf. «Schmerzen und Unruhe im letzten Stadium sind normal. Wenn er in den nächsten Minuten nicht einschläft, kann ich den Priester holen lassen.»
«Er ärgert sich, weil er Schmerzen hat und keine Schmerzmittel bekommt! Alles, was er bekommen hat, ist ein Muskelrelaxans!»
Ein Arzt, der an einem Tisch hinter der Schwester sitzt und Formulare ausfüllt, schaut auf und sagt: «Ich kann ihn fragen, ob er ein Beruhigungsmittel möchte.»
«Gute Idee», sagt Penny. «Er hat mir mal erzählt, dass er bei Bootsfahrten immer Valium genommen hat, seit diese Fähre, mit der er auf dem Amazonas unterwegs war, in Brand geriet und er deshalb Angst vor Schiffen bekam. Valium hat ihm da ziemlich gutgetan, hat er gesagt.» Angesichts der Lächerlichkeit von Norms Phobie muss sie beinahe selbst lachen, ist aber überrascht, als der Arzt etwas fast noch Blöderes sagt: dass nämlich Valium seine Leber schädigen könnte.
«Seine Leber schädigen? Wen interessiert das? Er liegt im Sterben!»
«Es könnte den Tod beschleunigen», sagt der Arzt. «Wir geben hier niemandem Hilfestellung, damit er schneller stirbt. Nur Gott entscheidet, wie und wann das geschieht. Wir lassen schlicht der Natur ihren Lauf.»
«Wir sind nicht hierhergekommen, um Gott und die Natur entscheiden zu lassen. Das können wir draußen vor der Tür umsonst haben.»
«Sie müssen verstehen, dass Ihr Vater nicht im Sterben liegt. Noch nicht. Seine Lunge klingt normal. Kein Rasseln. Die Nieren arbeiten. Er ist in einem sehr frühen Stadium. Aber wenn er größere psychische Qualen leidet, als er aushalten kann, könnte ich in Betracht ziehen, ihn in einen leichten Dämmerschlaf zu versetzen. Das ist der neueste Stand der Sterbebegleitung.»
«Zunächst mal müssen Sie dieses Muskelrelaxans absetzen, damit er sich wieder verständlich machen kann! Vorher litt er keine Qualen, er hatte einfach bloß Schmerzen.»
«Ich gehe jetzt zu ihm und frage ihn, ob er ein Beruhigungsmittel möchte, und wir denken weiter über Alternativen nach. Ich verspreche es Ihnen.» Der Arzt gibt Penny die Hand. «Sie sollten nach Hause gehen und sich entspannen. Nehmen Sie sich einen Tag frei und erholen Sie sich.»
«Und wenn er heute stirbt?»
«Auf gar keinen Fall», versichert er ihr.
Vier Tage vergehen. Penny sitzt neben Norm und füttert ihn mit Eiswürfeln. Er hustet. Er rollt die Eiswürfel mit der Zunge im Mund herum, aber er kann das Wasser nicht schlucken. Es rinnt in seinen sehr kurz geschnittenen Bart.
«Er hat keinen Durst mehr», erklärt eine Schwester.
«Wa-ah», protestiert er.
«Er bittet um Wasser», beharrt Penny.
«Das ist nichts als Gewohnheit», erklärt die Schwester weiter. «Er liegt im Dämmerschlaf. Er weiß nicht, was er sagt. Er ist daran gewöhnt, um Wasser zu bitten. Das ist eine Angewohnheit, wie alles andere auch.»
«Wa-ah», sagt Norm.
«Die Mundpflege können Sie auch selbst vornehmen», sagt eine freundliche Krankenschwester zwei Tage später zu Penny. Sie zeigt ihr, wie man den quadratischen, großporigen Schwamm mit Haltestab ins Wasser taucht und an seinen Mund führt.
Norm saugt heftig daran. Sein Speichel bildet ein klebriges Netz um den grünen Schwamm. Die Mundhöhle ist mit gelbem Schleim verkrustet. Die Krankenschwester führt Penny vor, wie man Zähne und Zunge sanft bürstet, aber die Kruste deckt immer noch komplett den weichen Gaumen ab und blockiert seine Luftröhre.
«Können Sie das Zeug nicht rausholen, damit er atmen kann?», fragt Penny.
Die Schwester schüttelt den Kopf. «Wir halten hier nichts vom Absaugen. Das würde sein Leben nur verlängern.»
Penny nimmt einen Tupfer, wischt damit durch Norms Rachen und dreht ihn dabei. Die Substanz klebt daran fest wie Zuckerwatte. Ein Plättchen getrockneten Schleims löst sich vom Rachen wie ein labbriger Pokerchip. Sie befördert es mit einem Tupfer heraus. Nichts kann sie ekeln. Sie ist sanft und liebevoll. Er würgt ein weiteres «Wa-ah» heraus. Die Mundhöhle ist so gut wie sauber. Sie ist rot, grau und golden. Seine goldenen Backenzähne glänzen. Sie hat das Gefühl, etwas geschafft zu haben.
Sie befeuchtet einen Tupfer und schiebt ihn in seinen Mund. Seine Zähne schlagen aufeinander, und er saugt das Wasser heraus.
«Das ist ein Reflex», sagt die Krankenschwester.
Nach drei weiteren feuchten Tupfern marschiert Penny zum Schwesternzimmer.
«Ich nehme meinen Dad mit nach Hause», sagt sie zu der wieder mal anderen Ärztin, die am Schreibtisch sitzt und Papierkram erledigt. «Es ist mir völlig egal, ob das gegen Ihren ärztlichen Rat passiert.»
«Es ist normal, dass Patienten sagen, sie wollten nach Hause», sagt sie. «Es ist eine universelle Metapher dafür, dass man seinen Frieden in der Liebe Gottes findet.»
«Glauben Sie überhaupt an Gott? Sie reden wie das Hospiz-Handbuch.»
«Ich glaube an eine höhere Macht.»
Eine Zimmertür geht auf, und ein sehr alter Mann in einem Krankenhauskittel aus Papier mit dicken, kräftigen Gliedmaßen stolpert auf den Gang. Er keilt mit den Ellbogen gegen die Schwester aus, die ihm nacheilt. Penny folgt ihnen bis zur Doppeltür aus Glas, die in den Garten führt. Der alte Mann steht neben der Vogeltränke und sucht den Parkplatz nach seinem Wagen ab, während die Schwester ihm Vorhaltungen macht. Er hat keinen Schlüssel und keine Kleidung. Es ist kühl draußen. Ein Wachmann bringt einen Rollstuhl, und drei Mitarbeiter begleiten ihn zurück in sein Zimmer.
Penny geht wieder zum Schwesternzimmer und sagt zu der Ärztin: «Wenn es eine höhere Macht gibt, warum lässt sie zu, dass Menschen so schwach wie mein Dad werden und trotzdem noch Schmerzen spüren können?»
«Wenn er Schmerzen hätte, wüssten wir das.»
«Das stimmt nicht», sagt Penny. «Er ist ein Stoiker.»
«Wir wissen nicht, was er empfindet», sagt die Ärztin. «Wenn Menschen sehr krank sind, verändert sich ihre Wahrnehmung. Wir beschleunigen das Ende des Lebens nicht. Jedes menschliche Wesen hat das Recht auf Selbsterfahrung, besonders zum Ende hin, wenn wir unseren Frieden mit Gott machen. Vielleicht möchten Sie mit unserem Kaplan sprechen.»
Geschlagen wendet Penny sich ab.
Sie geht durch die Eingangstür hinaus und den Betongehweg entlang, vorbei an den Behindertenparkplätzen, bis sie nicht mehr auf dem Hospizgelände ist. Am Straßenrand raucht sie eine Zigarette. Der Rinnstein liegt voller Kippen. Ein Wagen bremst ab, der Fahrer wirft ihr einen fragenden Blick zu. Sie dreht sich um und starrt das Hospiz an.
Penny ist zutiefst aufgewühlt und verzweifelt.
Norm hat die Welt erschaffen, in der sie einst gelebt hat, hat Wort für Wort ihr Wesen definiert. Aber sein Wort, das einst Gesetz war, muss sich nun einem höheren Gesetz beugen. Er ist so schwach, dass schon eine Fliege, die sich auf seiner Nase niederließe, Ausdruck eines höheren Gesetzes wäre. Er könnte sie nicht totschlagen. Er und Penny sind Teil einer Welt, die nicht die ihre ist.
Wenn seine Augen ihre suchen, glänzend vom Todeswunsch und voller Hoffnung, dass sie ihm beim Sterben helfen wird, empfindet sie eine Liebe, die ihr wie mit einem Sägemesser das Herz herausschneidet und es ihrem Vater überreicht.
Vier Tage später kommt Amalia zu Besuch und bringt Norm seine Hauskatze in einem Reisekorb mit.
Die Katze, ein kastrierter Kater namens Schubert, ist klein und schwarz und sehr hübsch, mit orangefarbenen Augen. Sie drückt sich an die Rückseite des Reisekorbs. «Schau mal, wen ich mitgebracht habe!», sagt Amalia und stellt den Korb schwungvoll auf das Bett, wo er gegen Norms Hüfte schlägt. «Er schläft», flüstert sie Penny zu.
«Er könnte auch wach sein. Seine Augen sind verklebt.»
Amalia beugt sich vor und sieht, dass Norms Augenlider mit getrocknetem Schleim verkrustet sind. «O Gottogott! Ich hätte früher kommen sollen. Ich hatte einfach so viel zu tun.» Sie stellt den Korb zu ihren Füßen auf den Boden und fragt: «Hast du mit Patrick gesprochen?»
«Nein. Hätte ich das tun sollen?»
«Er sagt, er hat dich angerufen. Er schafft es nicht, aber er weiß, dass Norm das verstehen wird. Er hängt gerade eine wichtige Fotoausstellung in Jakarta.»
Norm sagt: «Wa-ah.»
Amalia ergreift seine Hände. «Ich bin da, Schatz», sagt sie. «Schlaf weiter. Ich liebe dich!»
Norm rollt die rechte Hand von einer Seite zur anderen.
«Seit Wochen habe ich ihn die Hände nicht bewegen sehen», ruft Penny aus.
«Und dein Kätzchen vermisst dich auch», sagt Amalia zu ihm. Sie holt Schubert aus dem Korb und setzt ihn auf die Bettdecke, Norm gegenüber. Sie presst die Vorderbeine gegen seinen Brustkorb und und hält ihn so, dass Norm ihn streicheln kann.
Ganz langsam hebt Norm die Hände und legt sie um den Hals der Katze, als wollte er sie würgen. Die Daumen drücken kräftig auf Schuberts Kehle.
Die Katze faucht und schlägt die Krallen tief in seinen rechten Unterarm.
«Verdammt», sagt Penny, ergriffen von der Kraftanstrengung und dem Willen ihres Vaters.
«O Gott», sagt Amalia, ergriffen von dem Blut, das aus dem aufgerissenen Fleisch quillt. Norm zuckt nicht zusammen und gibt auch keinen Laut von sich. Seine Hände fallen auf die Decke. Der rechte Unterarm klafft wie ein geteilter Granatapfel, und er scheint einzuschlafen. Schubert flieht und versteckt sich unter dem Bett.
Penny ist sich sicher – hundertprozentig sicher –, dass dies ein Versuch war, Amalia zu vermitteln, sie solle ihn ersticken. Dass er ihr, Penny, nicht zutraut, ihm einen solchen Wunsch zu erfüllen, ihrer Mutter aber sehr wohl.
«Komm schon, miez miez», sagt Amalia auf den Knien. «Ich hätte den armen kleinen Kater nicht mit ins Auto nehmen dürfen. Jetzt glaubt er, er wäre beim Tierarzt.»
Am nächsten Morgen ist Norms Wunde stark entzündet. Der Strang der Blutvergiftung reicht bis zur Schulter. Unter der dicken Wattebandage blutet der Arm weiter.
«Jetzt wird er an Blutvergiftung sterben», sagt ein Pfleger zu Penny. «Dieser Mann hat kein Immunsystem mehr.» Er streicht ein frisches Laken glatt, während zwei Schwestern den auf die Seite gerollten Norm stützen. Seine Haut, weich wie Seide und bar jeglicher Muskeln und Fett, liegt wie ein Schleier über dem Skelett.
Kurz darauf überrascht die zweite stellvertretende Hospizleiterin Penny mit der Einladung, sich mit ihr ins Foyer zwischen Stutzflügel und flackernden Gaskamin zu setzen. «Ich habe mit Ihrer Mutter gesprochen», sagt sie, «wir werden ihn heute Nachmittag in die häusliche Pflege überführen. Es gab keine Vorkommnisse, die unser Eingreifen erfordert hätten. Seine Vitalparameter sind gut.»
«Sie wollen mich wohl verarschen», sagt Penny.
«Ich gebe zu, wir haben erwartet, dass er ausblutet. Er hat nur minimal Thrombozyten, aber es gab einfach keine hinreichende Verletzung. Er hat weder gegessen, noch ist er aufgestanden. In diesem Stadium erwarten wir, dass der Tod durch Nierenversagen eintritt, vorausgesetzt, er fängt nicht wieder an zu trinken. Ich würde dringend von Intubation oder intravenösen Flüssigkeitsgaben abraten.»
«Genau, genau», sagt Penny. «Keine Schmerzmittel, weil sie den Tod beschleunigen, und keine Flüssigkeiten, weil sie das Leben verlängern.»
Die zweite stellvertretende Hospizleiterin legt Penny die Hand auf die Schulter. «Das alles muss sehr schwer für Sie sein.»
«Für ihn ist es schwerer.»
«Es wird leichter werden. Mit diesem Arm wird er ziemlich schnell an einer systemischen Blutvergiftung sterben.»
Norms Patientenverfügung – ein Endspiel, das Final Jeopardy viel zu sehr gleicht, um Mut zu machen – untersagt den Einsatz von Antibiotika.
Penny beißt sich auf die Lippen und schweigt.
Sie sitzt mit einer Mitarbeiterin des Kliniksozialdienstes in einem beengten Büro hinter dem Empfangstresen und bespricht Ausstattung und Hilfe, die sie in Morristown brauchen werden.
Sie werden ein verstellbares Bett geliefert bekommen, wie das im Hospiz. Zweimal am Tag wird eine Schwester ihr helfen, Norms Windel zu wechseln. Sie wird sich mit der Bedienung des Notfallpacks in entsprechenden Situationen vertraut machen.
Penny sagt zu allem Ja und Amen, und die Mitarbeiterin greift zum Telefon. Sie fragt Penny, ob jetzt jemand zu Hause ist, weil das Bett schon im Lieferwagen steht.
Penny holt ihre Tasche und den Laptop aus Norms Zimmer – er schläft tief und fest – und fährt nach Morristown, um auf das Bett zu warten.
Sie schafft Platz in seiner Bibliothek, dem einzigen teppichlosen Raum im Erdgeschoss. Die Beistelltische sind klein, es ist nicht schwer, sie in ein anderes Zimmer zu bringen. Sie betrachtet die Bücher, die ihn während seiner letzten Tage umgeben werden: Norman O. Brown, Georges Bataille, Jack London, Lévi-Strauss, Castañeda, Teilhard de Chardin, William James. Und seine eigenen Arbeiten: Shamanism: Modern Social and Cognitive Aspects. The Cosmic Snake of Healing. Disengaging Death: From Cancer to Dancer. Würde er sagen, dass ihm die Bücher wichtig sind, wenn er sich äußern könnte? Sie weiß es nicht.
Am Spätnachmittag kommt der Krankenwagen mit zwei stämmigen Rettungssanitätern. Norm reitet auf seinem schimmernden, rot-silbernen Katafalk in den Hausflur, und er keucht, hat aber nicht gestöhnt, als es die Eingangstreppe hinaufging. Die Männer heben Norm auf das niedrige, wuchtige Bett und decken den Körper mit einem übergroßen Laken zu. Schubert rollt sich auf Norms Bauch zusammen. Penny bereitet Eiswürfel und Tupfer vor für den Fall, dass er den Mund öffnet. Er scheint kraftlos zu sein. Ein Pfleger kommt, um sie einzuweisen. Er zeigt ihr, wie man mit Gummihandschuhen Salbe auf die wundgelegenen Stellen aufträgt und die Subkutannadel ansetzt.
An diesem Abend eilt Amalia nach der Arbeit zu ihm und kniet sich neben das Bett. «Liebling, Liebling», sagt sie und küsst ihn. «Ich bin so froh, dass du nach Hause gekommen bist.» An Penny gewandt, fügt sie hinzu: «Er antwortet nicht.»
«Er ist auf Morphin und Haloperidol.»
«Ich wünschte, wir könnten reden.»