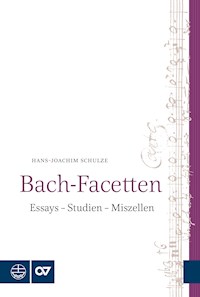
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In sieben Kapiteln, deren Spektrum von Biographie und Familie, über Schüler- und Freundeskreis, Aufführungspraxis, Texte und Quellen bis zur Wirkungsgeschichte in den vergangenen drei Jahrhunderten reicht, sind in diesem hervorragenden Band des renommierten Bachkenners Hans-Joachim Schulze mehr als 60 Aufsätze aus fünfzig Jahren zusammengefasst und, soweit erforderlich, durch Nachträge auf den aktuellen Stand der Bach-Forschung gebracht worden. Beigegeben ist ein von Rosemarie Nestle und Marion Söhnel erarbeitetes Schriftenverzeichnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1222
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANS-JOACHIMSCHULZE
BACH-FACETTEN
Essays – Studien – Miszellen Mit einem Geleitwort von Peter Wollny
Hans-Joachim Schulze, Dr. phil., Jahrgang 1934, war von 1992 bis 2000 Direktor des Bach-Archivs Leipzig und 1975 bis 2004 Mitherausgeber des Bach-Jahrbuchs. Von 1987 bis 1995 lehrte er an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ist seit 1993 Honorarprofessor an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Schulze ist Autor zahlreicher Publikationen zu Johann Sebastian Bach, seiner Familie und seiner Zeit.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2017 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Cover: Ulrike Vetter, Leipzig
Satz: Steffi Glauche, Leipzig
ISBN 978-3-374-04838-0
www.eva-leipzig.de
Carus-Verlag Stuttgart · Carus 24.085
ISBN 978-3-89948-297-3
www.carus-verlag.com
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Geleitwort
Zum Geleit
Vorwort
I BIOGRAPHIE UNDFAMILIE
A Von der Schwierigkeit, einen Nachfolger zu finden
Die Vakanz im Leipziger Thomaskantorat 1722–1723
B Zwischen Kuhnau und Bach
Das folgenreichste Interregnum im Leipziger Thomaskantorat. Anmerkungen zu einer unendlichen Geschichte
C »… da man nun die besten nicht bekommen könne …«
Kontroversen und Kompromisse vor Bachs Leipziger Amtsantritt
D Johann Christoph Bach (1671–1721), »Organist und Schul Collega in Ohrdruf«
Johann Sebastian Bachs erster Lehrer
E Von Weimar nach Köthen
Risiken und Chancen eines Amtswechsels
F Eine Buch-Auktion im September 1742
G »Wer der alte Bach gewesen weiß ich wol«
Anmerkungen zum Thema Kunstwerk und Biographie
H »Zumahln da meine itzige Frau gar einen sauberen Soprano singet …«
I »Die Bachen stammen aus Ungarn her«
Ein unbekannter Brief Johann Nikolaus Bachs aus dem Jahre 1728
K Notizen zu Bachs Quodlibets
L Johann Elias Bachs Briefentwürfe als Zeitdokumente
M Regesten zu einigen verschollenen Briefen Carl Philipp Emanuel Bachs
N Wann begann die »italienische Reise« des jüngsten Bach-Sohnes?
O Noch einmal: Wann begann die »italienische Reise« des jüngsten Bach-Sohnes?
II SCHÜLER- UNDFREUNDESKREIS, FÖRDERER
A Wer intavolierte Johann Sebastian Bachs Lautenkompositionen?
B »Monsieur Schouster«
Ein vergessener Zeitgenosse Johann Sebastian Bachs
C Der unterschätzte Bach-Schüler
Johann Friedrich Schweinitz
D Die Briefe von Johann Gottfried Walther
E Christan Friedrich Henrici (»Picander«) zum 300. Geburtstag am 14. Januar 2000
F Anna Magdalena Bachs »Herzens Freündin«
Neues über die Beziehungen zwischen den Familien Bach und Bose
G Adeliges und bürgerliches Mäzenatentum in Leipzig
III AUFFÜHRUNGSPRAXIS UNDMITWIRKENDE
A Bachs Aufführungsapparat
Zusammensetzung und Organisation
B Bachs Leipziger Wirken und die »ehemalige Arth von Music«
C Studenten als Bachs Helfer bei der Leipziger Kirchenmusik
D Besitzstand und Vermögensverhältnisse von Leipziger Ratsmusikern zur Zeit Johann Sebastian Bachs
E Cembaloimprovisation bei Johann Sebastian Bach
Versuch einer Übersicht
F Zur Frage des Doppelaccompagnements (Orgel und Cembalo) in Kirchenmusikaufführungen der Bach-Zeit
G Wunschdenken und Wirklichkeit
Nochmals zur Frage des Doppelaccompagnements in Kirchenmusikaufführungen der Bach-Zeit
IV TEXTE UNDPARODIEN
A Bachs Parodieverfahren
B Parodie und Textqualität in Werken Johann Sebastian Bachs
C »… gleichsam eine kleine Oper oder Operette …«
Zum Dramma per Musica bei Johann Sebastian Bach
D »Amore traditore«
Zur Herkunft eines umstrittenen Kantatentextes
E Johann Sebastian Bachs dritter Leipziger Kantatenjahrgang und die Meininger »Sonntags- und Fest-Andachten« von 1719
F Wege und Irrwege
Erdmann Neumeister und die Bach-Forschung
V WERKE
A Probleme der Werkchronologie bei Johann Sebastian Bach
B Die Handhabung der Chromatik in Bachs frühen Tastenwerken
C Rätselhafte Auftragswerke Johann Sebastian Bachs
Anmerkungen zu einigen Kantatentexten
D Die Bach-Kantate »Nach dir Herr, verlanget mich« und ihr Meckbach-Akrostichon
E Reformationsfest und Reformationsjubiläen im Schaffen Johann Sebastian Bachs
F Sonate G-Dur für Violine und Basso continuo (BWV 1021)
G Missa h-Moll BWV 232/I
Die Dresdner Widmungsstimmen von 1733: Entstehung und Überlieferung
H Fantasie und Fuge c-Moll für Cembalo (BWV 906)
I Melodiezitate und Mehrtextigkeit in der Bauernkantate und in den Goldberg-Variationen
VI QUELLEN, SAMMLUNGEN, BIBLIOTHEKEN
A »Wo Gott der Herr nicht bei uns hält« (BWV 1128)
Quellenkundliche Überlegungen
B Telemann – Pisendel – Bach
Zu einem unbekannten Bach-Autograph
C Ein »Dresdner Menuett« im zweiten Klavierbüchlein der Anna Magdalena Bach
D Ein apokryphes Händel-Concerto in Johann Sebastian Bachs Handschrift?
E Eine rätselhafte Johannes-Passion »di Doles«
F Bach-Überlieferung in Hamburg
Der Quellenbesitz von Christian Friedrich Gottlieb Schwencke (1767–1822)
G Karl Friedrich Zelter und der Nachlaß des Bach-Biographen Johann Nikolaus Forkel
Anmerkungen zur Bach-Überlieferung in Berlin und zur Frühgeschichte der Musiksammlung an der Königlichen Bibliothek
H Rara, Rarissima, Unica
I 50 Jahre Bach-Archiv Leipzig
VII WIRKUNGSGESCHICHTE IM 18., 19. UND 20. JAHRHUNDERT
A Ein »Drama per Musica« als Kirchenmusik
Zu Wilhelm Friedemann Bachs Aufführungen der Huldigungskantate BWV 205a
B Humanum est errare
Text und Musik einer Chorfuge Johann Sebastian Bachs im Urteil Friedrich Wilhelm Marpurgs
C Carl Philipp Emanuel Bachs Hamburger Passionsmusiken und ihr gattungsgeschichtlicher Kontext
D Unterschiedlichkeit dokumentarischer Überlieferung
Bach und Mozart im Vergleich
E Beethoven und Bach
F Bach – Leipzig – Mendelssohn
G Johann Sebastian Bach im Urteil Moritz Hauptmanns
H Carl Hermann Bitter
»Johann Sebastian Bach«
I Heile Welt der Forschung
Das Bach-Jahrbuch
K 100 Jahre Bach-Jahrbuch
L Die Neue Bach-Ausgabe
Auch eine deutsch-deutsche Geschichte
M Zur Kritik des Bach-Bildes im 20. Jahrhundert
Abkürzungen
I. Literatur und Quellen
II. Bibliotheken und Archive
Anhang
Bibliographie (Veröffentlichungen von Hans-Joachim Schulze, zusammengestellt von Rosemarie Nestle und Marion Söhnel, Leipzig, 3.12.2014 [mit Nachträgen bis 2017])
Register
Kompositionen
I. Werke Johann Sebastian Bachs
II. Werke anderer Komponisten
Personen
Weitere Titel
Anmerkungen
GELEITWORT
ZUMGELEIT
Das 1950 – im Jahr der 200. Wiederkehr von Johann Sebastian Bachs Todestag – gegründete Bach-Archiv Leipzig verfolgte von Anbeginn das Ziel, das umfangreiche Quellenmaterial zu Bachs Leben und Wirken zentral zu erfassen und den kostbaren Bestand der weit verstreuten Musikhandschriften – zunächst in Mikrofilmaufnahmen und Fotokopien, seit geraumer Zeit auch elektronisch – zu sammeln und auszuwerten. Daß die Institution sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem weltweit renommierten Forschungszentrum entwickeln konnte, ist nicht zuletzt dem Wirken ihres langjährigen Direktors Hans-Joachim Schulze zu verdanken, der dem Haus seit nunmehr sechzig Jahren verbunden ist und der seine gesamte berufliche Laufbahn der Erforschung von Bachs Leben und der Erkundung von Entstehung, Überlieferung und Wirkungsgeschichte seiner Kompositionen gewidmet hat.
Die von Schulze im Zuge seiner Arbeiten an den Bach-Dokumenten (1963–1979, 2007) entwickelten Methoden und Blickweisen haben der Forschung grundlegende neue Perspektiven eröffnet und über die Jahre hinweg reiche Früchte getragen. In seinen Arbeiten bemühte und bemüht er sich darum, die Lebenswirklichkeit vergangener Zeiten einzufangen. Die hierzu notwendige Empathie ist selbst dort noch zu spüren, wo es um abstrakte Befunde von Schriftformen und Wasserzeichen geht. In Schulzes Arbeiten, die sich durch ihre geschliffene Diktion und hochentwickelte Kunst des verbalen Porträtierens auszeichnen, hat das von der älteren Forschung entworfene heroenhaft distanzierte Bach-Bild erstmals menschliche Züge gewonnen. Die umsichtige, ausgewogene und facettenreiche Darstellung komplexer Zusammenhänge setzt Akribie und umfassende Kenntnis selbst der entlegensten Literatur voraus. Zugleich aber gilt das Diktum, mit dem Hans Wollschläger die Arbeit des Historikers Ferdinand Gregorovius charakterisierte: Ausgezeichnet mit einer tiefen, empfänglichen Liebe zur Literatur weiß der Autor um die sinngebende Macht der Worte und hat erkannt, daß die Präzision und Logik des syntaktischen Gefüges funktionellen Zusammenhang stärker noch stiften kann als die, oft scheinhafte, Ursachen- und Wirkungsordnung der Fakten selbst.1
Diese doppelte Qualität zeigt sich nachdrücklich in den hier versammelten meist biographisch akzentuierten Schriften, die etwas andere Schwerpunkte setzen als die bereits 1984 in den Studien zur Bach-Überlieferung im 18. Jahrhundert publizierten Arbeiten und die 2006 erschienene Sammlung von Werkeinführungen zu Bachs Kantatenschaffen.
Die Veröffentlichung dieses Buchs wurde ermöglicht durch die großzügige finanzielle Unterstützung dreier Einrichtungen: der Neuen Bachgesellschaft, der ihr angegliederten Johann-Sebastian-Bach-Stiftung und der Vereinigung der Freunde des Bach-Archivs Leipzig. Ich danke deren Vorständen für ihr Engagement. Dank gebührt auch der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig und ihrer Leiterin Frau Dr.Anette Weidhas für die verlegerische Betreuung.
Leipzig, im März 2017
Peter Wollny
VORWORT
Dem Erreichen einer gewissen Altersstufe folgen häufig genug Rückschau und Bilanz: Was wurde erreicht, was wurde versäumt, was läßt sich noch nachholen? Weit seltener ist ein solches Innehalten verbunden mit der Gelegenheit, in einer Anthologie eine repräsentative Auswahl des in Jahrzehnten Zusammengetragenen, Erforschten, in Frage Gestellten oder auch nur Angeregten vorzulegen. Daß in meinem Falle ein solches Florilegium tatsächlich das Licht der Welt erblicken kann, und dies ungeachtet aller Bedenken, die dergleichen Wiederveröffentlichungen mit sich bringen, ist allein der Initiative meiner Kollegen Helmut Loos und Peter Wollny zu verdanken. Da dieses – hauptsächlich dem Thema Bach-Forschung gewidmete – Unternehmen anläßlich meines 80. Geburtstags in Gang gesetzt wurde, stellt es sich in eine Reihe mit einigen bereits vorliegenden Bach-Anthologien, bei denen bezüglich der dergestalt Geehrten allerdings eine geringere Zahl absolvierter Lebensjahre als hinlänglich erschienen war: Robert L. Marshall und Christoph Wolff (je 50), Georg von Dadelsen (65), Alfred Dürr (70), Friedrich Smend (75).
Die Auswahl der im vorliegenden Band zusammengefaßten Beiträge zielt auf eine möglichst breite Palette, wobei Quellenkunde, Biographik, Personen- und Zeitgeschichtliches den Vorzug genießen. Bloße Werkeinführungen, theologische Exkurse, Zahlenspekulationen wird man vergeblich suchen, auch Rezensionen wurden nicht aufgenommen, wiewohl dort verschiedentlich Material ausgebreitet ist, das anderwärts nicht berücksichtigt wurde. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich um relativ kurze Texte, bedingt durch deren Entstehungsumstände als Beiträge zu Festschriften, als Konferenzreferate oder als »Kleine Beiträge« für das Bach-Jahrbuch. Manche thematische Begrenzung erklärt sich durch die Abfassung unter den Bedingungen des bis 1989 existierenden Eisernen Vorhangs, der die Heranziehung von Quellen und anderen Unterlagen aus »westlichen« Bibliotheken und Archiven erschwerte oder gänzlich verhinderte; anderes gehört eher zu einer Art Generationenkonflikt, dem aus persönlichen oder auch politischen Gründen resultierenden eifersüchtigen Wachen Einzelner über ihre vermeintlich angestammten Claims. Dem Widerstand gegen einen solchen Verdrängungswettbewerb dient in einer Anzahl von Beiträgen das aus heutiger Sicht viel zu häufige Zitieren eigener Arbeiten, wofür um Nachsicht gebeten werden muß.
Die Textgestalt der Beiträge folgt mit geringfügigen Ausnahmen den Originalveröffentlichungen. Dies gilt insbesondere für die heute so zu nennende traditionelle Rechtschreibung (erster wieder gesamtdeutscher Duden von 1991/92), an der der Verfasser aus Überzeugung festhält. Eine Handvoll kleinerer Fehler wurde stillschweigend korrigiert – Mißgriffe bezüglich des Vokabulars sowie Irrtümer in Orthographie und Zeichensetzung. Verbesserungen seitens ehemals tätiger Herausgeber von Konferenzberichten und anderen Sammelbänden wurden übernommen, manche »Verschlimmbesserungen« jedoch rückgängig gemacht. Inhaltlich unverändert bleiben konnten auch die Fußnoten (beziehungsweise die in Fußnoten umgewandelten ursprünglichen Endnoten einiger Texte), jedoch wurden diese in ihrer Form so weit wie möglich dem aktuellen Standard des Bach-Jahrbuchs angeglichen. Letzteres gilt insbesondere für die Verwendung der dort üblichen Literatur- und Quellenabkürzungen, die eine erhebliche Platzersparnis ermöglichte. Inhaltliche Änderungen beziehungsweise Zusätze wurden, sofern erforderlich, am Ende jedes Beitrags untergebracht und als »Nachtrag 2017« gekennzeichnet.
Die als Anhang beigegebene, von Rosemarie Nestle und Marion Söhnel mit großer Akribie zusammengetragene und aufbereitete Bibliographie, die meinerseits nur wenige kosmetische Korrekturen und Ergänzungen erforderlich machte, beschränkt sich aus naheliegenden Gründen auf gedruckte Texte. Nur in Manuskriptform Vorliegendes, insbesondere Vorträge und Unterlagen zu Rundfunksendungen, blieb unberücksichtigt. Zu einigen wenigen Sonderfällen sei folgendes bemerkt. Im Sinne des oben Angedeuteten wurde bei einer Notenausgabe (Nr.309) mein Name vorsätzlich weggelassen, in einem anderen Fall im »Kleingedruckten« versteckt (5), bei noch anderer Gelegenheit »vergessen« und mittels gedruckter Erratazettel nachgeschoben. Zwei Gelegenheitsvorträge, die von mir keinesfalls zur Veröffentlichung bestimmt waren, sind ohne meine Zustimmung und ohne vorhergehende Information in übersetzter Form erschienen (62 und 102). Unter einer Abhandlung über die wiederaufgefundenen Bestände aus der Bibliothek der Sing-Akademie zu Berlin (166) steht zwar mein Name, doch stammt der Text keinesfalls aus meiner Feder. Ein gelegentlich vorgetragenes Grußwort anläßlich eines Bibliotheksjubiläums wurde gedruckt und ohne mein Zutun mit einem skurrilen Titel versehen (75). Feststellungen über die Herkunft der Texte zu Telemanns »Moralischen Kantaten« lagen ehedem rechtzeitig vor und sollten in Verbindung mit der zuständigen Notenausgabe publiziert werden (318). Die Herstellung des Notentextes zog sich jedoch so lange hin, daß der in der Druckerei als »Stehsatz« aufbewahrte Textanteil mittlerweile verlorengegangen war und neu hergestellt werden mußte. Durch den so entstandenen Zeitverlust ist das »Erstgeburtsrecht« für den erwähnten Textfund nur mit Mühe aufrechtzuerhalten.
Mein Dank gilt den beiden erwähnten Initiatoren, den Bearbeiterinnen der Bibliographie, einigen Kollegen des Bach-Archivs Leipzig, die das Einscannen einer Reihe älterer Texte besorgten, den Förderern Bach-Stiftung, Vereinigung der Freunde des Bach-Archivs und Neue Bachgesellschaft (sämtlich Leipzig), deren Beiträge das Erscheinen dieses Bandes ermöglichten, sowie dem Verlag für das sorgfältige Betreuen der Herstellungsarbeiten.
Leipzig, im Frühjahr 2017
Hans-Joachim Schulze
IBIOGRAPHIE UNDFAMILIE
AVON DERSCHWIERIGKEIT, EINENNACHFOLGER ZU FINDEN
Die Vakanz im Leipziger Thomaskantorat 1722–1723*
Uns Heutigen, die wir gewohnt sind, die altberühmte Trias Thomaskirche, Thomanerchor und Thomaskantorat gleichsam instinktiv mit dem Namen Bach zu verbinden, fällt es nicht leicht zu begreifen, daß die Chancen für eine dauernde Bindung Bachs an Leipzig anfangs theoretisch und praktisch gegen Null tendierten. Trotzdem müssen wir uns um der geschichtlichen Wahrheit willen damit zurechtfinden, daß Bach zu keinem Zeitpunkt, und auch nicht in dem Augenblick, da in Leipzig eines der wichtigsten musikalischen Ämter zur Neubesetzung auszuschreiben war, von seiner Mitwelt als der alles Überragende angesehen worden ist, dem eine so bedeutende Stelle zu allererst anzutragen gewesen wäre. So ist es weder die Schuld Bachs noch die der Leipziger Stadtväter, wenn es mehrmals – aus heutiger Sicht viel zu oft – der helfenden Hand des Zufalls bedurfte, ehe die Besetzungsfrage in einer Weise geregelt war, daß in Leipzig ein Kapitel Weltmusikgeschichte beginnen konnte.
Wie schwer sie sich mit der Berufung eines neuen Thomaskantors tun würden, hatten die Leipziger Bürgermeister und Prokonsuln, Stadtrichter und einfachen Ratsherren des Jahres 1722 sicherlich nicht geahnt: Hatten sie doch im Gegenteil weitsichtig geplant wie nie zuvor und so frühzeitig wie irgend möglich die Weichen gestellt, um dem leidigen Problem übermäßig langer Vakanzen aus dem Wege zu gehen. Wenn trotzdem ihre Vorstellungen sich in nichts auflösten, das schon sicher Geglaubte zwischen den Fingern zerrann und sie sich immer wieder an den Ausgangspunkt ihrer Bemühungen zurückgeworfen sahen, dann sind subjektive Faktoren dafür ohne weiteres mit maßgebend gewesen. Doch im Grunde genommen gehören auch diese in den Zusammenhang einer Entwicklung, die sich in vielen deutschen Städten des 17. und 18. Jahrhunderts vollzog, wenngleich mit zahlreichen politisch und lokalgeschichtlich bedingten Varianten.
Die Zersplitterung des Landes als Ergebnis des Dreißigjährigen Krieges, die Etablierung feudalabsolutistischer Territorialherrschaften in kaum überschaubarer Zahl und Vielfalt, dazu das allzu langsame wirtschaftliche und gesellschaftliche Erstarken des Bürgertums bildeten den Hintergrund für einen ziemlich anachronistischen Wettbewerb zwischen Bürgertum und Adelsschichten, der auch wesentliche Bereiche des Musiklebens beeinflußte. Das zunehmende Repräsentationsbedürfnis der städtischen Führungskreise, also der Wunsch nach Betonung und Bestätigung des eigenen gesellschaftlichen Ranges, führte zumal im 17. Jahrhundert zu einer bewußten Förderung der Kirchenmusik als einer quasi offiziellen und in jeder Hinsicht unantastbaren Kunstform, die sich aber – und dies gegen den Wunsch des Kleinbürgertums wie auch weiter Kreise der Geistlichkeit – durchaus der modernen, aktuellen Kompositionstechniken bedienen sollte. Die drohende Gefahr, daß solchergestalt die Auswüchse der verdächtigen und als moralgefährdend verschrienen Opernkunst als musikalische Konterbande in die Kirche gelangen sollten, rief vor allem diejenigen auf den Plan, die sich dem Gedankengut des Pietismus verbunden fühlten und um ihrer religiösen Ideale willen diese Art äußeren Aufwandes verabscheuten: Teile der Geistlichkeit, des Kleinbürgertums, der Landesherren. Teilerfolge dieser Gegner der konzertierenden Kirchenmusik konnten nicht verhindern, daß die von den Räten geförderte zunehmende Pflege der gottesdienstlichen Musik zu einer Aufwertung der Kantorenämter führte, gelegentlich auch zu einer Besserung der Einkünfte, vor allem auf der Basis bestellter Gelegenheitskompositionen.
Diese Herausbildung kontroverser Standpunkte war auch an den führenden Kreisen des Leipziger Bürgertums nicht spurlos vorübergegangen und hatte schon 1677 bei einer Neubesetzung des Thomaskantorats zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten im Rat geführt. Damals hatte sich der einflußreiche Bürgermeister Christian Lorenz von Adlershelm mit Vehemenz für den besten Musiker unter den Bewerbern, den Thüringer Georg Bleyer, eingesetzt, war aber auf den entschiedenen Widerstand derjenigen gestoßen, die nach hergebrachter Weise im Thomaskantor auch einen Schullehrer sehen wollten. »Die Kirche erforderte einen guten Musicum«, heißt es im Protokoll, »die Schule einen guten Informatorem, welches nicht aus den Augen zu verlieren. Bleyer möchte ein guter Musicus sein, hätte aber viel Schwachheit an sich.«
Gewählt wurde schließlich Johann Schelle. Johann Pezel, der berühmte Stadtpfeifer und Komponist von Bläsermusiken, verfiel schon im Hinblick auf seinen derzeitigen Beruf der Ablehnung. Vierundzwanzig Jahre später, im Mai 1701, als die Stelle erneut zu besetzen war und die Streithähne von 1677 längst im Grabe ruhten, taktierte man weit vorsichtiger und versuchte, einen bereits am Ort Tätigen, den Thomasorganisten Johann Kuhnau, zu inthronisieren.
Bürgermeister Falckner meinte, »Herr Kuhnau wäre ein guter Musicus und Componist. Er hätte ihn bereits gefragt, ob ihm die Schüler auch parieren würden, worauf er geantwortet, er tractierte seine Sachen mit Liebe, allenfalls aber wollte er es denen Obern hinterbringen.« Ein anderer Ratsherr »richtete auf Herrn Kuhnau seine Gedancken, ob er schon etwas unansehnlich wäre. Es seye ihme zu sagen, daß er die Musik nicht so weitläuftig einrichtete.«
Erneut, wie schon ein Vierteljahrhundert vorher bei der Wahl Johann Schelles, hatten die konservativen Kräfte hier Oberwasser. Kuhnau, ein »guter Musicus« und namhafter Jurist, wurde umgehend von seiner Wahl unterrichtet, zur Aufgabe seiner Anwaltspraxis veranlaßt und, obwohl bekanntermaßen kein Neutöner, verpflichtet, »damit alles in Ordnung bleibe, die Music nicht zu lang zu machen, auch solche also einzurichten, damit sie nicht opernhafftig herauskommen, sondern die Zuhörer zur Andacht aufmuntern möge.«
Nicht zu bezweifeln ist, daß die Verantwortlichen sich der Bedeutung der Kantoratswahl durchaus bewußt waren, denn schon 1677 hatte man protokolliert, »es schiene zwar ein schlechter [einfacher, gering bezahlter] Dienst zu sein, wäre aber von ziemlicher Importanz, darbei sich stattliche Leute befunden, als Sethus Calvisius, Herman Schein, Tobias Michael« und »ungeachtet dieser Dienst sonst nicht allzu wichtig schiene, aber doch jederzeit mit wackern Subjectis bekleidet gewesen.«
So ist auch nicht anzunehmen, daß die auf Repräsentation bedachten, an einer aktuellen, modernen Kirchenmusik interessierten Kreise des Rates und der ihnen nahestehenden Teile des Bürgertums sich nach dem Sieg der Konservativen zu einem vollständigen Verzicht durchgerungen hätten. Vielmehr scheinen sie auf eine Verlagerung des Schwergewichts der Leipziger Musikpflege gesetzt zu haben, die notfalls auf Kosten der Thomasschule und damit der städtischen Hauptkirchen St. Thomae und St. Nikolai gehen sollte. Gewisse Ansatzpunkte hierfür boten sowohl die Einrichtung eines privaten Operntheaters im Jahre 1693, dessen Aufführungen zu den drei jährlichen Messen erhebliches Aufsehen erregten, als auch die Entwicklung des studentischen Musizierens, das in halböffentliche und später öffentliche Darbietungen der Collegia musica mündete. Als ein erster Schritt in die gewünschte Richtung ist es zu verstehen, wenn der einflußreiche und prachtliebende Bürgermeister Franz Konrad Romanus, der später wegen undurchsichtiger Machenschaften für den Rest seines Lebens auf der Festung Königstein festgesetzt werden sollte, den Leipziger Jurastudenten Georg Philipp Telemann beauftragte, alle zwei Wochen eine Kantate für die Thomaskirche zu liefern – eine Kränkung ohnegleichen für den eben erst in sein Amt eingewiesenen Thomaskantor Kuhnau.
Bald darauf, als der Orgelbau in der als »Neue Kirche« wiedereingerichteten alten Barfüßerkirche fertiggestellt ist, wird Telemann zum Organisten und Musikdirektor an dieser Kirche ernannt mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß er im Notfall fähig wäre, »in der Thomas- und Nikolaikirche den Chor zu dirigieren und wann sich einmal eine Veränderung begeben möchte, so hätte man wieder ein tüchtiges Subjectum.« Mit entwaffnender Geradlinigkeit sind also bereits hier die Konsequenzen erwogen, die sich aus dem labilen Gesundheitszustand des Thomaskantors ergeben könnten – sehr voreilig allerdings, denn Kuhnau blieb wider Erwarten doch über zwanzig Jahre im Amt. Daß der Rat aber in jedem Fall mit der Organistenstelle an der Neuen Kirche etwas im Sinn hatte, zeigt eindeutig die Anstellungsverhandlung mit Telemann am 1. September 1704, deren Protokoll über die geringe Besoldung vermerkt, sie wäre zwar »von keiner Wichtigkeit, daferne Er aber seine Geschicklichkeit erwiese, so würde wohlgedachter Rath ihn ferner zu befördern bedacht sein.«
Nicht eine Kantoren-, sondern eine Organistenstelle zu einer Führungsposition des städtischen Musiklebens aufzubauen, lag offensichtlich in der Absicht der Verantwortlichen. Zahlreiche Städte, wie Mühlhausen, Lübeck oder das nahegelegene Halle konnten hierfür Vorbilder liefern. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts ist in Leipzig keine Institution so liebevoll gefördert worden, wie die Musikpflege an der Neuen Kirche, die darum auch – vor allem in der Amtszeit Kuhnaus – stets die besten Kräfte aus der Studentenschaft an sich ziehen konnte, darunter spätere Berühmtheiten wie Christoph Graupner, Johann David Heinichen oder Johann Friedrich Fasch – zum Ärger des Thomaskantors darüber hinaus häufig auch Absolventen der Schola Thomana.
Nicht die schwerfällige und letzten Endes konservativ geprägte Einrichtung des Thomaskantorats und Thomanerchores, sondern die bewegliche, moderne, aktuelle Organistenmusik an der Neuen Kirche setzte fortan die Hauptakzente im Leipziger Musikleben – ungeachtet des persönlichen Ansehens, des kompositorischen Fleißes, des erbitterten Widerstandes von Johann Kuhnau. Auch der plötzliche Weggang Telemanns im Frühjahr 1705 änderte hieran nichts, sondern gab dem Rat neue Gelegenheit, seine Politik konsequent weiterzuführen.
Kuhnau hatte sogleich versucht, die lästige Konkurrenz dadurch auszumanövrieren, daß er sich erbot, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Leitung der Neukirchenmusik zu übernehmen, war aber auf beinahe einhellige Ablehnung gestoßen. Während einer der Ratsherren zweifelte, »ob mit dem Cantore werde auszukommen sein«, ein zweiter vorschlug, »weil Kuhnau kränklich sei, so könne man Heinichen oder einen anderen darzu nehmen, daß man aufn Fall wenn der Cantor kranck würde, jemand hätte«, fand ein dritter die dann von allen akzeptierte Formel, »daß man sonderliche Personen in die neue Kirche bestellete, mit Ausschließung des Cantoris.«
Die im 17. Jahrhundert angebahnte inoffizielle Aufwertung vieler Kantorenämter zu einer Art städtischem Musikdirektorenposten, für Leipzig schon 1618 durch den Zusatz »Director Musices zu Leipzig« auf einem Druckwerk von Johann Hermann Schein signalisiert, war damit von dieser Seite her vorerst abgebremst worden.
Der Leidensweg des Thomaskantors Johann Kuhnau, gekennzeichnet durch Verfall der Gesundheit, Nachlassen der Schaffenskraft, Niedergang der schulischen Musikpflege und ungenügende Unterstützung durch den Rat endete am 5. Juni 1722. Anstandshalber vergoß man ein paar Krokodilstränen und meldete der Presse, »daß der sehr berühmte Cantor Kuhnau auf hiesiger Thomas-Schulen, zu großem Leidwesen, nicht allein dieser Stadt, sondern auch aller Liebhaber und Virtuosen, gestern als den 5ten dieses das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt.«
Über den Nachfolger im Amte konnte kaum ein Zweifel bestehen. Abmachungen darüber waren ja schon vor siebzehn Jahren getroffen worden. Der vielversprechende Student von damals, Georg Philipp Telemann, hatte sein – nur mit Rücksicht auf elterliche Wünsche – begonnenes Jurastudium längst an den Nagel gehängt und war zur Musik zurückgekehrt. In höfischen und städtischen Diensten war er zum ersten Meister der Zeit herangereift und hatte soeben eine günstige Position in Frankfurt am Main mit einer anscheinend etwas weniger günstigen in Hamburg vertauscht, so daß ein erneuter Ortswechsel sich geradezu anbot.
Die einzige Schwierigkeit bestand darin, daß Telemann den dem Kantor als drittem beziehungsweise viertem Lehrer der Thomasschule zustehenden Lateinunterricht nicht zu übernehmen gedachte, sondern diesen einem auf Nebenverdienst angewiesenen Lehrerkollegen zu übertragen beabsichtigte. Vergleichbar den Vorgängen von 1677 und 1701 meldete sich auch diesmal – es war die Ratssitzung vom 14. Juli 1722 – ein einflußreicher Anwalt der schulischen Belange in der Person des 64jährigen Bürgermeisters Abraham Christoph Plaz:
»Es habe der Cantor in denen obern Claßen mit zu informiren, welches ihm nur in der Person Telemanns, der dergleichen nicht zu übernehmen gesonnen, bedencklich sey und müße man wenigst hören, wie er die Information einzurichten sich diesfalls zu vergleichen gedenke, wegen seiner Geschicklichkeit in der Music wäre er bekant.«
Bezeichnenderweise ließ man im Rat diesen Einwand vorerst auf sich beruhen und lud Telemann auf Ratskosten nach Leipzig ein. Anfang August meldeten Hamburger Zeitungen, daß »der berühmte Virtuose von Hamburg« am Monatsersten in Leipzig eingetroffen sei, um in der Thomaskirche eine Probemusik abzulegen und nach der Rückkehr nach Hamburg seinen Abschied zu nehmen. Wenig später wird eine weitere Korrespondenz aus Leipzig abgedruckt, nach der die Kantoratsprobe am 9. August »unter ansehnlicher Frequentz von Hohen und Niedern« »mit besonderer Approbation« vonstatten gegangen sei. Welche Komposition bei dieser Gelegenheit erklang, ist bisher nicht ausfindig gemacht worden. Ebensowenig weiß man, ob die seltsam ausführliche Berichterstattung auf Zufall beruht oder ob Telemann, im Umgang mit Korrespondenzen, offiziellen und inoffiziellen Meldungen bis hin zum Hofklatsch keineswegs unerfahren, einem seiner Freunde einen Wink gegeben hat. Auf jeden Fall werden die Nachrichten aus Leipzig in Hamburg einige Bestürzung hervorgerufen haben und damit Telemanns wirklichen Absichten entgegengekommen sein.
Zunächst freilich bemühte man sich in Leipzig um schnelles Handeln. Zwei Tage nach der erfolgreichen Probe schreitet man zur Wahlhandlung im Rat – Telemanns Anwesenheit auf Ratskosten legte ein beschleunigtes Verfahren nahe – und stimmte der Berufung zu mit dem Bemerken »die Sache wegen der Lectionen könne man noch aussetzen«. Ein anderes Protokoll versteigt sich sogar zu der Formulierung »Wegen der Lectionen, die aber gar nicht wichtig, werde Gestalt zu treffen sein.«
Damit sind diejenigen am Zuge, die das Thomaskantorat in ein primär musikalisch geprägtes Amt umwandeln wollen im Sinne der wirksameren Repräsentanz zugunsten der führenden Schichten des Bürgertums. So wird auch zwei Tage später, als man Telemann das Wahlergebnis mitteilt, im Protokoll ausdrücklich vermerkt »Weil Er nun, wegen seiner Music, in der Welt bekant wäre: So hätte ein Edler Hochweiser Rath Ihn erwehlet«.
Auch die Universität beeilte sich, Telemann auf Antrag ihre Director-Musices-Stelle zu übertragen, »dieweil an ihm, als einem excellenten Musico, nichts auszusetzen.« Die Bestellung der Musik sollte ihm nicht vorgeschrieben, sondern seinem Gutbefinden überlassen werden, jedoch sei eine Instruktion erforderlich, »damit es nicht das Ansehen gewinne, als ob Academia allemahl den Stadt-Cantorem anzunehmen schuldig sei.« Die alte Rivalität zwischen Stadt und Universität brach auch hier wieder hervor, der Nikolaiorganist Johann Gottlieb Görner witterte Morgenluft und erbot sich, die Stelle bis zum Dienstantritt Telemanns zu verwalten – sehr zum Schaden Bachs, wie sich zeigen sollte.
Inzwischen reiste Telemann nach Hamburg zurück, nachdem die Stadtkasse ihm am 14. August einen entsprechenden Geldbetrag gezahlt hatte. Sein Quartierwirt, der Aktuar Johann Christoph Götze, ehemals Violoncellist im Collegium musicum und als solcher ein alter Bekannter von Telemanns erster Leipziger Zeit her, erhielt die Auslagen für vierzehn Tage Unterbringung und Verpflegung erst Ende September ersetzt. Aus dieser verspäteten Zahlung ist die Legende entstanden, Telemann sei im Herbst wegen Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit seiner Anstellung nochmals in Leipzig gewesen; davon kann jedoch keine Rede sein.
Telemann richtete am 3. September 1722 in Hamburg ein vorsichtig formuliertes Schreiben an den Senat und ließ wissen, daß Leipzig ihn berufen habe und er »solche Station, in Betrachtung ihrer guten Beschaffenheit und der mir obliegenden Pflicht in Versorgung der Meinigen, wie auch in Entgegenhaltung der hiesigen für mich anitzo nicht favorable scheinenden Conjuncturen, zu ergreiffen kein Bedencken tragen können«. Aus der taktvoll umschriebenen Bitte um höhere Besoldung ergibt sich, daß Telemann den Hamburger Behörden in jeder Beziehung goldene Brücken zu bauen bereit war und seine Bindungen an diese Weltstadt nicht leichtfertig lockern wollte.
Wenige Tage später lag Telemanns Entlassungsgesuch dem Senat der Hansestadt vor, der es an die zuständige Schulbehörde weiterleitete; deren Antwort konnte merkwürdigerweise jedoch erst am 21. Oktober verhandelt werden. Dem spontanen Beschluß, Telemann unter allen Umständen in Hamburg zu halten, folgten nun – Monate nach dem ersten Warnschuß der Presse – ermüdende Versuche, die erforderliche Besoldungszulage von 400 Talern jeweils von einer Behörde und Kasse zur anderen zu schieben. Am 4. November 1722 war noch immer kein Ende abzusehen.
Der Leipziger Rat scheint indessen geduldig gewartet zu haben: seltsam genug angesichts der Eile, mit der im August die Anstellungsformalitäten betrieben worden waren. Schon damals waren Stimmen der Verwunderung laut geworden, da das Hamburger Stadtkantorat, ungeachtet der finanziellen Attraktivität der Leipziger Stelle, als durchaus entwicklungsfähig galt. Vielleicht hat Telemann in der Zwischenzeit noch einige Briefe mit dem Leipziger Regierenden Bürgermeister Gottfried Lange gewechselt; sie wären dann als verschollen anzusehen. Fest steht, daß Telemann der Hamburger Behörde im Herbst 1722 noch genauere Angaben über die finanzielle Einträglichkeit des Thomaskantorats zukommen ließ, doch ist dieses Schreiben, das kennenswerte Aufschlüsse über die Versprechungen geben könnte, die man seitens des Leipziger Rates den Bewerbern, später auch Bach gemacht hat, leider noch nicht wieder aufzufinden gewesen.
Versucht man zu entscheiden, ob Telemann es von Anfang an auf eine Scheinbewerbung angelegt hatte, um seine von einigen Mißhelligkeiten überschattete und noch etwas schwankende Position in Hamburg zu festigen und eine finanzielle Verbesserung durchzusetzen, dann kann man sich der Tatsache nicht verschließen, daß er in jenem Vierteljahr der Ungewißheit offenbar keinen Versuch unternommen hat, den Leipziger Behörden irgendwelche weitergehenden Zugeständnisse abzuringen. So blieb die Initiative allein bei den Hamburger Behörden, während Telemann und der Leipziger Rat zum Warten verurteilt waren.
Hätte der Leipziger Rat geahnt, worauf Telemann in Wirklichkeit aus war, hätte er wohl kaum so viel Geduld aufgebracht. Immerhin konnte er den Dingen noch in Ruhe entgegensehen; die musikalischen Pflichten wurden seit dem Tode des alten Kantors Kuhnau von einem zwanzigjährigen Alumnen verwaltet, Johann Gabriel Roth aus Johanngeorgenstadt, der in späterer Zeit ein Kantorenamt in Grimma übernahm. Mit dessen Leistungen war man in Leipzig in jeder Hinsicht zufrieden.
Alle Hoffnungen des Leipziger Rates, den berühmtesten deutschen Musiker der Zeit in das höchste musikalische Amt der Stadt einsetzen zu können, alle Pläne, die man seit siebzehn Jahren geschmiedet hatte, verschwanden Mitte November 1722 wie eine Fata Morgana. Schon am 20. des Monats erfuhr die Presse, »daß der hierzu berufene Musicus aus Hamburg solche (Stelle) vor dißmahl nicht annimmt, sondern bey seiner vorigen Stelle, wie man nunmehro höret, verbleibet.« Drei Tage später mußte man sich in der Ratssitzung eingestehen, daß man »wegen Ersetzung des Cantor Diensts bei der Thomas-Schule […] auf Telemannen die Absicht gerichtet« habe, »der aber entschuldige sich, daß er nicht dimittiret werden wolle.« Nicht verkneifen konnte sich Bürgermeister Gottfried Lange die Bemerkung, daß man diese Behauptung »dahin stelle und wie hierunter von ihm verfahren worden.« Nun wußte auch der Leipziger Rat, daß Telemann keinen Deut besser war als andere, die derartige Scheinbewerbungen nutzten, um Besoldungserhöhungen durchzusetzen.
Während einige Sitzungsteilnehmer ihre Enttäuschung nur schwer verbergen konnten, triumphierte Appellationsrat Plaz. Jetzt konnte er wieder auf seine alte Forderung nach Beteiligung des Kantors am wissenschaftlichen Unterricht zurückkommen, auf die noch verbleibenden Bewerber verweisen und den bisherigen Spitzenkandidaten mit der Bemerkung abtun, »man habe nicht Ursach sich zu betrüben, daß Telemann nicht herkomme.«
Dem Hamburger Meister selbst mag es bei der ganzen Angelegenheit auch nicht allzu geheuer gewesen sein; seine Jahrzehnte später verfaßte Autobiographie läßt in der wohlwollenden Umschreibung des wahren Sachverhalts jedenfalls noch Spuren eines nicht ganz reinen Gewissens erkennen:
»Anno 1723 berief mich Leipzig an die Stelle weiland Herrn Johann Kuhnau, Musikdirectoris und Cantoris daselbst, welche Ehre der Nachfolge mir bereits vor 20 Jahren zugedacht war, weil jenes Schwächlichkeit dessen baldigen Tod vermuthen ließ; allein es beliebte der Stadt Hamburg, diesen Ruf durch ansehnliche Verbesserung meines Unterhalts abzulehnen.«
Als aussichtsreichster Bewerber nach der Absage Telemanns galt im November 1722 der 35jährige Thüringer Johann Friedrich Fasch, einstmals Thomasschüler unter Kuhnau und dann Gründer eines zweiten Collegium musicum in Leipzig, geschätzter Komponist und soeben bestallter fürstlicher Hofkapellmeister zu Anhalt-Zerbst. Auch er erinnerte sich Jahrzehnte später an die ehrenvolle Berufung, erwähnte in seiner Selbstbiographie den Empfang von zwei Briefen des Regierenden Bürgermeisters Lange mit der Aufforderung, in Leipzig eine Probe seines Könnens abzulegen, schloß seinen Bericht jedoch mit der doppelsinnigen Bemerkung: »es war mir aber ohnmöglich meine gnädigste Herrschaft zu verlassen.«
In der Tat war Fasch als Untertan eines absolutistischen Herrschers gehalten, viel vorsichtigere Worte zu wählen als Telemann, der ihm in diesem Augenblick sozusagen eine ganze historische Epoche voraus war. Ob Fasch am Zerbster Hofe einen unmißverständlichen Wink erhalten hatte und darum in Leipzig absagte, oder ob er sich tatsächlich außerstande sah, an der Thomasschule mit zu »informieren«, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Bezeichnend genug ist jedoch der Umstand, daß Fasch noch als 67Jähriger es wagte, sich um eine Kantorenstelle zu bewerben – es war diejenige von Freiberg in Sachsen, 1755 freigeworden, weil Bachs Schüler Doles in das Leipziger Thomaskantorat berufen worden war –, dabei aber den Wunsch äußerte, ihn wegen seiner längst entschwundenen Lateinkenntnisse von den Unterrichtsaufgaben zu entbinden, vor allem aber dringend bat, im Falle einer Nichtberücksichtigung unter keinen Umständen etwas nach Zerbst durchsickern zu lassen, weil ihm sonst auf seine alten Tage höchste Gefahr drohe.
Zweifellos befand Johann Friedrich Fasch sich in einer mißlichen Lage. Schließlich hatte er als erster auf der Liste derer gestanden, die sich nach Kuhnaus Tode um das Thomaskantorat bewarben, und war nur wie alle anderen zugunsten des nunmehr abtrünnigen Telemann übergangen worden. Nun, da man sich wieder seiner erinnerte, hatte er eine angesehene Stellung an einem kleineren Hofe inne und lief Gefahr, sich zwischen zwei Stühle zu setzen, wenn etwa hinsichtlich des Lateinunterrichts an der Thomasschule Meinungsverschiedenheiten auftreten sollten. So tat er das in dieser Situation Einfachste: er schrieb ab.
In der letzten Sitzung vor den Weihnachtsfeiertagen mußte der Leipziger Rat sich wieder einmal der leidigen Frage der Nachfolge im Thomaskantorat zuwenden und sich damit abfinden, daß es ohne zeitraubende und kostspielige Kantoratsproben nicht abgehen würde. Die hierbei zu Berücksichtigenden – sie alle standen schon seit dem 14. Juli auf der Liste – waren letzthin schon genannt worden; lakonisch fügt das Protokoll hinzu, »es hätten sich noch mehrere gemeldet, als der Capellmeister Graupner in Darmstadt und Bach in Köthen.«
Woher dieser plötzliche Zuwachs an Bewerbern? Die Akten schweigen sich darüber aus. Vielleicht sollte man annehmen, daß beide Kandidaten als Hofkapellmeister einen günstigen Zeitpunkt abwarten mußten, um ohne Aufsehen und ohne Schaden für die eigene Karriere vorstellig werden zu können. Bach selbst hatte in Weimar schon trübe Erfahrungen mit der Entlassung aus Hofdiensten sammeln müssen, und wer konnte wissen, wie sein Köthener Dienstherr auf derartige Ambitionen reagieren würde? Eine schriftliche Bewerbung, notfalls über Mittelspersonen, oder die Gelegenheit einer Reise in die Gegend von Leipzig mögen die Kontaktaufnahme begünstigt haben – Genaueres wissen wir nicht.
Hauptkandidat nach Telemann und Fasch war um die Jahreswende 1722/23 nicht Bach, sondern Christoph Graupner, Hofkapellmeister zu Darmstadt, aber wie Telemann und Fasch ein »alter Leipziger«. Vom ihm wird angenommen, daß der äußere Anlaß zu seiner Reise von Darmstadt nach Sachsen die Regelung familiärer Angelegenheiten war. Doch das in ungewöhnlicher Höhe aus der Leipziger Stadtkasse erstattete Reisegeld verrät, von wem die Einladung in Wirklichkeit ausging. Ursache für Graupners Bewerbung waren der rapide Verfall der Darmstädter Hofkapelle infolge jahrelanger Zahlungsunfähigkeit des verschuldeten Hofes und die verzweifelte Flucht mehrerer Musiker unter Hinterlassung von Schulden und Gehaltsforderungen.
Eingedenk der bisherigen Fehlschläge erwog man in der Ratssitzung vom 15. Januar 1723 nochmals gründlich alles Für und Wider, brachte die Frage des Schulunterrichts zur Sprache, befaßte sich mit der Möglichkeit, vorsorglich auch andere Bewerber Proben ablegen zu lassen, berief sich auf die guten Zeugnisse Graupners und auf dessen Aussagen über die Entlassungsaussichten, doch hielt es der Leipziger Ratssyndikus trotz allem für zweifelhaft, »ob selbiger seine dimißion so leicht erhalten werde, dahero wohl gut sein werde, daß man an Herrn Landgrafen schreibe.«
Zwei Tage später legte Graupner mit der Aufführung von zwei Kantaten, deren Stimmen er sich von einigen Alumnen ausschreiben beziehungsweise ergänzen ließ, die geforderte Probe ab und erhielt weitere drei Tage später ein diplomatisch abgefaßtes Schreiben des Leipziger Rates an den Landgrafen von Hessen-Darmstadt, in dem es heißt, der Rat habe bei der Wiederbesetzung der Kantorenstelle sein meistes Absehen auf Graupner, den ehemaligen Thomasschüler und jetzigen Kapellmeister, gerichtet und diesen zur Aufführung eines eigenen Werkes aufgefordert. Da der Landgraf mit Virtuosen seinesgleichen im Überfluß versorgt sei, in Leipzig hingegen ein Mangel bestehe, so wolle der Rat untertänigst um die gnädige Entlassung Graupners bitten.
Nun begann wieder die Ungewißheit des Wartens, während die Presse sich hin und wieder in Spekulationen erging. Noch konnte niemand ahnen, daß eine Meldung vom 9. Februar 1723 von entscheidender Wichtigkeit sein würde:
»Am verwichenen Sonntag Vormittage machte der Hochfürstliche Capellmeister zu Cöthen, Monsieur Bach, allhier in der Kirchen zu St. Thomä wegen der bisher noch immer vacant stehenden Cantor-Stelle seine Probe, und ist desselbigen damahlige Music von allen, welche dergleichen ästimiren, sehr gelobet worden.«
Gern wüßten wir, ob die Formulierung von »allen, welche dergleichen ästimiren« als bewußte polemische Spitze gemeint ist und die Zustimmung zu Bachs Probemusik auf einen gewissen Kreis reduzieren und von der »besonderen Approbation« unterschieden wissen will, die ein halbes Jahr zuvor Telemann zuteil geworden war.
Überhaupt bleiben viele Einzelheiten der Probeveranstaltungen im dunkeln. Während bei Telemann überhaupt nicht festzustellen ist, was er für Leipzig bestimmt hatte, sind von Graupner, wie schon erwähnt, zwei Probekantaten in Partitur und Stimmen erhalten, obwohl normalerweise immer nur von einer Probemusik die Rede ist. Wer die Texte verfaßte und ob die Kompositionen am Heimatort vorbereitet werden durften oder kurz vor der Aufführung in Klausur komponiert werden mußten, läßt sich ebenfalls nicht sagen.
Auch von Johann Sebastian Bach sind zwei einschlägige Kompositionen überliefert, die allerdings einige Merkwürdigkeiten oder sogar Widersprüche aufweisen. Die eine von ihnen, die Estomihi-Kantate »Jesus nahm zu sich die Zwölfe« (BWV 22) trägt auf einer Partiturabschrift von der Hand eines Bach-Schülers den Vermerk »Dies ist das Probestück in Leipzig«. Neben den dicht gearbeiteten Eingangssatz, dessen Ausdruckskraft schon auf die großen Passionen vorausweist, tritt hier eine tänzerisch bewegte Tenorarie »Mein alles in allem, mein ewiges Gut«, die eher auf ein weltliches Werk heiteren Genres zurückgehen könnte. Der von einer fast mechanisch ablaufenden Streicherfiguration begleitete Schlußchoral endlich wirkt geradezu wie eine augenzwinkernde Parodie auf gewisse Manierismen der Ära Kuhnau, deren konservative Kreise in Leipzig nicht ohne weiteres entraten mochten. Das Schwesterwerk, die ursprünglich dreisätzige Kantate »Du wahrer Gott und Davids Sohn« (BWV 23), weist stärker als die eben genannte Komposition auf eine Vorbereitung in Köthen und eine Aufführung in Leipzig (hierfür nachträglich erweitert um die vielleicht schon 1717 oder früher in Weimar geschaffene Choralbearbeitung »Christe, du Lamm Gottes«), ebenfalls am Sonntag Estomihi 1723. Hier zeigt sich Bachs Kunst auf zumeist höherer Stufe, insbesondere im Eingangssatz, einem Quintett für zwei Vokal- und drei Instrumentalstimmen, dessen kammermusikalisches Filigran melodischen Erfindungsreichtum und verwickelte Kontrapunktik souverän vereint. Dieses Werk könnte im weiteren Verlauf des Gottesdienstes »sub communione«, also während der Austeilung des Abendmahls, erklungen sein, während »Jesus nahm zu sich die Zwölfe« als eigentliche Hauptmusik vor der Predigt aufgeführt wurde. Stärker noch als die sub-communione-Kantate läßt das als Hauptmusik dargebotene Werk das Bestreben erkennen, selbst in einer Kantate von relativ geringem Umfang die Bandbreite künstlerischer Möglichkeiten weitgehend zu nutzen und von da her die Anforderungen an ein »Probestück« im buchstäblichen Sinne zu erfüllen.
Am selben Tage, da Bach sich mit seinen beiden Kantaten den Leipzigern präsentierte, schrieb Graupner in Darmstadt an den Leipziger Rat von der Einreichung seines Entlassungsgesuches, vom eingeleiteten Verkauf seines Hauses und Hausrates und von der Hoffnung, gegen Ostern nach Leipzig übersiedeln zu können. Dieser Brief wird spätestens Mitte Februar in Leipzig vorgelegen haben. Als aber am 12. März noch immer Ungewißheit herrschte, schrieb Bürgermeister Lange nochmals an Graupner sowie an einen Minister des Darmstädter Hofes. Bald darauf, wohl kurz nach Ostern, hatte man das niederschmetternde Ergebnis in den Händen: Graupner, der wegen der Finanzmisere Darmstadt hatte verlassen wollen, hatte vom Landgrafen eine Besoldungszulage zugesagt erhalten mit der Andeutung »ich möchte nun solches annehmen oder nicht, so würden Ihro Hochfürstliche Durchlaucht es dennoch zu machen wissen, daß ich müßte hier verbleiben.« Auch der erwähnte Minister ließ wissen, daß der Landgraf über die Absichten Graupners sehr verärgert gewesen sei, da er nicht nur den Leiter der Hofkapelle, sondern auch einen »stattlichen Componisten« zu verlieren fürchtete. So wurden Graupners ehrliche Absichten durch einen kaum verhüllten Gewaltakt vereitelt, das Machtwort des Potentaten gab den Ausschlag gegenüber dem berechtigten Wunsch des Untertanen nach Bewegungsfreiheit, und der Leipziger Rat hatte trotz aller angewendeten Mühe und Sorgfalt ein weiteres Mal das Nachsehen.
Vorsichtig und vieldeutig wie sein Mitbewerber Fasch formulierte auch Christoph Graupner den Tatbestand in einer autobiographischen Aufzeichnung: »Im Jahr 1723 sollte ich nach Leipzig, als Cantor, hinkommen: alles war auch in so weit schon richtig; es kam aber so viel dazwischen, daß es nicht angehen konnte.«
Daß eine Berufung des Darmstädter Meisters nach Leipzig der städtischen und kirchlichen Musikpflege nennenswerte Impulse gegeben hätte, ist so gut wie sicher; kann doch Graupner auch aus heutiger Sicht einer der bedeutendsten Komponisten der Bach-Zeit genannt werden. Eine Ära Graupner von 1723 bis vielleicht 1760 hätte also für Leipzig nichts weniger als ein Zurückbleiben im Mittelmaß bedeutet.
Doch wie es auch sei: das Eingreifen des Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt hatte auch den dritten bevorzugten Bewerber aus dem Rennen geworfen und endgültig den Weg frei gemacht für den Fürstlich Anhalt-Köthenischen Hofkapellmeister Johann Sebastian Bach.
Die Absagebriefe Christoph Graupners und des »Ministers vom Dienst« von Kameytsky wurden in Darmstadt am 22. und 23. März 1723 verfaßt, während man in Leipzig auf die für Ostern angekündigte Übersiedelung des neuen Thomaskantors hoffte. Schon aus dieser Konstellation ergibt sich, daß die von einigen Forschern verfochtene These, Bach habe im Vorgriff auf sein künftiges Kantorat am Karfreitag (26. März) gastweise die Passionsmusik in der Thomaskirche geleitet und für diesen Zweck rasch die Johannes-Passion komponiert, auch der allergeringsten Wahrscheinlichkeit entbehrt. Daß die Figuralpassion in diesem Jahre ausgefallen sei, braucht deswegen nicht angenommen zu werden; allenfalls konnte ein entsprechendes Werk aus der Feder Kuhnaus unter Leitung des schon erwähnten Johann Gabriel Roth dargeboten werden.
Zwölf Tage nach Ostern tagte in Leipzig wieder das Spitzengremium, der Engere Rat. Erneut hatte Bürgermeister Lange eine unangenehme Nachricht in Sachen Thomaskantorat zu überbringen, doch konnte er sie diesmal ohne den bitteren Unterton vortragen, der seinerzeit nach der Absage Telemanns mitschwang:
»Auf den man bei dem Cantorat Reflexion genommen, nemlich Graupnern, könne seine Dimißion nicht erhalten, der Landgaf zu Hessen Darmstadt wolle ihn schlechterdings nicht dimittiren, sonst sei in Vorschlag der Capellmeister zu Cöthen, Bach, Kauffmann zu Merseburg und Schotte allhier kommen, aber alle drei würden zugleich nicht informiren können, bei Telemann habe man schon auf die Theilung reflektiret.«
Auch wenn der Protokollant, der Leipziger Oberstadtschreiber Menser, kein Parlamentsstenograph sein konnte, scheint er sich doch die wichtigsten Gesichtspunkte notiert zu haben, um sie dann in ausgearbeiteter Formulierung dem dickleibigen Folianten einzuverleiben, der die Ergebnisse der Ratssitzungen für die Nachwelt bewahren sollte. In diesem Fall ging es um die Absage Graupners samt Begründung, den Hinweis auf die verbleibenden Bewerber, unter denen Bach als erster genannt wird, und die Suche nach einem Ausweg durch Abtrennung des wissenschaftlichen Unterrichts von den musikalischen Aufgaben nach der »Lex Telemann«, dem einst für Telemann und nur für diesen entwickelten Modell.
Erwartungsgemäß opponierte gegen den letztgenannten Vorschlag ein weiteres Mal der älteste Bürgermeister Abraham Christoph Plaz und bemerkte zu den Plänen, den Kantor von den nichtmusikalischen schulischen Aufgaben zu entbinden: »das letztere finde er aus erheblichen Ursachen vor bedenklich, da man nun die besten nicht bekommen könne, müsse man mittlere nehmen, es sei von einem zu Pirna ehemals viel Gutes gesprochen worden.«
Bürgermeister und Protokollant konnten nicht ahnen, wie oft in späterer Zeit das Wort von den »Besten« und »Mittleren« aus dem Zusammenhang gerissen und als Zielscheibe wohlfeiler Kritik genutzt werden würde. Ihnen selbst war klar, daß mit den »Besten« nicht etwa Telemann, Fasch und Graupner gemeint waren, mit den »Mittleren« Bach und andere, sondern daß alle noch vorhandenen Bewerber als bloße Musiker nicht berücksichtigt werden sollten, und man nach Sternen mittlerer Größe Ausschau halten müsse, beispielsweise nach einem Pirnaer Kantor, von dem »ehemals« viel Gutes gesprochen worden war – was nämlich die wissenschaftliche Qualifikation anbelangt. In der Tat war dieser, ein gewisser Christian Heckel, schon seit einem Jahrzehnt als Historiker und Kenner alter Sprachen rühmlich hervorgetreten. Bürgermeister Plaz wollte also mit seinem Einwand nur einen praktischen Gegenvorschlag zur Diskussion stellen, wobei zu besserem Verständnis hinzuzusetzen wäre, daß Plaz nach eigenem Bekenntnis dem Gedankengut des Pietismus nahestand, mithin die moderne Kirchenmusik kritisch, wenn nicht gar als überflüssigen Prunk ansah und demzufolge auf die musikalische Befähigung des Schulkantors keinen übergroßen Wert legte. Dies stand freilich in deutlichem Gegensatz zu den Ansichten jener Kräfte im Rat, die die neuzeitliche gottesdienstliche Musik als unentbehrlichen Bestandteil bürgerlichen Selbstverständnisses ansahen, den Hamburger Stadtkantor nach Leipzig zu berufen versucht hatten und mehr und mehr ihre Felle davonschwimmen zu sehen glaubten.
Immerhin: auch für diese Kreise waren die Zeiten vorbei, da man angesichts der bevorstehenden Anstellung des berühmten Telemann die Schullektionen großsprecherisch als »gar nicht wichtig« abtun konnte. Die Aushandlung eines Kompromisses war nach Lage der Dinge unumgänglich und die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Argumente dürfen, da es nun um die Anstellung Bachs geht, unser gesteigertes Interesse beanspruchen. Doch wenn der Zufall bisher mehrmals zugunsten der Berufung Bachs im Spiele war, so scheint er sich nunmehr gegen die Bach-Forschung verschworen zu haben. Just an der Stelle, da es spannend zu werden verspricht, ist Oberstadtschreiber Menser »weiter zu protocolliren verhindert worden, weil in die Steuerstube gerufen worden«. Schwachen Trost spendet seine Schlußnotiz: »Das Protocoll hat Herr Syndicus Job weitergeführt.«
Schon oft hatte man diesen Ausweg beschreiten müssen, und der Herr Syndicus hat beachtliche Bündel von Mitschriften hinterlassen: diejenige vom 9. April 1723 ist gerade nicht dabei. So bleibt die Nachwelt wieder einmal auf Vermutungen angewiesen, auch wenn sie brennend gern wüßte, wie doch noch eine Kompromißformel gefunden wurde, damit statt eines Schulmannes besserer und Musikers mittlerer Qualität der vierte namhafte Musiker – Bach – in Aussicht genommen werden konnte. Aus dem Fortgang der Ereignisse läßt sich in gewisser Weise schließen, auf welches Vorgehen man sich an jenem 9. April geeinigt hat.
Auf jeden Fall war umgehend an Bach zu schreiben. Diese delikate Aufgabe wird wieder dem Bürgermeister Lange zugefallen sein, der sich möglichst unverfängliche Formulierungen für die Überlegungen und Ansinnen des Rates ausdenken mußte. Klarzumachen war dem Herrn Hofkapellmeister, daß man, sofern er seine Bewerbung noch immer aufrechterhalte, zwar auf ihn zu reflektieren geneigt sei, daß aber entgegen der üblichen Verfahrensweise eine schriftliche Versicherung des Inhalts abgegeben werden müßte, daß nach erfolgter Wahl zum Kantor der Köthener Entlassungsschein binnen gesetzter Frist vorzulegen sei und der Bewerber die Stelle auch wirklich antrete, daß er des weiteren vorkommendenfalls für die Lateinstunden einen Vertreter auf eigene Kosten stellen sowie der schon vorhandenen oder noch zu errichtenden Schulordnung sich entsprechend verhalten werde. Dies alles müßte der Herr Hofkapellmeister mit eigener Hand schriftlich versichern, wozu seine Anwesenheit in Leipzig erforderlich sei.
Seiner undankbaren Aufgabe scheint Bürgermeister Lange sich umgehend entledigt und durch dieses schnelle Handeln vielleicht die letzte Gefahr beseitigt zu haben, daß Bach Leipzig doch noch verloren gehen könnte. Sechs Tage vor jener wichtigen April-Sitzung war in Köthen die kaum 21jährige Fürstin Friederica Henrietta gestorben, die Bach später als »amusa« bezeichnete, ihr so die Schuld am erkaltenden Musikinteresse des Fürsten zuschiebend. Daß der plötzliche Tod der jugendlichen »Landesmutter« Bach in seinem Entschluß, Köthen den Rücken zu kehren, nicht wankend machte, wirft ein Licht sowohl auf die wirklichen Entwicklungen am Köthener Hof als auch auf das diesmal wohl geschicktere und glücklichere Taktieren des Leipziger Rates.
Wenn dieser dem Hofkapellmeister Bach eine schriftliche Zusicherung abverlangte in Hinsicht auf umgehende Entlassung aus den Hofdiensten und Vorlage eines Dimissionsscheines, so ist dies im Prinzip nicht zu beanstanden, wenngleich Bach weder an Telemanns Scheinbewerbung noch an der autokratischen Haltung des Hessischen Landgrafen die allergeringste Schuld traf. Offenbar sollte die Entlassungsfrage auch nicht den Hauptinhalt des zu unterschreibenden Reverses bilden, sondern dieser und noch andere Punkte wurden in einen Text mit aufgenommen, dessen letzter und unauffälligster Punkt die eigentliche Abmachung enthält – die Stellung eines Vertreters für den Lateinunterricht auf Kosten des Thomaskantors. Dies war das Wesentliche des am 9. April 1723 ausgehandelten Kompromisses: zur Vermeidung unliebsamer Konsequenzen bei künftigen Besetzungen der Stelle mußte die jetzige Ausnahmeregelung unverwechselbar als solche gekennzeichnet werden. Darüber hinaus stand der Rat vor der eigenartigen Situation, daß der Köthener Hofkapellmeister als einziger in einer langen Reihe von Bewerbern und Amtsträgern kein Universitätsstudium vorzuweisen hatte.
Als Gegenleistung für die Bereitschaft zur Abgabe dieser schriftlichen Versicherungen muß der Rat der Stadt dem designierten Thomaskantor schon vorher verbindliche Zusagen gegeben haben; anders ist es nicht zu verstehen, daß Bach am 19. April 1723 in Leipzig den geforderten Revers unterschrieb, daß aber die Köthener Entlassungsurkunde das Datum des 13. April 1723 trägt.
Anscheinend hat Bach sofort nach Erhalt günstiger Nachrichten aus Leipzig in Köthen seinen Abschied eingereicht. Mit geradezu verdächtiger Eile wurde hier auch sogleich ein Text formuliert, in dem der Fürst seinem Kapellmeister bescheinigt, daß er »mit deßen Verrichtungen jeder Zeit wohl zufrieden gewesen«, ihm aber die »unterthänigst« erbetene »dimission« »in gnaden« erteile, weil »derselbe anderweit seine Fortun vor itzo zu suchen willens.« Kein Wort des Bedauerns über den Weggang des Komponisten und Kapellmeisters, kein Anzeichen eines Versuches, ihn zu halten, eher eine gewisse Erleichterung über die Lösung des Dienstverhältnisses. Spannungen mögen aufgetreten sein, über deren Ursache wir nichts wissen, doch ist der Gedanke an ein Zerwürfnis sicherlich auszuschließen, da die Entlassung »in Gnaden« erfolgte und Gastspiele Bachs in Köthen von 1724 an mehrfach nachzuweisen sind. Um so merkwürdiger wirkt es, daß die Köthener Urkunde so überaus schnell konzipiert worden ist.
Als Bach am 19. April 1723 in Leipzig weilte, um das gewünschte Dokument zu unterschreiben, wußte er wohl noch nichts vom Erfolg seiner Köthener Bemühungen, und auch das Leipziger Ratskollegium mußte diesen Punkt offenlassen, als es am 22. April in seiner Gesamtheit zusammentrat, um endlich eine definitive Kantorenwahl vorzunehmen. Auch hier könnte von einer verdächtigen Eile gesprochen werden, zumal ein Zeitdruck, wie im Vorjahr bei der Wahl Telemanns, nicht vorlag. Offensichtlich war es das Bestreben der Verantwortlichen, nun endlich das Eisen zu schmieden, solange es heiß war.
Den langersehnten Erfolg bei der Stellenbesetzung vor Augen, konnte Bürgermeister Lange zu Beginn der Ratssitzung seine bisherigen Bemühungen breit darlegen, auf Telemann verweisen, der »sein Versprechen nicht gehalten«, auf Graupner, mit dem angeblich privatim vehandelt worden sei, »welcher aber berichtet, daß man ihn nicht lassen wolte.« »Hernach hätten sich Bach, Kauffmann und Schott gemeldet. Bach wäre Capellmeister zu Cöthen und excellirte im Clavier. Nebst der Music habe er die Information, und müßte der Cantor in den Colloquiis Corderi und der Grammatic informiren, welches er auch tun wolte. Er habe sich reversiret, nicht allein publice, sondern auch privatim zu informiren.« Und dann noch ein grimmiger Seitenhieb auf den Renegaten in Hamburg: »Wenn Bach erwehlet würde, so könnte man Telemann, wegen seiner Conduite, vergeßen.«
Wenn der Regierende Bürgermeister Bachs schriftliche Verpflichtung, für den Lateinunterricht auf seine Kosten einen Ersatzmann zu stellen, aus taktischen Gründen verändert vortrug, so konnte er sicher sein, daß er auch die Zustimmung des zweiten Bürgermeisters, des schon mehrfach erwähnten Plaz, erhielt. Dieser ließ sich »deßen Person gefallen, zumal da er sich erkläret, nicht nur die Knaben in der Music, sondern auch sonst in der Schule geordneter Maßen zu informiren, man werde sehen, wie er das letzte bewerkstelligen werde.«
Etwas mehr über die wirklichen Abmachungen wußte offenbar der dritte Bürgermeister Adrian Steger, der zur Frage des wissenschaftlichen Unterrichts bemerkte, »möchte er bei dem letzteren nicht allenthalben fortkommen können, würde man ihm, es durch andere Person verrichten zu lassen, nicht entgegen sein.« Als Ausgleich für diese Konzession forderte er mit Entschlossenheit, der neue Kantor habe »solche Compositiones zu machen, die nicht theatralisch wären.«
Freilich konnte so etwas auch nur gesagt worden sein, um überhaupt etwas zu sagen, etwa als Vorgriff auf die Standardformulierung der Anstellungsurkunde, der Thomaskantor habe »zu beybehaltung guter Ordnung in denen Kirchen die Music dergestalt einzurichten, daß sie nicht zulang währen, auch also beschaffen sein möge, damit sie nicht opernhafftig herauskommen, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntere.« Vielleicht war es aber auch wieder Ausdruck jener oppositionellen Stimmung gewisser Kreise, die sich gegen eine zu moderne oder gar aufklärerisch beeinflußte Kirchenmusik wandten.
Von der einstimmigen Wahl Bachs und der bevorstehenden Besetzung hatte man alsbald auch in Hamburg läuten hören und war um so mehr erleichtert, als man wohl bis zuletzt gefürchtet hatte, den hochgeschätzten Telemann doch noch zu verlieren.
Auf jeden Fall war mit der Entscheidung vom 22. April Bach endgültig für Leipzig gewonnen. Wenn dieser später brieflich versicherte, er habe den Wechsel von Köthen nach Leipzig gewagt, weil ihm die neue Stelle als überaus vorteilhaft beschrieben worden wäre und seine Söhne außerdem Veranlagung zu besserer Schul- und vielleicht auch Universitätsbildung gezeigt hätten als ihnen von Köthen aus hätte gewährt werden können, so ist hiergegen nichts einzuwenden. Daß es ihm »anfänglich gar nicht anständig seyn wolte, aus einem Capellmeister ein Cantor zu werden«, muß man ebenfalls akzeptieren, da fast jedes Kantorat einen anderen gesellschaftlichen Rang aufwies. Auch ist wohl anzunehmen, daß Bach erst im Laufe der Zeit eine exakte Vorstellung über seinen Platz in der städtischen Rangordnung gewann und deren Vorzüge und Nachteile gegenüber einer Kapellmeisterstelle an einer absolutistischen Hofhaltung abwägen konnte.
Wenn Bach aber behauptete, daß er aus diesem Grunde seine »Resolution auf ein vierthel Jahr trainirete«, daß er also mit seinem Entschluß ein Vierteljahr gezögert habe, so kann man ihm hierin nur schwer folgen. Zwischen Telemanns Absage und Bachs Bewerbung liegt nur ein Monat, von der Festlegung des Rates, auch Bach zur Probe zuzulassen, bis zur Ablegung der Probe vergingen etwa drei Wochen, vom Eintreffen der Absage Graupners bis zur Aufnahme der entscheidenden Verhandlungen mit Bach dauerte es annähernd vierzehn Tage. Für eine Denkpause von einem Vierteljahr ist im Ablauf der Ereignisse beim besten Willen kein Platz. Wenn aber schon in dieser Äußerlichkeit Bachs Angaben mit der Realität nicht zur Deckungsgleichheit gebracht werden können, dann muß seine Behauptung, man habe ihn mit falschen Versprechungen nach Leipzig gelockt, ebenfalls mit Vorsicht aufgenommen und zum größeren Teil einer augenblicklichen Verärgerung zugeschrieben werden.
Nur noch kurze Zeit verging zwischen der Wahlhandlung des Ratskollegiums und der endgültigen Anstellung Bachs. Am 5. Mai 1723 erschien dieser in der Ratsstube des Alten Rathauses am Leipziger Markt, an der gleichen Stelle, wo acht Monate und drei Wochen zuvor Georg Philipp Telemann ungerührt die Mitteilung seiner Wahl entgegengenommen hatte, stellte sich dem Brauch gemäß hinter die hochlehnigen »grünen Stühle« und hörte die kurze Ansprache des Regierenden Bürgermeisters Gottfried Lange an. Zwar hätten sich, so meinte dieser, unterschiedene zum Kantordienst an der Thomasschule gemeldet, weil er, Bach, aber als »capabelster« erachtet worden sei, so hätte man ihn einhellig erwählt. Ganz so stimmte dies freilich nicht: drei Bewerber waren dem Rat vorher durch die Maschen geschlüpft. Aber wer hätte den nunmehrigen Inhaber der Stelle mit einer Schilderung der mißlichen Vorgeschichte in Verlegenheit setzen mögen? So war Schweigen doch die bessere Diplomatie.
Auch Bachs Antwort fiel vergleichsweise kurz aus. Er bedankte sich für die Berücksichtigung seiner Person und versprach wie üblich Treue und Fleiß. Mehr verlangte niemand von ihm.
Formalitäten gab es noch genug zu erfüllen. Wie jeder städtische Beamte mußte Bach einen Anstellungsrevers unterzeichnen, der auch den früheren Thomaskantoren nicht erspart geblieben war. Rechte und vor allem Pflichten sowie die Einflußmöglichkeiten der Behörden und einzelner Ratsmitglieder sind hier festgelegt, Verbote ausgesprochen wie etwa über die Annahme eines Amtes bei der Universität oder das Verlassen der Stadt ohne Erlaubnis des Bürgermeisters, der Verlust der Stelle als Strafe bei Zuwiderhandlung angedroht sowie schulische Aufgaben spezifiziert.
Einige Tage später galt es eine kleine aber ungefährliche theologische Prüfung zu bestehen, einen Eid zu schwören, die Augsburger Konfession zu unterzeichnen sowie die sogenannten Visitationsartikel von 1593, die sich seinerzeit gegen die kryptocalvinistischen Unruhen gerichtet hatten und anachronistisch durch die Jahrhunderte weitergeschleppt wurden.
Während all dieser Unruhe und Zeitverschwendung hieß es die erste Musikaufführung vorzubereiten, die eigenartigerweise nicht in den Stadtkirchen als dem Hauptwirkungsfeld des Kantors stattfinden würde, sondern in der der Universität unterstehenden Paulinerkirche, deren sogenannter »alter Gottesdienst« vom Thomaskantor traditionsgemäß mit Musik zu versorgen war. Die sparsam besetzte Pfingstkantate »Wer mich liebet, der wird mein Wort halten« (BWV 59) ist anscheinend für diesen Zweck geschaffen worden und müßte am 16. Mai aufgeführt worden sein.
Wenige Tage später, am 22. Mai, erfolgte die endgültige Übersiedelung nach Leipzig, über die sogar die Zeitung kurz berichtete:
»Am vergangenen Sonnabend zu Mittage kamen 4 Wagen mit Hausrat beladen von Cöthen allhier an, so dem gewesenen dasigen Fürstl. Capellmeister, als nach Leipzig vocirten Cantori Figurali zugehöreten; um 2 Uhr kam er selbst nebst seiner Familie auf 2 Kutschen an und bezog die in der Thomasschule neu renovierte Wohnung.«
Man könnte hinter dieser in der Hamburger Zeitung abgedruckten Leipziger Korrespondentenmeldung die parodistische Schilderung eines höfischen Alltagsereignisses vermuten; der Anlaß für die sonst nicht übliche Aufnahme eines solch unwichtigen Vorkommnisses wie des Wohnungswechsels eines Schulbedienten in die Presse der Hansestadt wird aber wohl ein spezielles Interesse an Vorgängen gewesen sein, die in weiterem Sinne mit der Person Telemanns verknüpft waren.
Für Bach blieb keine Zeit, von der Belastung dieses Umzuges auszuspannen und sich in den Lebensstil der Messe-, Buch- und Universitätsstadt einzugewöhnen. Ein dichtes Koordinatensystem von kleineren und größeren Verpflichtungen verlangte den vollen Einsatz der Arbeitskraft, um allenthalben die feste Hand des neuen Leiters spüren zu lassen. Während Bach sich in die Arbeit stürzte, konnten Bürgermeister und Rat erleichtert aufatmen.
Nachtrag (2017):
Der vorstehende Essay bildete ursprünglich das Probekapitel für eine in den 1970er Jahren geplante, aber nicht zustande gekommene Bach-Biographie. Zu Wiederauffindung und Inhalt des ehedem noch vermißten Telemann-Briefes vom 15.Oktober 1722 vgl. das folgende Kapitel (I B).
BZWISCHENKUHNAU UND BACH
Das folgenreichste Interregnum im Leipziger Thomaskantorat. Anmerkungen zu einer unendlichen Geschichte*
»Hellmann lehnt Nominierung zum Thomas-Kantor ab
Mainz
Der Kantor und Organist an der Christuskirche in Mainz, Diethard Hellmann, der als Nachfolger für den im November 1960 in die Bundesrepublik zurückgekehrten Thomaskantor Professor Kurt Thomas in engste Wahl gezogen worden war, hat die zuständige Sowjetzonenstelle in Ost-Berlin gebeten, von seiner Nominierung Abstand zu nehmen. Er sehe angesichts seiner besonderen Aufgabe als Kantor an der Mainzer Christus-Kirche und an der Mainzer Universität sowie der ihm übertragenen Gesamtleitung des ›Siebenten Internationalen Bachfestes 1961‹ in Mainz keine Möglichkeit, sich von diesen Verpflichtungen zu lösen. (AP)«
(Der Tagesspiegel, Berlin, 22. Januar 1961)
Was ein Wechsel im altberühmten Thomaskantorat zu bedeuten hat, wird kaum jemand kompetenter zu beurteilen vermögen als unser Jubilar: Hat er doch – und zuweilen aus allernächster Nähe – bereits fünfmal dieses aufreibende Procedere beobachten, erleben und zum Teil selbst mitbestimmen können. Karl Straube – Günther Ramin – Kurt Thomas – Erhard Mauersberger – Hans-Joachim Rotzsch – Georg Christoph Biller – überall ist Ende und Anfang im Spiel, Hoffnung und Enttäuschung, Neubeginn und Kontinuität. Und fast stets ließe sich wohl auch eine Geschichte erzählen über Gründe und Hintergründe von Amtsniederlegung und Neuberufung, und es bleibt nur zu wünschen, daß dergleichen vorstellbare und naheliegende Berichte für die Nachwelt dokumentiert würden, ehe die Kassation von Akten und die Einhaltung rigider Bestimmungen über den Datenschutz die Quellen endgültig versiegen lassen.
Daß der zweite Wechsel im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts der wichtigste in der Geschichte dieses unvergleichlichen Amtes war, ist unstrittig, das Auf und Ab in der zweiten Jahreshälfte 1722 und in den ersten Monaten des Jahres 1723, das schließlich der Stadt Leipzig den Köthener Hofkapellmeister Bach und diesem das Leipziger Thomaskantorat bescherte, ist seit langem fester Bestandteil jeder Bach-Biographie.
Gleichwohl bedürfen viele Einzelheiten jener Vorgänge nach wie vor der Erhellung, sei es durch Beiziehung bisher ungenutzten Quellenmaterials oder durch veränderte Interpretation des bereits Bekannten. Mit einem solchen Neuansatz habe ich mich im Gedenkjahr 1975 – unter Rahmenbedingungen, deren Schilderung hier zu weit führen würde – einmal hervorgewagt und unter dem Titel »›[…] da man nun die besten nicht bekommen könne […]‹– Kontroversen und Kompromisse vor Bachs Leipziger Amtsantritt« einige Vorgänge von 1722 und 1723 mit unterschiedlichen Auffassungen im Leipziger Rat über die Definition des Thomaskantorats zu erklären versucht, wobei die Beobachtungen sicherheitshalber auf den Zeitraum zwischen 1677 und 1755 ausgedehnt wurden.1 Meine knappe Skizze diente Ulrich Siegele einige Jahre später als Grundlage für ein breit ausgeführtes Panorama,2 das das überkommene Quellenmaterial mit vielen bestechenden Hypothesen anreichert und für jede Meinungsäußerung der damaligen Bürgermeister und Ratsherren wie auch für Auswahl, Abschneiden und Bewertung der Kandidaten eine stichhaltige Begründung liefert. Staunenswert ist die Sicherheit, mit der der Leser durch das – wirkliche oder scheinbare – Labyrinth des Berufungsverfahrens geleitet wird, bewundernswert auch die Konsequenz, mit der der einmal eingeschlagene Weg unbeirrt bis zu Ende gegangen wird, obwohl er unversehens in einer selbstgeschaffenen Sackgasse mündet.3
Meine beiden kürzeren Essays aus den Jahren 1990 und 1991 versuchen eine weniger systematische, eher pragmatische Zusammenschau, deuten aber bereits in ihren Überschriften auf das Gemeinte: »Von der Schwierigkeit, einen Nachfolger zu finden. Die Vakanz im Leipziger Thomaskantorat 1722–1723« und »Johann Sebastian Bach – Thomaskantor. Schwierigkeiten mit einem prominenten Amt«.44
Die vorliegenden Ausführungen zielen auf die Ergänzung und Präzisierung einiger Einzelheiten, speziell im Blick auf die Einkünfte des Thomaskantors sowie die Verfahrensweise hinsichtlich der Vertretung in dem fast einjährigen Interim zwischen dem Tod Johann Kuhnaus (5. Juni 1722) und dem Amtsantritt Bachs (30. Mai 1723).





























