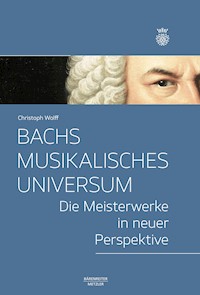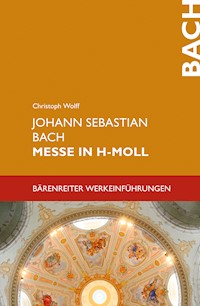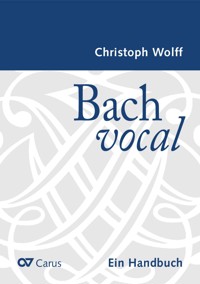
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carus-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In kompakter, übersichtlicher Form hat der renommierte Bachforscher Christoph Wolff im Handbuch „Bach vocal“ Basisinformationen zu sämtlichen Vokalwerken Johann Sebastian Bachs zusammengestellt. Neben Titeln, Entstehungszeit, Textdichtern und Besetzung finden sich z. B. für jeden Einzelsatz Besetzung, Textanfang und Taktarten. Verschiedene Fassungen werden ebenso berücksichtigt wie die Beziehungen der Werke untereinander (Parodievorlagen). Dargestellt sind alle Werkgruppen und Gattungen in systematischer Gliederung: Neben den Kirchenkantaten, Oratorien, Passionen, Motetten und der lateinischen Kirchenmusik auch die weltlichen Kantaten und verwandte Werke, die mit dem geistlichen Œuvre in vielfacher Wechselbeziehung stehen. Einleitende Kapitel führen in die jeweilige Gattung ein und verankern sie musikgeschichtlich wie biographisch. Nachgewiesen werden zu jedem Werk und jeder Fassung auch die verfügbaren einschlägigen Neuausgaben. Zudem machen mehrere Register dieses Handbuch zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk. „Bach vocal“ erscheint in gebundener Form sowie als e-book. Der Autor Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Wolff gehört zu den profiliertesten Bachforschern der Gegenwart. Er ist Professor emeritus der Harvard University und war von 2001 bis 2013 Direktor des Leipziger Bach-Archivs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Benutzungshinweise
Abkürzungen
1. Kantaten für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres
1. Advent bis 27. Sonntag nach Trinitatis
Marienfeste, Johannistag, Michaelistag, Reformationsfest
Für jede Zeit und ohne Bestimmung
2. Kirchenkantaten und verwandte Werke verschiedener Bestimmung
Ratswahl
Trauung
Trauerfeier und Begräbnis
Zweihundertjahrfeier der Augsburgischen Konfession 1730
Sonstige Anlässe oder Bestimmung nicht überliefert
3. Motetten
Für vier- und fünfstimmigen Chor
Für achtstimmigen Doppelchor
4. Passionen und Oratorien
Passionen
Oratorien
Einlagesätze für Werke verschiedener Komponisten
5. Lateinische Kirchenmusik
Vollständige Messe
Kyrie-Gloria Messen
Sanctus und Einzelsätze
Magnificat
Einlagesätze für Werke verschiedener Komponisten
Festmusik für die Universitätskirche St. Pauli
6. Weltliche Kantaten und verwandte Werke
Moralische Kantaten und andere Repertoirestücke
Hochzeitsmusiken
Gelegenheitswerke für mitteldeutsche Fürstenhäuser
Ernestinische Höfe: Sachsen-Weimar, Sachsen-Weißenfels und Sachsen-Gotha
Askanische Höfe Anhalt-Köthen und Anhalt-Zerbst
Albertinischer Kurfürstenhof und Königshof Sachsen-Polen
Gelegenheitswerke für den sächsischen Adel
Akademische Gelegenheitswerke
Register
Besetzungen
Vokalsolisten
Instrumentarium
Selten verlangte Sonderinstrumente
Continuo-Arien
Arien mit instrumentaler Obligatstimme und Bc
Solistische Choralbearbeitungen
Weitere
Chronologie
Textdichter
Instrumentale (untextierte) Choralzitate
Die seit BWV1 (1950) ausgeschiedenen Werke
Titel und Textanfänge
BWV-Nummern
Dem Andenken meiner lieben Frau
Barbara Wolff
Benutzungshinweise
Alle authentisch überlieferten Werke erhalten eigene Werktableaus, die im Interesse der Übersichtlichkeit knapp bemessen sind. Sie beschränken sich auf die wesentlichen Angaben zu Entstehung und Bestimmung der Kompositionen, Herkunft der Texte und Melodien sowie zur vokalen und instrumentalen Besetzung, gegebenenfalls auch zu unterschiedlichen Fassungen. Angaben zu Werk- und Aufführungsgeschichte vor 1750 beschränken sich auf die wesentlichen Eckdaten. Nachweisbare Wiederaufführungen unter Bachs Leitung werden nur erwähnt, wenn sie von besonderer Bedeutung oder mit substanziellen Änderungen verbunden sind.
Innerhalb der verschiedenen Werkgruppen und Untergruppierungen sind die Kompositionen jeweils chronologisch geordnet. Werke und Werkteile, die unvollständig oder nur textlich überliefert sind, werden durch Kleindruck gekennzeichnet. Für weitere Details, namentlich Einzelheiten zur Werkgeschichte, Quellenangaben und quellenbezogene Daten und Hinweise auf die entsprechende Fachliteratur wird zur Entlastung des Handbuches auf das Bach Compendium (BC) und das Bach-Werke-Verzeichnis (BWV3) verwiesen.
BWV3, dessen Nummerierung das Handbuch konsequent übernimmt, unterscheidet im Unterschied zu seinen Vorgänger-Ausgaben zwischen verschiedenen Werkfassungen durch eine leicht modifizierte Zählung, die hier übernommen wird. Die neuen BWV-Nummern mit Dezimalpunkten und nachgestellten Ziffern veranschaulichen gegenüber den vormals üblichen, uneinheitlich verwendeten a- und b-Nummern die Fassungsgeschichte in chronologischer Ordnung. Das folgende Beispiel verdeutlicht zugleich die oft unterschiedliche Aufführungsgeschichte der weltlichen und geistlichen Fassung.
Oster-Oratorium BWV 249
Weltliche Fassungen (Glückwunschkantate):
249.1 Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen vormals BWV 249a(1725, unvollständig)
249.2 Verjaget, zerstreuet, zerrüttet, ihr Sterne vormals BWV 249b(1726, unvollständig) Geistliche Fassungen (Oster-Oratorium)
249.3 Kommt, fliehet/gehet und eilet, ihr flüchtigen Füße vormals BWV 249(Oster-Kantate 1725)
249.4 Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße vormals BWV 249(Oster-Oratorium 1738)
249.5 Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße vormals BWV 249(Oster-Oratorium, Revision 1743–1746)
Die Nummerierung des BWV3 versteht sich primär als internes Referenzsystem mit nur bedingtem Nutzen für die Praxis. Hier lässt sich im Allgemeinen auf die präzise Nummerierung verzichten, zumal in vielen Fällen die Werktitel als solche trotz gleicher BWV-Nummer eine Differenzierung erlauben.
Hinweise auf Editionen beschränken sich auf Referenzausgaben, d. h. – von Ausnahmen abgesehen – auf die Neue Bach-Ausgabe (NBA und NBArev) als die historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke Bachs, die Stuttgarter Bach-Ausgaben (SBA) sowie die neueren Ausgaben der Partiturbibliothek Breitkopf & Härtel (PB). Editionen, die Rekonstruktionen verlorener Partien oder Sätze enthalten, sind als solche gekennzeichnet.
Auf Literaturangaben zu den einzelnen Werken wird verzichtet, doch sei verwiesen auf die vom Bach-Archiv Leipzig ständig aktualisierte und online zugängliche Bach-Bibliographie: (www.bacharchivleipzig.de/de/bach-archiv/bach-bibliographie). Ebenso sei hingewiesen auf das Internet-Portal „Bach digital“ (www.bach-digital.de), in dem die Originalhandschriften Bachs sowie weitere Quellen über Werktitel oder BWV-Nummern zum Studium abrufbar sind.
Der Registerteil im Anhang erlaubt bequemen Zugriff auf die praktische Erschließung des vielfältigen Repertoires, darunter nach den verschiedensten vokalen und instrumentalen Besetzungen sowie nach Chronologie, Textdichtern, untextierten Choralzitaten, Titeln und Textanfängen.
Abkürzungen
Allgemeine
Anon.
Anonymus
Anon.
Anonymus
autogr.
autograph
Brand. Konzert
Brandenburgisches Konzert
c.f.
Cantus firmus
con sord.
con sordino
ders.
derselbe
gen.
genannt
instr.
instrumental
Instr
Instrumente
i. V.
in Vorbereitung
Königl.
Königlich
Mel.
Melodie
obl
obligat
pic
piccolo
Rek.
Rekonstruktion
Rez.
Rezitativ
rip
ripieno
S.
Seite
sog.
so genannte
sord
sordino
st.
stimmig
Str.
Strophe
transp.
transponiert
unis
unisono
WA
Wiederaufführung
(Register)
Besetzung
A
Alto
B
Basso
Bc
Basso continuo
Bs grosso
Bassono grosso
Cemb
Cembalo
Cor
Corno
Corca
Corno da caccia
Cor da tir
Corno da tirarsi
Ctto
Cornetto
Fg
Fagotto
Fl
Flauto
Fl dolce
Flauto dolce
Fl pic
Flauto piccolo
Fl trav
Flauto traverso
Lt
Liuto
Ob
Oboe
Obca
Oboe da caccia
Obda
Oboe d’amore
Org
Organo
S
Soprano
SATB
4-st. Chor und Einzelstimmen: S (Soprano), A (Alto), T (Tenore), B (Basso)
S, A, T, B
Einzelstimmen: S (Soprano), A (Alto), T (Tenore), B (Basso)
Str
Streicher
T
Tenore
Timp
Timpani
Tl
Taille
Tr
Tromba
Tr da tir
Tromba da tirarsi
Trb
Trombone
Va
Viola
Vada
Viola d’amore
Vc
Violoncello
Vcpic
Violoncello piccolo
Vga
Viola da gamba
Vl
Violino
Vlpic
Violino piccolo
Vne
Violone
Textdrucke
Birkmann 1728
Christoph Birkmann, Gott-geheiligte Sabbaths-Zehnden, Nürnberg 1728.
Franck 1715
Salomon Franck: Evangelisches Andachts-Opffer, Weimar 1715.
Franck 1716
ders.: Geist- und Weltlicher Poesien Zweyter Theil, Jena 1717.
Franck 1717
ders.: Evangelische Sonn- und Festtags-Andachten, Weimar& Jena 1717.
Helbig 1720
Johann Friedrich Helbig: Auffmunterung zur Andacht, Eisenach 1720.
Knauer 1720
Johann Oswald Knauer: Gott-geheiligtes Singen und Spielen, Gotha 1720.
Köthen 1729
Trauer-Music, bey der dem weyland Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Leopolden… unterthänigst aufgeführet.
Lehms 1711
Georg Christian Lehms: Gottgefälliges Kirchen-Opffer, Darmstadt 1711.
Leipzig 1723
Als der Hoch-Wohlgebohrne Herr, Herr Statz Hilmar von Fullen… das neu erbauete Orgel-Werck in der Kirche zu Störm-Thal übernehmen und examiniren ließe.
Leipzig 1724ff.
Texte zur Leipziger Kirchen-Music [Gedruckte Texthefte für jeweils mehrere Sonn- und Festtage; die heute nachweisbaren Exemplare:]Leipzig 1724I: 2. Sonntag nach Epiphanias bis zu Mariae Verkündigung*
Leipzig 1724II: 1. Ostertag bis Quasimodogeniti*
Leipzig 1724III: 13. bis 16. Sonntag nach Trinitatis und MichaelistagLeipzig 1725: Ratswahl-Gottesdienst St. NicolaiLeipzig 1725I: 3. bis 6. Sonntag nach Trinitatis, einschließlich Johannistag und Mariae Heimsuchung*1Leipzig 1727: 1. Pfingsttag bis TrinitatisLeipzig 1731I: 1. Ostertag bis Misericordias Domini*
Leipzig 1731II: 1. Pfingsttag bis Trinitatis*Leipzig 1734: 1. Weihnachtstag bis Epiphanias (Weihnachts-Oratorium)*Leipzig 1749: Ratswahl-Gottesdienst St. Nicolai*
Meiningen 1719
Sonn- und Fest-Andachten über die ordentlichen Evangelia, Meiningen 31719.
Menantes 1713
Christian Friedrich Hunold, gen. Menantes: Akademische Nebenstunden, Halle& Leipzig 1713.
Menantes 1719/20
ders.: Auserlesene und theils noch nie gedruckte Gedichte. Teil I/II, Halle 1719/20.
Mühlhausen 1708
Glückwünschende Kirchen MOTETTO, als bey solennen Gottesdienste in der Haupt-Kirchen B.M.V… der gesegnete Raths-Wechsel… geschah.
Neumeister 1700
Erdmann Neumeister: Geistliche Cantaten statt einer Kirchen-Music, Weißenfels 1700; 2. Aufl.: Geistliche Cantaten über alle Sonn- Fest- und Apostel-Tage, Halle 1705.
Neumeister 1711
ders.: Geistliches Singen und Spielen, Gotha 1711.
Neumeister 1714
ders.: Geistliche Poesien…; erhalten nur 2. Aufl., Eisenach 1717.
Picander 1725
Christian Friedrich Henrici, gen. Picander: Erbauliche Gedancken auf den Grünen Donnerstag und Charfreytag über den leidenden Jesum in einem Oratorium entworffen, Leipzig 1725.
Picander 1727
ders.: Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte. Erster Theil, Leipzig 1727.
Picander 1729
ders.: Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte. AndererTheil, Leipzig 1729.
Picander 1732
ders.: Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte. Dritter Theil, Leipzig 1732.
Picander 1737
ders.: Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte. Vierter und letzter Theil, Leipzig 1737.
Picander 1747
ders.: Picanders bis anhero herausgegebene Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte, Leipzig 1747 (Nachdruck Picander 1727–1737).
Rambach 1720
Geistliche Poesien, Halle 1720.
Rudolstadt 1726
Sonn- und Fest-Tags-Andachten über die ordentlichen Evangelia, Rudolstadt 1726.
Weimar 1713
Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Wilhelms Ernsts… Christ-Fürstlicher Wahl-Spruch.
Weimar 1715I, II
CANTATA auf [das Trinitatis-Fest bzw. den 4. Sonntag n. Trin.] 1715 in der Fürstlich-Sächsischen Hof-Capelle zur Wilhelms-Burg zu musiciren.
Ziegler 1728
Christiane Mariane von Ziegler: Versuch in gebundener Schreibart. Teil I, Leipzig 1728.
Bibliographische Abkürzungen
BA
Bärenreiter Ausgabe
BC
Hans-Joachim Schulze und Christoph Wolff, Bach Compendium. Analytisch-bibliographisches Repertorium der Werke Johann Sebastian Bachs, Bd. I/1–4, Leipzig 1986–1989.
BR-CPEB
Carl Philipp Emanuel Bach. Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke, Teil 2: Vokalwerke (BR-CPEB). Bearbeitet von Wolfram Enßlin und Uwe Wolf unter Mitarbeit von Christine Blanken, Stuttgart 2014 (Bach-Repertorium. Werkverzeichnisse zur Musikerfamilie Bach. Herausgegeben vom Bach-Archiv Leipzig, Band III.2).
BR-JEB
Johann Ernst Bach. Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (BR-JEB). Bearbeitet von Klaus Rettinghaus, Stuttgart 2018 (Bach-Repertorium. Werkverzeichnisse zur Musikerfamilie Bach. Herausgegeben vom Bach-Archiv Leipzig, Band VI).
BWV
Bach-Werke-Verzeichnis. Thematisch-systematisches Verzeichnis der Werk Johann Sebastian Bachs. Bach-Werke-Verzeichnis, herausgeben von Wolfgang Schmieder, Leipzig 1950.
BWV2
Bach-Werke-Verzeichnis. 2. überarbeitete und erweiterte Ausgabe, Wiesbaden 1990.
BWV2a
Bach-Werke-Verzeichnis. Kleine Ausgabe nach der von Wolfgang Schmieder vorgelegten 2. Ausgabe, herausgegeben von Alfred Dürr und Yoshitake Kobayashi unter Mitarbeit von Kirsten Beißwenger, Wiebaden 1998.
BWV3
Bach-Werke-Verzeichnis. 3. grundlegend neubearbeitete Ausgabe, herausgegeben vom Bach-Archiv Leipzig, vorgelegt von Christine Blanken, Christoph Wolff und Peter Wollny (i. V.).
DMB
Denkmäler Mitteldeutscher Barockmusik
Dok II
Werner Neumann, Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs: 1685–1750, Kassel 1969.
Dok III
Hans-Joachim Schulze, Dokumente zum Nachwirken Johann Sebastian Bachs, 1750–1800, Kassel 1984.
Dok V
Hans-Joachim Schulze, Dokumente zu Leben, Werk und Nachwirken Johann Sebastian Bachs, 1685–1800. Neue Dokumente, Nachträge und Berichtigungen zu Band I–III, Kassel 2007.
Dok VII
Johann Nikolaus Forkel, Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke (Leipzig 1802). Edition, Quellen, Materialien, vorgelegt und erläutert von Christoph Wolff, Kassel 2008.
Dok IX
Christoph Wolff, Bach: Eine Lebensgeschichte in Bildern, Kassel 2017.
EBA
Edition Bach-Archiv Leipzig
EG
Edition Gravis
EMV
Ebert Musik Verlag
EP
Edition Peters
GraunWV
Christoph Henzel, Graun-Werkverzeichnis (GraunWV). Verzeichnis der Werke der Brüder Johann Gottlieb und Carl Heinrich Graun, Beeskow 2005
HE
Hänssler Edition
HWV Anh.
Hans Joachim Marx, Stefen Voss, Die G. F. Händel zugeschriebenen Kompositionen, 1700–1800, Hildesheim 2017.
JLB
nach Alfred Dörffel in Konrad Küster, Zwischen Wolfenbüttel und Coburg: Die Meininger Hofkapelle in ihren Anfängen (um 1700/10), in: Südthüringer Forschungen 27 (1994), S. 49–63.
KINGS
King’s Music
NBA
Johann Sebastian Bach, Neue Ausgabe sämtlicher Werke (Neue Bach-Ausgabe), herausgegeben vom Johann-Sebastian-Bach Institut Göttingen und vom Bach-Archiv Leipzig (Kassel und Leipzig, 1954–2006).
NBArev
Neue Bach-Ausgabe – Revidierte Edition, herausgegeben vom Bach-Archiv Leipzig (Kassel 2010ff.).
OM
Ortus Musikverlag
PB
Breitkopf-Editionsreihe: Partitur-Bibliothek
SBA
Stuttgarter Bach-Ausgaben, herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig, Stuttgart (ab 1992, unter Einbeziehung älterer Ausgaben des Hänssler Verlags).
TVWV
Werner Menke, Thematisches Verzeichnis der Vokalwerke von Georg Philipp Telemann, 2 Bde., Frankfurt 1982, 1983.
* Texthefte zur Kirchenmusik aus Bachs Leipziger Zeit: die 7 erhaltenen Drucke der Jahre 1724–1749 in faksimilierter Wiedergabe, hrsg. von Matin Petzoldt, Stuttgart 2000. – Drei weitere Texthefte sind seither bekanntgeworden.
1. Kantaten für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres
Die Kirchenkantaten Johann Sebastian Bachs machen den Hauptteil seines Gesamtwerkes aus. Nach Ausweis des ersten summarischen Werkverzeichnisses im Nekrolog auf Johann Sebastian Bach von 1750/1754 hinterließ der Komponist am Ende seines Lebens „fünf Jahrgänge von Kirchenstücken, auf alle Sonn- und Festtage.“1 Bei einem Ansatz von gut 60 Sonn- und Festtagsstücken pro Jahr und unter der ungesicherten Voraussetzung, dass die Jahrgänge vollständig waren, handelt es sich somit um insgesamt etwa 300 Werke. Wenn jedoch Zeitgenossen wie Christoph Graupner mehr als 1400, Georg Philipp Telemann rund 1750 Kantaten und Gottfried Heinrich Stölzel mindestens zwölf Kantaten-Jahrgänge hinterließen, handelt es sich rein mengenmäßig um eine bescheidene Anzahl. Doch Bachs Kantatenwerk zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er davon ausging, keine nur einmal aufzuführenden kurzlebigen Stücke, sondern – zumal in seiner Leipziger Zeit – wiederaufführbare Repertoirestücke zu komponieren. So konzentrierte er sich vorwiegend in den ersten Leipziger Jahren auf die Kirchenkantaten und ließ es nicht an Aufwand mangeln, um der seinerzeit jungen Gattung neue Wege zu weisen und dafür ein weitgehend singuläres Profil zu entwickeln. Insofern darf das Korpus der Bach-Kantaten zwar nicht quantitativ, aber qualitativ unbestritten als das Bedeutendste gelten, das die Gattungsgeschichte der Kantate aufzuweisen hat.
Der einstmals vorhandene Gesamtbestand dieses Kantatenwerkes wurde nur in erheblich dezimierter Form überliefert. Die 1750 erfolgte Aufteilung des Bach’schen Nachlasses unter seinen Erben führte zu einer Aufspaltung, an der die Witwe Anna Magdalena und die vier Musikersöhne primären Anteil hatten. Allerdings bekam Wilhelm Friedemann (laut Zeugnis des frühen Bach-Biographen Forkel) „das meiste davon.“2 Da jedoch gerade der älteste Sohn mit seinem Erbteil wenig sorgfältig umging, trug diese Tatsache zusammen mit anderen widrigen Umständen dazu bei, dass ein erheblicher Teil des Kantatenbestandes verloren ging. Trotz der fragmentarischen Überlieferung und der wohl unwiederbringlichen Verluste bietet das heute erhaltene Repertoire von etwa 180 Kirchenkantaten einen überaus reichhaltigen Schatz aus verschiedenen Schaffensperioden.
Der ungewöhnliche musikalische Reichtum von Bachs Kantatenschaffen spiegelt sich aber nicht nur im Gesamtkorpus wider, sondern auch in den einzelnen Jahrgängen, in größeren und kleineren Werkgruppen, doch vor allem im Einzelwerk. Insgesamt verdanken die Kantaten ihr unverwechselbares Gepräge den unterschiedlichen Abschnitten von Bachs Leben und den unerschöpflich sich wandelnden Ideen des Komponisten. Dass jedoch Bach seine Leipziger Antrittskantate „Die Elenden sollen essen“ BWV 75 „mit gutem applausu“ aufführte3 oder dass die Ratswahlkantate „Wir danken dir, Gott“ BWV 29 als eine „so künstlich als angenehme Music“ empfunden wurde,4 bleiben freilich die einzigen zeitgenössischen öffentlichen Reaktionen auf ein musikalisches Repertoire, das seinesgleichen nicht kannte.
Bach selbst benutzte nur selten den Begriff „Cantata“. Wenn er dies ausnahmsweise etwa bei der Solokantate „Ich bin vergnügt mit meinem Glücke“ BWV 84 tat, wird daraus deutlich, dass die Gattungsbezeichnung historisch auf die italienische Solokantate des 17. Jahrhunderts zurückgeht. Erstmals verwandte den Begriff Erdmann Neumeister im Titel seiner Textsammlung Geistliche Cantaten statt einer Kirchen-Music (Weißenfels 1700, 21705) und erklärte in seinem Vorwort: „so sieht eine Cantata nicht anders aus als ein Stück aus einer Opera, von Stylo Recitativo und Arien zusammengesetzt.“ Neumeister löste mit diesem Vorbild madrigalischer Dichtung in der protestantischen Figuralmusik Mittel- und Norddeutschlands eine nachhaltige Reformbewegung aus, der sich auch Bach in seinen Weimarer Jahren anschloss. Freilich pflegte Bach seine Kantaten durchweg als „Concerto“, hin und wieder – etwa bei „Meine Seufzer meine Tränen“ BWV 13 – gar als „Concerto da Chiesa“ zu bezeichnen und führte damit die ältere Tradition des geistlichen Konzertes auf moderner Ebene fort.
Die sogenannten Jahrgangskantaten beziehen sich auf das Proprium de tempore des Kirchenjahres vom 1. Advent bis zum letzten Sonntag nach Trinitatis. Detempore-Kantaten – in Leipzig „Haupt-Music“ genannt – wurden aufgeführt im Rahmen der Liturgie des „Amtes“ (Hauptgottesdienst am Vormittag) unmittelbar nach den Lesungen von Epistel und Evangelium und ersetzten damit die früheren Evangelien-Motetten. Die vertonten Kantatentexte bezogen sich dann auch auf die Lesungen, zumal des Evangeliums. Bei zweiteiligen Werken oder bei Aufführung zweier Kantaten erfolgte die Darbietung des zweiten Stückes nach der Predigt unter dem Abendmahl (sub communione). In Leipzig war es außerdem üblich, dass die Kantatenaufführungen Sonntag um Sonntag zwischen den beiden Hauptkirchen der Stadt, St. Nicolai und St. Thomae, alternierten. An den hohen Festtagen hingegen wechselten die Aufführungen zwischen Amt und Vesper, d. h. den Vor- und Nachmittagsgottesdiensten, so dass die Festkantate in beiden Hauptkirchen erklingen konnte.
Als hohe Festtage galten im lutherischen Deutschland Weihnachten, Ostern und Pfingsten (allerdings nur die jeweils ersten beiden Tage der dreitägig gefeierten Feste), außerdem der Neujahrstag, Ephiphanias (6. Januar), Himmelfahrt und der Trinitatissonntag. Hinzu traten die kalendarisch fixierten Marien- und Apostelfeste Mariae Reinigung (2. Februar), Mariae Verkündigung (25. März), Johannistag (24. Juni), Mariae Heimsuchung (2. Juli), Michaelistag (29. September) und das Reformationsfest (31. Oktober). Die Fastenzeiten des Kirchenjahres wurden unterschiedlich behandelt. So galten in Leipzig – im Unterschied zu Weimar – die Abschnitte vom 2. bis 4. Advent und von Invocavit bis Palmarum als musiklose Zeiten (tempus clausum).5
Bachs reguläre Beschäftigung mit Jahrgangskantaten begann mit seiner Ernennung zum Konzertmeister am Weimarer Hof im März 1714, der damit verbundenen Aufgabe „monatlich neue Stücke“ aufzuführen6 und der Vertonung von geistliche Textzyklen der Dichter Erdmann Neumeister, Georg Christian Lehms und Salomon Franck. Als erstes Werk erklang in diesem Zusammenhang am 25. März 1714 „Himmelskönig, sei willkommen“ BWV 182. Zuvor hatte Bach nur unregelmäßig „Organisten-Musik“ (d. h. Vokalwerke zu besonderen Anlässen) komponiert und im Anschluss an die Weimarer Jahre während der Köthener Kapellmeisterzeit 1718–23 schrieb Bach nur ausnahmsweise Kirchenkantaten, da in den calvinistisch-geprägten Fürstentümern Anhalts gottesdienstliche Figuralmusik nicht üblich war. Unter die Ausnahmen zählen gewisse Festmusiken wie „Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen“ BWV 1147 (→) oder die Trauermusik für Fürst Leopold BWV 1143 (→).
Erst in Leipzig widmete sich Bach erneut, und in nunmehr ausgiebiger Weise, den Jahrgangskantaten. Es begann bereits mit den beiden Bewerbungsstücken um das Thomaskantorat, den Kantaten „Jesus nahm zu sich die Zwölfe“ BWV 22 und „Du wahrer Gott und Davids Sohn“ BWV 23, die jeweils vor und nach der Predigt am Sonntag Estomihi 1723 erklangen. Die regelmäßigen Leipziger Kantaten begannen mit Bachs Amtseinführung zum Schuljahresbeginn, dem 1. Sonntag nach Trinitatis am 30. Mai 1723, und setzten ein mit „Die Elenden sollen essen“ BWV 75. Den Kantaten des Leipziger Jahrgangs I liegen Libretti unterschiedlicher, meist unbekannter Verfasser zugrunde. Außerdem integrierte er, was aus dem vorhandenen Weimarer Kantatenbestand geeignet war, darunter gleich als erstes Werk „Ich hatte viel Bekümmernis“ BWV 21 zum 3. Sonntag nach Trinitatis. Damit konnte Bach den ungewohnten Arbeitsaufwand in Grenzen halten. Aus dem gleichen Grund übernahm er gelegentlich auch Köthener Musik durch Parodie weltlicher Kantaten, darunter beispielsweise für die 2. und 3. Oster- und Pfingsttage 1724 die Kantaten BWV 66, 134, 173 und 184.
Der Leipziger Jahrgang II besteht ausschließlich aus neukomponierten Kantaten, wodurch das Schuljahr 1724–25 zum insgesamt produktivsten Jahr in Bachs Leben wurde. Mit „O Ewigkeit, du Donnerwort“ BWV 20 einsetzend, komponierte der Thomaskantor eine über neun Monate hin ununterbrochene Reihe von Choralkantaten. Dabei handelt es sich um Werke, denen ausschließlich Choralmelodien und -texte zugrunde liegen, wobei der oder die Verfasser der Umdichtungen der Choral-Binnenstrophen unbekannt sind. Doch der oder die Textdichter hielten sich streng an die offensichtlich von Bach gemachten formalen Vorgaben, die dem gesamten Zyklus ein einheitliches Profil verliehen. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt dabei auf dem klassischen Kirchenlied-Repertoire von der Reformationszeit bis in die Generation Paul Gerhardts. Die geschlossene Reihe von 42 Choralkantaten bricht aus unbekannten Gründen Ostern 1725 ab und es folgen reguläre gemischte Kantaten aus Bibelwort, Choralstrophe und freier Dichtung, darunter neun Vertonungen von Texten der Leipziger Poetin Christiane Mariane von Ziegler.
Im Unterschied zu den ersten beiden Jahrgängen verteilt sich der Leipziger Jahrgang III auf mehrere Jahre bis 1727 und basiert auf Textvorlagen verschiedener Verfasser, darunter wiederum auch Lehms, Franck und Neumeister, denen sich Bach bereits in Weimar gewidmet hatte. Zwischen Februar und September 1726 wandte er sich der anonymen (Herzog Ernst-Ludwig I. von Sachsen-Meiningen zugeschriebenen) Sammlung Sonntags- und Fest-Andachten (Meiningen 1719) zu, der zwanzig Kantaten seines Meininger Vetters Johann Ludwig Bach entstammten, die er vor allem von Februar bis Mai desselben Jahres in Leipzig aufführte; sieben Texte daraus vertonte er selbst, darunter „Brich dem Hungrigen dein Brot“ BWV 39, das dann zum Eröffnungsstück des Jahrgangs III wurde. Als musikalische Besonderheit dieses Jahrgangs enthalten mehrere Kantaten ausgedehnte Konzertsätze, darunter vor allem ab 1726 solche mit obligater Orgel wie BWV 146, 35, 169, 49, 188 und 156.
Der darauffolgende Jahrgang IV auf Texte einer 1728 veröffentlichten Sammlung von Christian Friedrich Henrici (genannt Picander) wurde von Bach wohl nur zum Teil vertont; jedenfalls haben sich mit BWV 84, 120, 149, 156, 159, 171, 174, 188, 190 und 197 nur wenige Vertonungen des Picander-Jahrgangs erhalten. Doch vergab Bach später offenbar weitere Texte daraus zur Vertonung an seine Schüler, darunter an seinen Sohn Carl Philipp Emanuel, der in den frühen 1730er Jahren die Septuagesimae-Kantate „Ich bin vergnügt mit meinem Stande“ und die Kantate zum 3. Ostertag „Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen“ BWV 145 komponierte.
Welche Bewandtnis es mit dem fünften Jahrgang hat, bleibt unklar. Doch wahrscheinlich handelt es sich auch hier eher um eine unvollständige Sammlung, etwa von nicht für den Leipziger Gebrauch übernommenen Weimarer Werken bzw. von einem gewissen Kantaten-Überhang. Dazu zählen Kantaten ohne Bestimmung, zudem außerhalb der eigentlichen Jahrgangskantaten einige wenige, die – aufgrund ihrer kirchenjahresmäßig ungebundenen Texte – für jede Zeit (per ogni tempo) geeignet waren und ohne liturgische Zweckbestimmung überliefert wurden. Sie dürften ausnahmslos für einen konkreten Anlass komponiert worden sein, mögen jedoch nachträglich bestimmten Sonntagen zugeordnet oder auch zu auswärtigen Konzerten genutzt worden sein, wie etwa für die 1720 in Hamburg erfolgte Aufführung von „Ich hatte viel Bekümmernis“ BWV 21 belegt.7
1 Dok III, Nr. 666. – Der Begriff Jahrgang versteht sich hier nicht (wie etwa bei G. P. Telemann) im Sinne von komponierten Jahrgängen nach einheitlichen Textvorlagen für die Sonn- und Festtage des mit dem 1. Advent beginnenden Kirchenjahres. Vielmehr bezieht er sich auf die Überlieferung der ab 1723 in Leipzig aufgeführten Kantatenzyklen, die sich jeweils nach den mit dem 1. Sonntag nach Trinitatis einsetzenden Schuljahr richten.
2 Dok VII, S. 81.
3 Dok II, Nr. 139.
4 Dok II, Nr. 452.
5 Falls der 25. März in die Karwoche fiel, galt die Sonderregelung, das Fest Mariae Verkündigung an Palmarum zu feiern. Zur Leipziger Festtagsordnung siehe Günther Stiller, Johann Sebastian Bach und das Leipziger gottesdienstliche Leben seiner Zeit, Berlin 1970.
6 Dok II, Nr. 66.
7 Dok II, Nr. 200.
1. Advent bis 27. Sonntag nach Trinitatis
1. Advent
Epistel: Römer 13,11–14; Evangelium: Matthäus 21,1–9 (Jesu Einzug in Jerusalem)
„Nun komm, der Heiden Heiland“ BWV 61 BC A 1
Entstanden in Weimar, zum 2. Dezember 1714 (autogr. Datum); zum 28. November 1723 übernommen in Leipziger Jahrgang I.
Text: Erdmann Neumeister (Neumeister 1714)
Besetzung: SATB, 2 Vl, 2 Va, Bc
NBA I/1 (1954) – SBA (2001)
1. Choral (figuriert): Nun komm, der Heiden Heiland (M. Luther, Str. 1)Tutti – | | : a-Moll
2. Rezitativ: Der Heiland ist gekommenT, Bc – : C-Dur
3. Arie: Komm, Jesu, komm zu deiner KircheT, Str unis, Bc – : C-Dur
4. Rezitativ: Siehe, ich stehe vor der Tür (Offenbarung 3,20)B, 2 Vl, 2 Va, Bc – : e-Moll G-Dur
5. Arie: Öffne dich, mein ganzes HerzeS, Bc – : G-Dur
6. Choral (figuriert): Amen, komm du schöne Freudenkrone (P. Nicolai, Wie schön leuchtet der Morgenstern, Str. 7 / Abgesang)Tutti – : G-Dur
„Nun komm, der Heiden Heiland“ BWV 62 BC A 2
Entstanden in Leipzig, zum 3. Dezember 1724 (Jahrgang II)
Text: Martin Luther (1524), Str. 1 und 8; Str. 27 (Satz 25) Umdichtung eines unbekannten Verfassers.
Besetzung: SATB, Cor, 2 Ob, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/1 (1954) – SBA (1982/2017)
1. Choral (figuriert): Nun komm, der Heiden HeilandTutti – : h-Moll
2. Arie: Bewundert, o Menschen, dies große GeheimnisT, Str + 2 Ob unis, Bc – : G-Dur
3. Rezitativ: So geht aus Gottes Herrlichkeit und ThronB, Bc – : D-Dur A-Dur
4. Arie: Streite, siege, starker HeldB, Str + Bc unis – : D-Dur
5. Rezitativ: Wir ehren diese HerrlichkeitS, A, Str, Bc – : A-Dur h-Moll
6. Choral: Lob sei Gott, dem Vater tonTutti – : h-Moll
„Schwingt freudig euch empor“ BWV 36.4, 5 BC A 3a, b
Als Kirchenkantate 36.4 entstanden in Leipzig nach 1725 (Jahrgang III) durch Umarbeitung der gleichnamigen Glückwunschkantate 36.1 ( Seite 242), unter Hinzufügung eines neu komponierten Schlusschorals.
36.1/1: Schwingt freudig euch empor 36.4/1
36.1/3: Die Liebe zieht mit sanften Schritten 36.4/2
36.1/5: Der Tag, der dich vordem gebar 36.4/3
36.1/7: Mit zarten und vergnügten Trieben 36.4/4
Zum 2. Dezember 1731 erweitert zur zweiteiligen Kantate 36.5 durch Einfügung dreier Strophen von Luthers Adventslied Nun komm, der Heiden Heiland (Satz 2, 6 und 8); Satz 4 (Schlusschoral 36.4) mit neuer Textunterlegung.
Text: Dichter der geistlichen Parodie unbekannt (C. F. Henrici?)
Besetzung 36.4: SATB, Obda, 2 Vl, Va, Bc; 36.5: 2 Obda
NBA I/1 (1954) – SBA (2016: 36.5)
Fassung 36.4
1. Chor: Schwingt freudig euch emporTutti – : D-Dur
2. Arie: Die Liebe zieht mit sanften SchrittenT, Obda, Bc – : h-Moll
3. Arie: Sei mir willkommen, werter SchatzB, Str, Bc – : D-Dur
4. Arie: Auch mit gedämpften schwachen Stimmen S, Vl solo, Bc – : A-Dur
5. Choral: Wie bin ich doch so herzlich froh (P. Nicolai, Wie schön leuchtet der Morgenstern, Str. 6) Tutti – : D-Dur
Fassung 36.5
Erster Teil
1. Chor: Schwingt freudig euch emporTutti – : D-Dur
2. Choral (figuriert): Nun komm der Heiden Heiland (M. Luther, Str. 1)S, A, 2 Obda, Bc – : fis-Moll
3. Arie: Die Liebe zieht mit sanften Schritten T, Obda, Bc – : h-Moll
4. Choral: Zwingt die Saiten in Cythara (P. Nicolai, Wie schön leuchtet der Morgenstern, Str. 7) Tutti – : D-Dur
Zweiter Teil
5. Arie: Willkommen, werter Schatz B, Str, Bc – : D-Dur
6. Choral (figuriert): Der du bist dem Vater gleich (M. Luther, Str. 6)T, 2 Obda, Bc – : h-Moll
7. Arie: Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen S, Vl solo, Bc – : G-Dur
8. Choral: Lob sei Gott dem Vater ton (M. Luther, Str. 8)Tutti – : h-Moll
2. Advent
Epistel: Römer 15,4–13; Evangelium: Lukas 21,25–36 (Von der Wiederkunft Christi)
„Wachet! betet! betet! wachet!“ BWV 70.1 BWV2 70a, BC A 4
Entstanden in Weimar, zum 6. Dezember 1716. Text von Salomon Franck (Franck 1717); Musik überliefert in Leipziger Neufassung 70.2 zum 26. Sonntag nach Trinitatis (in Leipzig keine Figuralmusik vom 2. bis 4. Advent), →. NBA I/1 (1954)
1. Chor: Wachet! betet! betet! wachet!
2. Arie: Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen
3. Arie: Lasst der Spötter Zungen schmähen
4. Arie: Hebt euer Haupt empor
5. Arie: Seligster Erquickungstag
6. Choral: Nicht nach Welt, nach Himmel nicht (C. Keymann, Meinen Jesum lass ich nicht)
3. Advent
Epistel: 1. Korinther 4,1–5; Evangelium: Matthäus 11,2–10 (Johannes der Täufer im Gefängnis)
„Ärgre dich, o Seele, nicht“ BWV 186
Die Komposition einer Kantate zum 3. Advent am 13. Dezember 1716 (BWV2 186a / BC A 5) auf einen Text von Salomon Franck (Franck 1717) war vermutlich geplant und vielleicht teilweise ausgeführt, doch fehlen dafür im Unterschied zu BWV 147 ( →) quellenmäßige Belege. Jedenfalls erfolgte die Fertigstellung des Werkes erst 1723 mit erweitertem Text und neuer Bestimmung zum 7. Sonntag nach Trinitatis; siehe BWV 186 ( →).
4. Advent
Epistel: Philipper 4,4–7; Evangelium: Johannes 1,19–28 (Zeugnis Johannes des Täufers)
„Bereitet die Wege, bereitet die Bahn“ BWV 132 BC A 6
Entstanden in Weimar, zum 22. Dezember 1715 (autogr. Datum); Aufführung in Chorton A-Dur. Schlusschoral fehlt in den Originalquellen. – Aufführung in Leipzig nicht nachweisbar (dort keine Figuralmusik vom 2. bis 4. Advent).
Text: Salomon Franck (Franck 1715)
Besetzung: SATB, Ob, Fg, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/1 (1954, kammertönig) – NBArev (2012, bitonal) – SBA (2007, kammertönig, Ob-Stimme auch transponiert für bitonale Aufführung)
1. Arie: Bereitet die Wege, bereitet die Bahn
S, alle Instr – : A-Dur
2. Rezitativ: Willst du dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen
T, Bc – : A-Dur
3. Arie: Wer bist du? Frage dein Gewissen
B, Bc – : E-Dur
4. Rezitativ: Ich will, mein Gott, dir frei heraus bekennen
A, Str, Bc – : h-Moll D-Dur
5. Arie: Christi Glieder, ach bedenket
A, Vl solo, Bc – : h-Moll
6. Choral: Ertöt uns durch dein Güte (E. Creutziger, Herr Christ, der einig Gotts Sohn, Str. 5) SBA: nach BWV 164/6 ergänzt
„Herz und Mund und Tat und Leben“ BWV 147
Von der Kantate zum 4. Advent am 20. Dezember 1716 (BWV2 147a / BC A 7) auf einen Text von Salomon Franck (Franck 1717) existiert nur Satz 1, der in Weimarer Reinschrift überliefert ist. Hingegen mangelt es an quellenmäßigen und musikalischen Belegen für die Entstehung weiterer Sätze in Weimar. Die Fertigstellung des Werkes erfolgte 1723 mit erweitertem Text und neuer Bestimmung zum Fest Mariae Heimsuchung; siehe BWV 147, → – Möglicherweise spielte Bach gegen Ende 1716 bei den drei Schwesterwerken zum 2. bis 4. Advent auf Texte aus Franck 1717 kurzzeitig mit dem Gedanken eines regulären Jahrgangs. BWV 147/1 markiert dann freilich das abrupte und im einzelnen ungeklärte Ende von Bachs Weimarer Kantatenproduktion.
1. Weihnachtstag
Epistel: Titus 2,11–14 oder Jesaja 9,2–7; Evangelium: Lukas 2,1–14 (Geburt Christi)
„Christen, ätzet diesen Tag“ BWV 63 BC A 8
Entstanden in Weimar, zum 25. Dezember 1714; 1723 übernommen in Leipziger Jahrgang I.
Text: Verfasser wahrscheinlich Johann Michael Heineccius (partielle Übereinstimmung mit dessen Reformationskantate von 1717).
Besetzung: SATB, 4 Tr, Timp, 3 Ob, Fg, 2 Vl, Va, Bc – Wiederaufführung um 1729: Satz 3 mit Org obl statt Ob
NBA I/2 (1957) – SBA (1982/2000)
1. Chor: Christen, ätzet diesen Tag Tutti – : C-Dur
2. Rezitativ: Oh, selger Tag! o ungemeines Heute A, Str, Bc – : C-Dur a-Moll
3. Arie (Duett): Gott, du hast es wohl gefügetS, B, Ob (Org obl), Bc – : a-Moll
4. Rezitativ: So kehret sich nun heut das bange Leid T, Bc – : C-Dur G-Dur
5. Arie (Duett): Ruft und fleht den Himmel an A, T, Str, Bc – : G-Dur
6. Rezitativ: Verdoppelt euch demnach B, 3 Ob, Str, Bc – : e-Moll C-Dur
7. Chor: Höchster, schau in Gnaden anTutti – : C-Dur
„Gelobet seist du, Jesu Christ“ BWV 91 BC A 9
Entstanden in Leipzig, zum 25. Dezember 1724 (Jahrgang II). – Anlässlich Wiederaufführung um 1746/47 satztechnische Änderungen im Notentext von Satz 5–6.
Text: Martin Luther (1524), Str. 1, 2 und 7 (Satz 1, 2 und 6); Str. 3–6 (Satz 3–5) Umdichtung eines unbekannten Verfassers.
Besetzung: SATB, 2 Cor, Timp, 3 Ob, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/2 (1957) – SBA (1985/2017)
1. Choral (figuriert): Gelobet seist du, Jesu ChristTutti – : G-Dur
2. Rezitativ + Choral: Der Glanz der höchsten Herrlichkeit / Des ewgen Vaters einigs KindS, Bc – : e-Moll
3. Arie: Gott, dem der Erden Kreis zu kleinT, 3 Ob, Bc – : a-Moll
4. Rezitativ: O Christenheit! wohlan, so mache dich bereitB, Str, Bc – : G-Dur C-Dur
5. Arie (Duett): Die Armut, so Gott auf sich nimmtS, A, 2 Vl unis, Bc – : e-Moll
6. Choral: Das hat er alles uns getanTutti – : G-Dur
„Unser Mund sei voll Lachens“ BWV 110 BC A 10
Entstanden in Leipzig, zum 25. Dezember 1725 (Jahrgang III) – Satz 1: Umarbeitung der Ouvertüre BWV 1069/1 mit Choreinbau im Mittelteil;
Satz 5: Rückgriff auf den Einlagesatz „Virga Jesse floruit“ aus dem Magnificat BWV 243.1/D ( →).
Text: Georg Christian Lehms (Lehms 1711)
Besetzung: SATB, 3 Tr, Timp, 2 Fl trav, 3 Ob (auch Obda, Obca), Fg, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/2 (1957) – SBA (1983/2017)
1. Chor: Unser Mund sei voll Lachens (Psalm 126,2–3)Tutti – | =: D-Dur
2. Arie: Ihr Gedanken und ihr SinnenT, 2 Fl trav, Bc – : h-Moll
3. Rezitativ: Dir, Herr, ist niemand gleich (Jeremia 10,6)B, Str, Bc – : fis-Moll A-Dur
4. Arie: Ach Herr, was ist ein MenschenkindA, Obda, Bc – : fis-Moll
5. Arie (Duett): Ehre sei Gott in der Höhe (Lukas 2,14)S, T, Bc – : A-Dur
6. Arie: Wacht auf, ihr Adern und ihr GliederB, Tr, Str + 3 Ob unis, Bc – : D-Dur
7. Choral: Alleluja! Gelobt sei Gott (C. Füger, Wir Christenleut, Str. 5)Tutti – : h-Moll
„Ehre sei Gott in der Höhe“ BWV 197.1 BWV1 197a, BC A 11
Als Weihnachtskantate 197.1entstanden in Leipzig, zum 25. Dezember 1728 oder Folgejahr (Picander-Jahrgang). Unvollständig überliefert: Musik nur für die letzten 19 Takte von Satz 4 sowie Satz 5–7 erhalten. – Teilweise übernommen in die Trauungskantate 197.2 „Gott ist unsre Zuversicht“ ( →).
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander 1728, Picander 1732)
Besetzung: SATB, 2 Fl trav, Obda, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/2 (1957: Fragment) – SBA (1964: nur Satz 4, Rek.: Diethard Hellmann; 2022: ganze Kantate, Rek.: Pieter Dirksen)
1. Chor: Ehre sei Gott in der Höhe (Lukas 2,14)
2. Arie: Erzählet, ihr Himmel, die Ehre Gottes
3. Rezitativ: O Liebe, der kein Lieben gleicht
4. Arie: O du angenehmer Schatz A, 2 Fl trav, Bc – : G-Dur
5. Rezitativ: Das Kind ist mein, und ich bin seinB, Bc – : e-Moll A-Dur
6. Arie: Ich lasse dich nichtB, Obda, Bc – : D-Dur
7. Choral: Wohlan! so will ich mich (C. Ziegler, Ich freue mich in dir, Str. 4)Tutti – : D-Dur
Weihnachts-Oratorium (Teil I) BWV 248 ( →)
„Gloria in excelsis Deo“ BWV 191 ( →)
2. Weihnachtstag
Epistel: Titus 3,4–7; Evangelium: Lukas 2,15–20 (Die Hirten an der Krippe)
„Darzu ist erschienen der Sohn Gottes“ BWV 40 BC A 12
Entstanden in Leipzig, zum 26. Dezember 1723 (Jahrgang I). – Satz 1 übernommen in die Messe F-Dur BWV 233.2 ( →).
Text: Verfasser unbekannt
Besetzung: SATB, 2 Cor, 2 Ob, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/3.1 (2000) – SBA (1986/2017)
1. Chor: Darzu ist erschienen der Sohn Gottes (1. Johannes 3,8)Tutti – : F-Dur
2. Rezitativ: Das Wort ward Fleisch und wohnet in der WeltT, Bc – : F-Dur B-Dur
3. Choral: Die Sünd macht Leid (C. Füger, Wir Christenleut, Str. 3)Tutti – : g-Moll
4. Arie: Höllische Schlange, wird dir nicht bangeB, 2 Ob, Str, Bc – : d-Moll
5. Rezitativ: Die Schlange, so im Paradies A, Str, Bc – : B-Dur
6. Choral: Schüttle deinen Kopf und sprich (P. Gerhardt, Schwing dich auf zu deinem Gott, Str. 2)Tutti – : d-Moll
7. Arie: Christenkinder, freuet euchT, 2 Cor, 2 Ob, Bc – : F-Dur
8. Choral: Jesu, nimm dich deiner Glieder (C. Keymann, Freuet euch, ihr Christen alle, Str. 4)Tutti – : f-Moll
„Christum wir sollen loben schon“ BWV 121 BC A 13
Entstanden in Leipzig, zum 26. Dezember 1724 (Jahrgang II)
Text: Martin Luther (1524), Str. 1 und 6 (Satz 1 und 6); Str. 2–5 (Satz 2–5) Umdichtung eines unbekannten Verfassers.
Besetzung: SATB, Ctto, 3 Trb, Obda, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/3.1 (2000) – SBA (2017)
1. Choral (figuriert): Christum wir sollen loben schonTutti – : phrygisch Fis-Dur
2. Arie: O du von Gott erhöhte KreaturT, Obda, Bc – : h-Moll
3. Rezitativ: Der Gnade unermesslichs WesenA, Bc – : D-Dur C-Dur
4. Arie: Johannis freudenvolles SpringenB, Str, Bc – : C-Dur
5. Rezitativ: Doch wie erblickt es dich in deiner KrippenS, Bc – : G-Dur h-Moll
6. Choral: Lob, Ehr und Dank sei dir gesagt
Tutti – : phrygisch Fis-Dur
„Selig ist der Mann“ BWV 57 BC A 14
Dialog (Seele/Jesus)
Entstanden in Leipzig, zum 26. Dezember 1725 (Jahrgang III)
Text: Georg Christian Lehms (Lehms 1711)
Besetzung: S (Seele), B (Jesus), SATB, 2 Ob, Tl, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/3.1 (2000) – SBA (2012)
1. Arie: Selig ist der Mann (Jakobus 1,12)B, Str + 2 Ob + Tl unis, Bc – : g-Moll
2. Rezitativ: Ach! dieser süße Trost erquickt auch mir mein HerzS, Bc – : Es-Dur c-Moll
3. Arie: Ich wünschte mir den TodS, Str, Bc – : c-Moll
4. Rezitativ: Ich reiche dir die Hand S, B, Bc – : g-Moll B-Dur
5. Arie: Ja, ja, ich kann die Feinde schlagenB, Str, Bc – : B-Dur
6. Rezitativ: In meinem Schoß liegt Ruh und LebenS, B, Bc – : Es-Dur d-Moll
7. Arie: Ich ende behende mein irdisches LebenS, Vl solo, Bc – : g-Moll B-Dur
8. Choral: Richte dich, Liebste, nach meinem Gefallen (A. Fritsch, Hast du denn, Jesus, dein Angesicht, Str. 6) Tutti – : B-Dur
Weihnachts-Oratorium (Teil II) BWV 248 ( →)
3. Weihnachtstag
Hebräer 1,1–14; Evangelium: Johannes 1,1–14 (Am Anfang war das Wort)
„Sehet, welch eine Liebe“ BWV 64 BC A 15
Entstanden in Leipzig, zum 27. Dezember 1723 (Jahrgang I)
Text: Johann Oswald Knauer (Knauer 1720), verändert und um zwei Choralstrophen (Satz 2 und 4) erweitert.
Besetzung: SATB, Ctto, 3 Trb, Obda, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/3.1 (2000) – SBA (1982/2017)
1. Chor: Sehet, welch eine Liebe (1. Johannes 3,1)SATB, Ctto, 3 Trb, Str, Bc – : e-Moll
2. Choral: Das hat er alles uns getan (M. Luther, Gelobet seist du, Jesu Christ, Str. 7)SATB, Ctto, 3 Trb, Str, Bc – : mixolydisch
3. Rezitativ: Geh, Welt! behalte nur das DeineA, Bc – : C-Dur D-Dur
4. Choral: Was frag ich nach der Welt (B. Kindermann, Str. 1)SATB, Ctto, 3 Trb, Str, Bc – : D-Dur
5. Arie: Was die Welt in sich hältS, Str, Bc – : h-Moll
6. Rezitativ: Der Himmel bleibet mir gewissB, Bc – : G-Dur
7. Arie: Von der Welt verlang ich nichtsA, Obda, Bc – : G-Dur
8. Choral: Gute Nacht, o Wesen (J. Franck, Jesu, meine Freude, Str. 5)SATB, Ctto, 3 Trb, Str, Bc – : e-Moll
„Ich freue mich in dir“ BWV 133 BC A 16
Entstanden in Leipzig, zum 27. Dezember 1724 (Jahrgang II)
Text: Caspar Ziegler (1697), Str. 1 und 4 (Satz 1 und 6); Str. 2–3 (Satz 2–5) Umdichtung eines unbekannten Verfassers.
Besetzung: SATB, Ctto, 2 Obda, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/3.1 (2000) – SBA (2012)
1. Choral (figuriert): Ich freue mich in dirTutti – : D-Dur
2. Arie: Getrost! es fasst ein heilger LeibA, 2 Obda, Bc – : A-Dur
3. Rezitativ: Ein Adam mag sich voller SchreckenT, Bc – : fis-Moll D-Dur
4. Arie: Wie lieblich klingt es in den Ohren S, Str, Bc – | | : h-Moll
5. Rezitativ: Wohlan, des Todes Furcht und SchmerzB, Bc – : h-Moll D-Dur
6. Choral: Wohlan, so will ich mich an dichTutti – : D-Dur
„Süßer Trost, mein Jesus kömmt“ BWV 151 BC A 17
Entstanden in Leipzig, zum 27. Dezember 1725 (Jahrgang III). Wiederaufführung 1728–1731 mit autogr. Nachträgen.
Text: Georg Christian Lehms (Lehms 1711)
Besetzung: SATB, Fl trav, Obda, 2 Vl, Va, Bc – Wiederaufführung 1728–1731 ohne Bläser: Satz 1 mit Vl solo statt Fl trav, Satz 3 nur mit Str.
NBA I/3.1 (2000) – SBA (2007)
1. Arie: Süßer Trost, mein Jesus kömmtS, Fl trav, Obda + Vl, Va, Bc – | | : G-Dur
2. Rezitativ: Erfreue dich, mein HerzB, Bc – : D-Dur e-Moll
3. Arie: In Jesu Demut kann ich TrostA, Obda + Str unis, Bc : e-Moll
4. Rezitativ: Du teurer GottessohnT, Bc – : h-Moll G-Dur
5. Choral: Heut schleußt er wieder auf die Tür (N. Herman, Lobt Gott, ihr Christen allzugleich, Str. 8) Tutti – : G-Dur
Weihnachts-Oratorium (Teil III) BWV 248 ( →)
Sonntag nach Weihnachten
Epistel: Galater 4,1–7; Evangelium: Lukas 2,3340 (Die Worte von Simeon und Hanna an Maria)
„Tritt auf die Glaubensbahn“BWV 152 BC A 18
Dialog (Seele/Jesus)
Entstanden in Weimar, zum 30. Dezember 1714. Wohl 1726 übernommen in Leipziger Jahrgang III, wahrscheinlich mit Austausch von Satz 6 (Duett) gegen Schlusschoral (Musik nicht überliefert).
Text: Salomon Franck (Franck 1715); Nachdruck (Birkmann 1728), mit Schlusschoral
Besetzung: S (Seele), B (Jesus), Fl dolce, Ob, Vada, Bc (+Vga)
NBA I/3.2 (2000) SBA (2015)
1. Sinfonia Alle Instr – | : e-Moll
2. Arie: Tritt auf die GlaubensbahnB, Ob, Bc – : e-Moll
3. Rezitativ: Der Heiland ist gesetzt B, Bc – : c-Moll G-Dur
4. Arie: Stein, der über alle Schätze S, Fl dolce, Vada, Bc – : G-Dur
5. Rezitativ: Es ärgre sich die kluge WeltB, Bc – : e-Moll G-Dur
6. Arie (Duett): Wie soll ich dich, Liebster der Seelen umfassen Tutti – : e-Moll
7. Choral: Sag an, meins Herzens Bräutigam (J. Rist, Willkommen, süßer Bräutigam, Str. 3; Mel. Ermuntre dich, mein schwacher Geist)
„Das neugeborne Kindelein“ BWV 122 BC A 19
Entstanden in Leipzig, zum 31. Dezember 1724 (Jahrgang II)
Text: Cyriacus Schneegaß, Das neugeborne Kindelein (1597), Str. 1, 3 und 4 (Satz 1, 4 und 6); Str. 2–4 (Satz 2–3 und 5) Umdichtung eines unbekannten Verfassers.
Besetzung: SATB, 3 Fl dolce, 2 Ob, Tl, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/3.2 (2000) – SBA (2012)
1. Choral (figuriert): Das neugeborne KindeleinSATB, Str + 2 Ob + Tl unis, Bc – : g-Moll
2. Arie: O Menschen, die ihr täglich sündigt B, Bc – : c-Moll
3. Rezitativ + instr. Choral (Mel. Das neugeborne Kindlein): Die Engel, welche sich zuvorS, 3 Fl dolce unis, Bc – : g-Moll
4. Arie (Duett) + Choral: O wohl uns, die wir an ihn glauben / Ist Gott versöhnt und unser FreundS, A (c.f.), T, Vl + Va unis, Bc – : d-Moll
5. Rezitativ: Dies ist ein Tag, den selbst der Herr gemacht B, Str, Bc – : B-Dur g-Moll
6. Choral: Es bringt das rechte Jubeljahr SATB, Str + 2 Ob + Tl unis, Bc – : g-Moll
„Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende“ BWV 28 BC A 20
Entstanden in Leipzig, zum 30. Dezember 1725 (Jahrgang III) – Satz 2 mit neuem Text „Sei Lob und Preis mit Ehren“ übernommen in die nach 1750 unter Bachs Namen zusammengestellte Motette „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ BWV2 231.
Text: Erdmann Neumeister (Neumeister 1714)
Besetzung: SATB, Ctto, 3 Trb, 2 Ob, Tl, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/3.2 (2000) – SBA (2011)
1. Arie: Gottlob! nun geht das Jahr zu EndeS, 2 Ob, Tl, Str, Bc – : a-Moll
2. Choral (figuriert): Nun lob, mein Seel, den Herren (J. Gramann, Str. 1)Tutti – : C-Dur
3. Rezitativ und Arioso: So spricht der Herr: Es soll mir eine Lust sein (Jeremia 32,41) B, Bc – : e-Moll
4. Rezitativ: Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fleußtT, Str, Bc – : G-Dur C-Dur
5. Arie (Duett): Gott hat uns im heurigen Jahre gesegnetA, T, Bc – : C-Dur
6. Choral: All solch dein Güt wir preisen (P. Eber, Helft mir Gottes Güte preisen, Str. 12)Tutti – : a-Moll
Neujahr
Epistel: Galater 3,23–29; Evangelium: Lukas 21 (Beschneidung und Namengebung Jesu)
„Singet dem Herrn ein neues Lied“ BWV 190.1 BC A 21
Entstanden als Neujahrskantate 190.1 in Leipzig, zum 1. Januar 1724 (Jahrgang I); Satz 1–2 unvollständig überliefert (ohne Bläser und Bc). 1730 umgearbeitet als Festkantate zur Zweihundertjahrfeier der Augsburgischen Konfession 190.2 (Musik nicht erhalten); →.
Text: Verfasser unbekannt
Besetzung: SATB, 3 Tr, Timp, 3 Ob (auch Obda), Fg, 2 Vl, Va, Bc (Satz 1–2 unvollständig überliefert, siehe oben).
NBA I/4 (1965, Fragment) – SBA (2012, Rek.: Masato und Masaaki Suzuki) – PB (1996, Rek.: Diethard Hellmann)
1. Chor + Choral: Singet dem Herrn ein neues Lied (Psalm 149,1 und Psalm 150,4 und 6) / Herr Gott, dich loben wir (M. Luther, Tedeum deutsch) Tutti – : D-Dur
2. Choral + Rezitativ: Herr Gott, dich loben wir (M. Luther, Tedeum deutsch) / Dass Du mit diesem neuen JahrA, T, B, Str, Bc – : h-mixolydisch A-Dur
3. Arie: Lobe, Zion, deinen Gott mit FreudenA, Str, Bc – : A-Dur
4. Rezitativ: Es wünsche sich die Welt B, Bc – : fis-Moll A-Dur
5. Arie (Duett): Jesus soll mein alles seinT, B, Obda o Vl solo, Bc – : D-Dur
6. Rezitativ: Nun, Jesus gebe, dass mit dem neuen JahrT, Str, Bc – : h-Moll A-Dur
7. Choral: Lass uns das Jahr vollbringen (J. Herman, Jesu, nun sei gepreiset, Str. 2) Tutti – : D-Dur
„Jesu, nun sei gepreiset“ BWV 41 BC A 22
Entstanden in Leipzig, zum 1. Januar 1725 (Jahrgang II). – Satz 6 (transp.) übernommen in BWV 171/6 ( →).
Text: Johann Herman, Jesu, nun sei gepreiset (1591), Str. 1 und 3 (Satz 1 und 6); Str. 2 (Satz 2–5) Umdichtung eines unbekannten Verfassers.
Besetzung: SATB, 3 Tr, Timp, 3 Ob, 2 Vl, Va, Vcpic, Bc
NBA I/4 (1965) – SBA (2010)
1. Choral (figuriert): Jesu, nun sei gepreisetSATB, 3 Tr, Timp, 3 Ob, Str, Bc – | | : C-Dur
2. Arie: Lass uns, o höchster Gott, das Jahr vollbringen S, 3 Ob, Bc – : G-Dur
3. Rezitativ: Ach! deine Hand, dein Segen A, Bc – : a-Moll e-Moll
4. Arie: Woferne du den edlen FriedenT, Vcpic solo, Bc – : a-Moll
5. Rezitativ + Choral: Doch weil der Feind bei Tag und Nacht / Den Satan unter unsre Füße treten (M. Luther, Litanei deutsch)B + SATB (c.f.), Bc – : C-Dur
6. Choral: Dein ist allein die EhreSATB, 3 Tr, Timp, 3 Ob, Str, Bc – | | : C-Dur
„Herr Gott, dich loben wir“ BWV 16 BC A 23
Entstanden in Leipzig, zum 1. Januar 1726 (Jahrgang III)
Text: Georg Christian Lehms (Lehms 1711), ohne Satz 6
Besetzung: SATB, Corca, 2 Ob (auch Obca), 2 Vl, Va, Bc – Wiederaufführung 1731: Satz 5 mit Violetta statt Obca.
NBA I/4 (1965) – SBA (2006)
1. Choral (figuriert): Herr Gott, dich loben wir (M. Luther, Tedeum deutsch, Zeilen 1–4) Tutti – : a-Moll G-Dur
2. Rezitativ: So stimmen wir bei dieser frohen ZeitB, Bc – : C-Dur G-Dur
3. Chor + Arie: Lasst uns jauchzen, lasst uns freuen / Krönt und segnet seine Hand B + SATB, Corca, Str + 2 Ob unis, Bc – : C-Dur
4. Rezitativ: Ach treuer HortA, Bc – : e-Moll C-Dur
5. Arie: Geliebter Jesu, du alleinT, Obca (Violetta), Bc – : F-Dur
6. Choral: All solch dein Güt wir preisen (P. Eber, Helft mir Gotts Güte preisen, Str. 6)Tutti – : a-Moll
„Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm“ BWV 171 BC A 24
Entstanden in Leipzig, zum 1. Januar 1729 (Picander-Jahrgang). – Satz 4 entstammt BWV 205.1/9 ( →), und Satz 6 (transp.) BWV 41/6 ( →). Satz 1 übernommen in die Messe h-Moll BWV 232.4II/2 ( →).
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander 1728)
Besetzung: SATB, 3 Tr, 2 Ob, Timp, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/4 (1965) – SBA (1999/2015)
1. Chor: Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm (Psalm 48,11)Tutti – : D-Dur
2. Arie: Herr, so weit die Wolken gehenT, 2 Vl, Bc – : A-Dur
3. Rezitativ: Du süßer Jesus-Name duA, Bc – : fis-Moll D-Dur
4. Arie: Jesus soll mein erstes WortS, Vl solo, Bc – : D-Dur
5. Rezitativ: Und da du, Herr, gesagtB, 2 Ob, Bc – | | : G-Dur h-Moll
6. Choral: Lass uns das Jahr vollbringen (J. Herman, Jesu, nun sei gepreiset, Str. 2)Tutti – | | : D-Dur
Weihnachts-Oratorium (Teil IV) BWV 248 ( →)
Sonntag nach Neujahr
Epistel: 1. Petrus 4,12–19; Evangelium: Matthäus 2,13–23 (Flucht nach Ägypten)
„Schau, lieber Gott, wie meine Feind“ BWV 153 BC A 25
Entstanden in Leipzig, zum 2. Januar 1724 (Jahrgang I)
Text: Verfasser unbekannt
Besetzung: SATB, 2 Vl, Va, Bc
NBA I/4 (1965) – SBA (2017)
1. Choral: Schau, lieber Gott, wie meine Feind (D. Denicke, Str. 1; Mel. Ach Gott, vom Himmel sieh darein)Tutti – : phrygisch