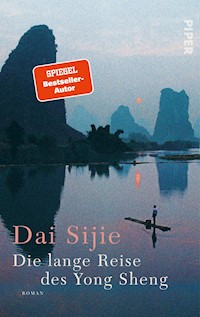9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Zwei pfiffige chinesische Studenten, die zur »kulturellen Umerziehung« in ein abgelegenes Bergdorf ans Ende der Welt verschickt wurden, merken bald, dass sie nur eine einzige Möglichkeit haben zu überleben: Sie müssen in den Besitz jenes wunderbaren Lederkoffers gelangen, der die – verbotenen – Meisterwerke der westlichen Weltliteratur enthält. Denn nur mit ihnen können sie den Widrigkeiten ihres Daseins entkommen – und vielleicht am Ende das Herz der Kleinen Schneiderin gewinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Aus dem Französischen von Giò Waeckerlin Induni
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe22. Auflage Januar 2010
© Éitions Gallimard, Paris 2000 Titel der franzöchen Originalausgabe: »Balzac et la petite tailleuse chinoise« © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2001 Umschlag: semper smile, München Umschlagabbildung: Karen Beard/ Getty Images Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck ISBN 978-3-492-95048-0
1. KAPITEL
Der Laoban saß mit untergeschlagenen Beinen neben der Erdfeuerstelle und inspizierte im Schein der glimmenden Kohle meine Geige. Es war der einzige Gegenstand im Gepäck der »zwei Grünschnäbel« aus der Stadt – damit waren Luo und ich gemeint –, der etwas Fremdländisches, den Geruch von Zivilisation an sich hatte, was natürlich gleich den Verdacht des Laoban, des Dorfvorstehers, erregt hatte. Ein Bauer brachte eine Petroleumlampe, um die Identifikation des Gegenstandes zu erleichtern.
»Ho-ho, was haben wir denn da.« Der Laoban hielt die Geige senkrecht hoch, um wie ein pingeliger Zollbeamter, der nach Drogen sucht, mißtrauisch durch das Schalloch in den dunklen Resonanzkasten zu spähen. Ich bemerkte drei kirschrote Blutstropfen in seinem linken Auge: zwei kleine und einen größeren.
Er hielt die Geige vor die Augen, schüttelte sie kräftig, offenbar felsenfest überzeugt, daß etwas herausfallen mußte. Ich fürchtete, daß die Saiten gleich reißen und die Wirbel in alle Richtungen davonfliegen würden.
Das Dorf war fast vollzählig vor dem etwas abseits stehenden Haus versammelt. Männer, Frauen und Kinder umringten uns neugierig, hingen in Trauben an der Stiege, streckten die Köpfe aus dem Fenster. Aus meinem Instrument fiel jedoch nichts. Also hielt der Laoban schnüffelnd die Nase ans geheimnisvolle Schalloch; die paar langen, dicken, popeligen Haare in seinen Nasenlöchern zitterten.
Nichts. Keinerlei Indizien.
Er fuhr mit seinem schwieligen Zeigefinger über eine Saite, über eine zweite Saite … entlockte ihnen einen fremdartigen Ton, der die Menge andächtig erstarren ließ.
»Es handelt sich um ein Spielzeug«, erklärte der Laoban feierlich.
Seine Schlußfolgerung verschlug uns die Sprache. Wir blickten uns kurz an. Ich fragte mich besorgt, wie das Ganze noch enden würde.
Ein Bauer nahm dem Laoban das »Spielzeug« aus den Händen, hämmerte mit der Faust auf dem Boden des Instruments herum, reichte es dann an seinen Nachbar weiter, und meine Geige ging von Hand zu Hand. Niemand kümmerte sich um uns, die zwei lächerlichen Hänflinge aus der Stadt. Wir waren den ganzen Tag durch Berg und Tal marschiert, unsere Kleider, unsere Gesichter, unsere Haare starrten vor Schmutz. Wir konnten uns kaum mehr auf den Beinen halten. Wir sahen aus wie zwei jämmerliche reaktionäre Soldaten aus einem Propagandafilm, die nach einer verlorenen Schlacht von einer Heerschar kommunistischer Soldaten gefangengenommen worden waren.
»Ein kindisches Spielzeug«, kreischte eine Frau.
»Nein«, berichtigte der Laoban, »ein typisch bourgeoises Spielzeug aus der Stadt.«
Mich fröstelte trotz des flackernden Feuers in der Mitte des festgetrampelten Hofes. »Es muß verbrannt werden«, hörte ich den Laoban sagen.
Sein Befehl löste auf der Stelle heftige Reaktionen aus. Alle redeten wild durcheinander, schrien, drängten sich nach vorn; jeder versuchte, sich des »bourgeoisen Spielzeugs« zu bemächtigen, um es eigenhändig ins Feuer zu werfen.
»Laoban«, sagte unerwartet Luo freundlich lächelnd, »das ist ein Musikinstrument. Mein Freund ist ein guter Musikant, ehrlich.« Die Menge verstummte. Der Laoban griff nach der Geige, inspizierte sie nochmals gründlich von allen Seiten und hielt sie mir dann hin.
»Tut mir leid, Laoban«, sagte ich verlegen, »ich spiele nicht besonders gut.« In dem Moment sah ich, daß Luo mir zuzwinkerte. Ich nahm also die Geige und begann sie zu stimmen.
»Mein Freund wird eine Sonate von Mozart spielen«, verkündete Luo gelassen. Ich fragte mich erschrocken, ob er vielleicht übergeschnappt war. Seit ein paar Jahren waren in China sämtliche Werke Mozarts oder sonst eines westlichen Komponisten verboten. Meine durchnäßten Füße in den aufgeweichten Schuhen fühlten sich wie Eisklumpen an. Ich bibberte vor Kälte.
»Eine Sonate? Was ist das?« fragte mich der Laoban mißtrauisch.
»Nun … also … wie soll ich Ihnen das erklären«, stammelte ich.
»Ein Lied?«
»Etwas in der Art …«, antwortete ich ausweichend.
Auf der Stelle flackerte die Wachsamkeit eines echten Kommunisten in den Augen des Laoban auf, und seine Stimme verhieß nichts Gutes: »Und wie nennt sich dieses Lied?«
»Also … es hört sich an wie ein Lied, aber es ist eine Sonate.«
»Ich hab dich gefragt, wie es heißt!« brüllte er mich an. Ich konnte den Blick nicht von den drei gruseligen Blutstropfen in seinem Auge wenden.
»Mozart …«, antwortete ich zögernd.
»Mozart was?«
»… Mozart ist mit seinen Gedanken immer beim Großen Vorsitzenden Mao«, kam mir Luo zu Hilfe.
Mir stockte der Atem. Doch Luos kühne Erklärung wirkte Wunder: Die Gesichtszüge des Laoban entspannten sich. Er kniff die Augen zusammen, und sein Mund verzog sich zu einem breiten, seligen Lächeln. »Mozart ist mit seinen Gedanken immer beim Großen Vorsitzenden Mao«, wiederholte er andächtig.
»Ja, immer, Tag und Nacht«, bekräftigte Luo.
Als ich die Saiten meines Bogens spannte, begann die Menge aufmunternd in die Hände zu klatschen, was mich jedoch nur noch mehr einschüchterte. Meine klammen Finger fuhren über die Saiten – und Mozarts vertraute Sätze stiegen in meiner Erinnerung auf. Die eben noch harten Gesichter der Bauern weichten bei Mozarts klarem Jubel auf wie die vom Regen durchnäßte Erde; dann verschmolzen ihre Umrisse im tanzenden Licht der Petroleumlampe nach und nach mit der Dunkelheit.
Ich spielte eine ganze Weile, während Luo sich ruhig eine Zigarette ansteckte wie ein richtiger Mann.
Das war unser erster Umerziehungstag. Luo war achtzehn, ich siebzehn.
Ein paar Worte zur Umerziehung. Ende 1967 startete Mao, der Große Steuermann, eine Kampagne, die das kommunistische China zutiefst verändern sollte: Die Universitäten wurden geschlossen, und die »jungen Intellektuellen«, das heißt die Gymnasiasten und die Absolventen höherer Schulen, wurden zur »Umerziehung durch die revolutionären Bauern« aufs Land geschickt. (Ein paar Jahre später würde dieses in der Geschichte beispiellose Experiment einen anderen asiatischen Revolutionär zur Nachahmung anspornen, einen Kambodschaner, der, ehrgeiziger und noch radikaler, die ganze Bevölkerung der Hauptstadt, ob alt oder jung, »aufs Land« schickte.)
Was Mao Zedong mit seiner Entscheidung wirklich bezweckte, war unklar. Wollte er mit den Roten Garden aufräumen, die langsam seiner Kontrolle entglitten? Oder handelte es sich um die Laune eines großen revolutionären Träumers, der seinen Traum, den »neuen Menschen« zu schaffen, verwirklichen wollte? Niemand würde je eine Antwort auf diese Frage geben. Wenn uns niemand hörte, diskutierten Luo und ich oft über dieses Thema. Und kamen zum Schluß, daß Mao die Intellektuellen haßte.
Wir waren weder die ersten noch die letzten Versuchskaninchen dieses gewaltigen menschlichen Experiments. Anfang des Jahres 1971 langten wir also in jenem Bergdorf am Ende der Welt an, bekamen ein Pfahlhaus am Rande des Dorfes zugewiesen, und ich spielte vor dem Laoban Geige. Es hätte uns schlimmer ergehen können. Millionen junger Menschen waren uns vorangegangen, und Millionen würden uns folgen. Bloß – Ironie des Schicksals –, weder Luo noch ich waren Gymnasiasten. Wir hatten nie das Glück gehabt, die Schulbank eines Gymnasiums zu drücken. Als wir in die Berge geschickt wurden, hatten wir lediglich die drei Oberschuljahre absolviert.
Luo und mich als »Intellektuelle« zu bezeichnen grenzte an Hochstapelei, und dies um so mehr, als die in der Oberschule erworbenen Kenntnisse gleich Null waren. Zwischen dem zwölften und dem vierzehnten Altersjahr hatten wir warten müssen, bis sich die Kulturrevolution beruhigte und unsere Schule wieder geöffnet wurde. Als es endlich so weit war, wurden wir bitter enttäuscht. Das Fach Mathematik war abgeschafft worden wie auch der Unterricht in Physik und Chemie, die »Grundkenntnisse« beschränkten sich von nun an auf Industrie- und Landwirtschaftskunde. Auf den Einbänden der Schulbücher war ein Arbeiter mit einer Schirmmütze abgebildet, der, mit Bizeps so dick wie die von Silvester Stallone, einen riesigen Hammer schwang. Neben ihm stand eine als Bäuerin verkleidete Kommunistin mit einem roten Tuch um den Kopf (»eine um den Kopf gewickelte Monatsbinde«, frotzelten unsere Mitschüler grinsend). Diese Schulbücher und Maos »Rotes Buch« waren jahrelang unsere einzige intellektuelle Nahrung. Sämtliche anderen Bücher waren verboten.
Daß man uns den Übertritt ins Gymnasium verwehrte und uns die Rolle junger Intellektueller aufbürdete, verdankten wir unseren Eltern, die – obwohl unterschiedlich schwerer Verbrechen angeklagt – als Volksfeinde eingestuft worden waren.
Meine Eltern waren Ärzte. Mein Vater war Lungenfacharzt, meine Mutter Fachärztin für parasitäre Krankheiten. Sie arbeiteten beide im Krankenhaus von Chengdu, der Hauptstadt von Sichuan, einer Stadt mit rund vier Millionen Einwohnern, die sehr weit von Peking entfernt ist, aber sehr nahe an Tibet.
Luos Vater war im Vergleich zu meinem Vater eine richtige Koryphäe, ein in ganz China berühmter Zahnarzt. Er hatte einmal – vor der Kulturrevolution – seinen Studenten erzählt, er hätte Mao Zedongs Zähne in Ordnung gebracht und auch die von Frau Mao und von Chiang Kai-shek, dem Staatspräsidenten der abtrünnigen »Republik«. Offen gestanden: nach jahrelanger täglicher Betrachtung von Maos Porträt hatten schon viele festgestellt, daß seine Zähne sehr gelb, ja geradezu unappetitlich waren, doch niemand hätte sich getraut, das zu sagen. Und nun kam ein berühmter Zahnarzt daher und deutete dreist in aller Öffentlichkeit an, der Große Steuermann der Nation trage ein Gebiß, was eine nicht zu übertreffende Majestätsbeleidigung war, ein hirnrissiges, ein unverzeihliches Verbrechen, schlimmer als die Preisgabe eines Staatsgeheimnisses. Unseligerweise hatte er es gewagt, die Namen des Ehepaars Mao in einem Atemzug mit dem der größten Kanaille zu nennen: Chiang Kaishek! Was das Strafmaß erheblich erhöhte.
Luos Familie hatte jahrelang gleich neben uns gewohnt, Tür an Tür im dritten und obersten Stockwerk eines Backsteingebäudes. Er war der fünfte Sohn seines Vaters und das einzige Kind seiner Mutter.
Ich übertreibe nicht: Luo war der beste Freund, den ich in meinem Leben gehabt habe. Wir wuchsen zusammen auf und machten gemeinsam einiges durch. Wir stritten uns selten.
Ich werde die einzige Rauferei zwischen uns nie vergessen – oder vielmehr den Tag, als er mir eine Ohrfeige gab. Es war im Sommer 1967. Er war kaum fünfzehn, ich kaum vierzehn. Auf dem Basketballfeld des Krankenhauses, in dem meine Eltern arbeiteten, fand an jenem Nachmittag eine große politische Versammlung statt. Wir wußten beide, daß diese Versammlung Luos Vater galt und daß man ihn öffentlich seiner Verbrechen anklagen würde. Als gegen fünf Uhr immer noch niemand nach Hause gekommen war, bat mich Luo, ihn zu begleiten. »Wir werden uns die Kerle merken, die meinen Vater erniedrigen und foltern«, sagte er, »und wenn wir älter sind, rächen wir ihn.«
Auf dem brechend vollen Basketballfeld wogte ein Meer von schwarzen Köpfen. Es war unerträglich heiß. Der Lautsprecher brüllte. Luos Vater kniete auf einem Podest. Eine große, schwere, mit einem Draht um seinen Hals befestigte Zementtafel hing auf seinem Rücken; der Draht hatte sich tief ins Fleisch eingeschnitten. Auf der Tafel standen sein Name und sein Verbrechen:
Reaktionär!
Selbst aus der Entfernung von dreißig Metern glaubte ich, auf dem Podest unter dem Kopf von Luos Vater einen dunklen Schweißfleck zu erkennen. Eine drohende Männerstimme brüllte aus dem Lautsprecher: »Gib zu, daß du mit dieser Krankenschwester geschlafen hast.«
Luos Vater senkte den Kopf noch tiefer, so tief, daß es aussah, als drücke ihn die schwere Tafel zu Boden. Ein Mann hielt ihm ein Mikrophon vor den Mund, und man hörte ein zitterndes, gehauchtes »Ja!«.
»Wie ist es dazu gekommen?« brüllte der Richter. »Hast du dich an sie herangemacht? Oder war sie es?«
»Ich war’s.«
»Und dann?«
Sekundenlanges Schweigen. Dann echote die Menge wie aus einem Mund: »Und dann?« Der von zweitausend Menschen aufgenommene Schrei hallte wie ein Donnerschlag und rollte grollend über unsere Köpfe hinweg.
»Ich hab sie angefaßt …«, flüsterte der Angeschuldigte.
»Weiter! Einzelheiten!«
»Doch kaum habe ich sie berührt«, gestand Luos Vater, »ist es um mich herum … neblig geworden.«
Das entfesselte Gebrülle der fanatischen Richter schwoll erneut an. »Komm, gehn wir«, flüsterte Luo mir zu. Und wir entfernten uns. Unterwegs spürte ich plötzlich Tränen über mein Gesicht rinnen und mir wurde bewußt, wie sehr ich unseren alten Nachbarn, den Zahnarzt, mochte.
Und in dem Moment ohrfeigte mich Luo wortlos. Der Schlag kam so unerwartet, daß ich beinahe das Gleichgewicht verlor.
Zu jener Zeit, 1971, waren der Sohn des Lungenfacharztes und sein Freund, der Sohn des berühmten Volksfeindes, der die hohe Gunst erfahren hatte, Maos Zähne berühren zu dürfen, bloß zwei »junge Intellektuelle« unter den Hunderten von Jungen und Mädchen, die auf den Phönix-des-Himmels genannten Berg geschickt wurden. Ein poetischer Name. Und ein eindrückliches Bild, das die schwindelerregende Höhe erahnen ließ: Die armen Sperlinge und sonstigen Vögel der Ebene würden sich niemals bis zum Gipfel des Berges aufschwingen können; nur einem einzigen Vogel war es gegeben, einem allmächtigen, sagenumwobenen und zutiefst einsamen.
Es führte keine Straße auf den Berg des Phönix-des-Himmels, bloß ein schmaler Pfad, der sich zwischen den Felsmassen, den steil abfallenden Wänden, den Kuppen und Kämmen, den wildesten Gesteinsformationen hinaufschlängelte. Um den Schatten eines Autos zu erspähen, eine Autohupe zu hören, ein Zeichen von Zivilisation zu sehen oder den Duft einer Garküche zu schnuppern, mußte man zwei Tage über Berg und Tal marschieren. Etwa hundert Kilometer entfernt lag die kleine Kreisstadt Yong Jing am Ufer des Flusses Ya; es war die nächstgelegene Stadt. Der einzige Weiße, der je seinen Fuß dorthin gesetzt hatte, war Pater Michel, ein französischer Missionar, der in den vierziger Jahren eine neue Route suchte, um nach Tibet zu gelangen.
»Der Distrikt Yong Jing ist nicht reizlos, vor allem seines Gebirges wegen, das man Phönix-des-Himmels nennt«, hielt der Jesuit in seinem Reisetagebuch fest. »Der Berg ist für sein Kupfergold berühmt, das früher für die Herstellung von Münzen verwendet wurde. Im 1.Jahrhundert, erzählt man, schenkte ein Kaiser der Han-Dynastie diesen Berg seinem Konkubinen, einem Obereunuchen aus seinem Hofstaat. Als ich den Blick über die schwindelerregenden Felsen schweifen ließ, erblickte ich einen schmalen Pfad, der sich zwischen den dunklen Kaminen in den überhängenden Felsen hochzog und sich in den tiefhängenden Wolken aufzulösen schien. Ein paar wie Saumtiere beladene Kulis stiegen den Pfad hinunter. Riesige, mit Berggold gefüllte Bambuskörbe waren mit Lederriemen auf ihren Rücken gebunden. Man sagte mir jedoch, die Kupfergewinnung sei wegen der schlechten Transportwege im Niedergang begriffen. Dank der besonderen Geographie dieses Berges sind die Bewohner jetzt zum Opiumanbau übergegangen. Man riet mir übrigens dringend davon ab, den Fuß in jene Gegend zu setzen: Die Opiumbauern sind allesamt bewaffnet. Nach der Ernte vertreiben sie sich die Zeit mit Überfällen. Ich begnügte mich also damit, die unwirtliche, vom satten Grün mächtiger Bäume und von üppiger Vegetation verdunkelte Gegend aus der Ferne zu betrachten: ein wahrlich geeigneter Ort für einen im Schatten der Bäume lauernden Banditen, um sich auf Reisende zu stürzen.«
Etwa zwanzig, in den Windungen des einzigen Pfades verstreute oder in den schattigen Wäldern versteckte Dörfer besiedelten den Phönix-des-Himmels. Gewöhnlich nahm jedes Dorf fünf oder sechs junge Städter auf. Unser Dorf aber, hoch oben unterhalb des Gipfels gelegen und überdies das ärmste, konnte nur zwei übernehmen: Luo und mich. Wir waren im Pfahlhaus am Dorfrand untergebracht worden, vor dem der Laoban meine Geige untersucht hatte. Das Gebäude gehörte zum Gemeinschaftsbesitz der Dorfbewohner und war nicht zu Wohnzwecken vorgesehen. Zu ebener Erde, im Koben zwischen den Pfählen, hauste eine dicke Sau, die ebenfalls zum Gemeinschaftsbesitz gehörte. Das Haus selber war aus alten, rohen, ungetünchten Brettern gebaut; es bestand aus einem einzigen Raum ohne Dachboden und wurde als Speicher für den Mais und den Reis und kaputte Gerätschaften benützt; überdies war es ein idealer Ort für heimliche Seitensprünge.
Wir verfügten in all den Jahren unserer Umerziehung über keinerlei Möbel, nicht einmal über einen Tisch oder Stühle, sondern lediglich über zwei Pritschen längs der Wand in einem kleinen, fensterlosen Verschlag.
Nichtsdestotrotz dauerte es nicht lange, und unser Haus wurde zum Mittelpunkt des Dorfes: Alle fanden sich bei uns ein, der Laoban mit den drei Blutstropfen im linken Auge mit eingeschlossen. Und dies dank einem anderen Phönix, einem winzig kleinen und eher irdischen, der meinem Freund Luo gehörte.
Es handelte sich nicht um einen richtigen Phönix, sondern um einen stolzen Hahn mit prächtigen, blaugrün schimmernden Schwanzfedern. Er senkte unter dem etwas trüben Glas ruckartig den Kopf, und während der Sekundenzeiger langsam um das Zifferblatt kreiste, pickte er ein imaginäres Reiskorn in einem imaginären Hühnerhof. Dann hob er den Kopf, sperrte den Schnabel auf und plusterte sich zufrieden und satt.
Luos Wecker mit dem sich – pick-pick-pick – im Sekundentakt bückenden Hahn hatte ein hübsches, sanftes Läutwerk und war kaum so groß wie ein Handballen, daher war das kleine Wunderding bei unserer Ankunft dem scharfen Blick des Laoban entgangen.
Im Dorf hatte es bis dahin weder Wecker noch Uhr, noch Turmuhr gegeben. Die Menschen hatten seit Generationen ihr Leben nach der aufgehenden und der untergehenden Sonne gerichtet.
Der Wecker übte fast religiöse Anziehungskraft auf die Dorfbewohner aus. Alle kamen vorbei, um ihn andächtig zu bestaunen, als sei unser Pfahlhaus ein Tempel. Jeden Morgen wiederholte sich das gleiche Ritual: Der Laoban ging feierlich vor unserem Haus auf und ab, seine Bambuspfeife paffend, die so lang war wie eine alte Flinte. Er ließ unseren Wecker nicht aus den Augen. Punkt neun Uhr stieß er einen schrillen, langgezogenen Pfiff aus: das Zeichen für jedermann, daß es Zeit war, aufs Feld zu gehen.
»An die Arbeit!« brüllte er durch die verwinkelten Gassen. »Lüpft euer Hinterteil, faule Bande! Worauf wartet ihr …«
Wenn wir zur Arbeit auf einem schmalen, steilen Pfad – so steil, daß es unmöglich war, eine Karre zu schieben – aufwärts, aufwärts, aufwärts bis zu den Wolken klettern mußten, waren weder Luo noch ich begeistert. Wovor uns am meisten grauste, war, Scheiße in eigens dafür vorgesehenen Holzeimern transportieren zu müssen. Die bis obenauf mit einer reichen Vielfalt menschlicher und tierischer Exkrementen gefüllten »Ruckeimer« wurden wie Rucksäcke auf den Buckel geladen und zu den Feldern in schwindelnder Höhe unterhalb des Gipfels geschleppt. Bei jedem Schritt hörte man direkt hinter den Ohren das Glucksen der mit Wasser vermischten Scheiße. Der eklige Inhalt schwappte unter dem Deckel über und lief einem den Rücken hinunter. Jeder Schritt konnte fatale Folgen haben, auf die ich lieber nicht näher eingehen möchte.
Eines frühen Morgens hatten wir beim Gedanken an die bereitstehenden »Ruckeimer« nicht die geringste Lust, aus den Federn zu kriechen. Als wir die Schritte des Laoban hörten, lagen wir noch im Bett. Es war fast neun Uhr, der Hahn pickte unerschütterlich sein Reiskorn, als Luo plötzlich einen genialen Einfall hatte: Er streckte den kleinen Finger aus und drehte die Uhrzeiger eine Stunde zurück. Und wir schliefen friedlich weiter. Was für eine Wohltat, ordentlich ausschlafen zu können, während der Laoban draußen, seine lange Bambuspfeife paffend, auf und ab ging. Luos fabelhafter Trick milderte unseren Groll gegenüber den ehemaligen Opiumbauern, die von der kommunistischen Regierung zu »revolutionären Bauern« bekehrt worden waren.
Nach jenem historischen Morgen änderten wir das morgendliche Wecken je nach Lust und Laune und unserer körperlichen Verfassung. Manchmal stellten wir den Wecker auch eine oder zwei Stunden vor, um früher Feierabend machen zu können. Was dazu führte, daß wir schließlich nicht mehr wußten, wie spät es wirklich war, und jegliches Zeitgefühl verloren.
Auf dem Berg des Phönix-des-Himmels regnete es die meiste Zeit; das heißt, es regnete gewöhnlich an zwei von drei Tagen. Gewitterregen oder Platzregen gab es selten. Es war ein hartnäckiger, andauernder Nieselregen: Regen, der nie aufzuhören schien. Die Umrisse der steilen Felsen um uns herum waren in dichten, gespenstischen Nebel gehüllt, und die irreale, verschwommene Landschaft vor dem Fenster unseres feuchten Pfahlhauses, in dem der Schimmel langsam alles überzog und uns jeden Tag enger umzingelte, machte uns schwermütig. Es war schlimmer, als in einer tiefen Höhle zu leben.
Luo konnte nachts oft nicht schlafen. Er stand dann auf, zündete die Petroleumlampe an und kroch im Halbdunkel unters Bett, um nach ein paar weggeworfenen Kippen zu suchen. Danach setzte er sich im Schneidersitz aufs Bett, legte die schimmligen Kippen auf ein Stück Papier (meistens ein kostbarer Brief von zu Hause) und trocknete sie an der Flamme der Petroleumlampe. Dann schüttelte er die Kippen und sammelte mit Uhrmacherpräzision die Tabakkrümel ein, um ja kein Bröselchen zu verlieren. Wenn er seine Zigarette fertig gedreht hatte, steckte er sie an und löschte die Lampe. Er rauchte auf seinem Bett sitzend, lauschte in der Dunkelheit der Stille der Nacht, in der nur das Grunzen der unter uns im Mist wühlenden Sau zu hören war.
Manchmal regnete es länger als üblich, und die Zigarettenknappheit verlängerte sich. Einmal weckte mich Luo mitten in der Nacht. »Ich finde nichts mehr zum Rauchen, weder unter dem Bett noch sonstwo.«
»Ja und?«
»Ich bin deprimiert«, sagte er. »Bitte spiel mir etwas auf der Geige vor.«
Also tat ich ihm den Gefallen und holte verschlafen meine Geige hervor. Während ich spielte, mußte ich plötzlich an unsere Eltern denken, an seine und an meine. Wenn der Lungenfacharzt oder der berühmte Zahnarzt uns in jener Nacht hätten sehen können, das flackernde Licht der Petroleumlampe, die zuckenden Schatten an der Wand unseres Pfahlhauses, wenn sie die vom Grunzen der Sau begleitete Geigenmelodie hätten hören können … Doch niemand hörte uns. Nicht einmal die Dorfbewohner. Der nächste Nachbar wohnte mindestens hundert Meter entfernt.
Draußen regnete es. Ausnahmsweise war es nicht der gewohnte Nieselregen, sondern ein prasselnder Regen, der über unseren Köpfen auf die Dachziegel hämmerte. Das Geräusch deprimierte ihn nur noch mehr. Unsere Situation war ausweglos: Wir waren dazu verdammt, unser ganzes Leben in der Umerziehung zu verbringen. Laut den offiziellen Parteizeitungen hatte ein Student aus einer normalen Familie, das heißt aus einer revolutionären Arbeiter- oder Intellektuellenfamilie, der sich gut aufführte, eine hundertprozentige Chance, seine Umerziehung innerhalb von zwei Jahren zu beenden und zu seiner Familie in der Stadt zurückkehren zu können. Doch für die Söhne und Töchter der als »Volksfeinde« eingestuften Familien war die Chance, nach Hause entlassen zu werden, gleich drei zu tausend. Vom mathematischen Standpunkt aus betrachtet, waren Luo und ich »abgehakt«. Blieb uns also nur die tröstliche Perspektive, auf dem Berg des Phönix-des-Himmels alt und glatzköpfig zu werden, im Pfahlhaus zu sterben und in ein grobes weißes Leichentuch gewickelt in die Welt der Ahnen einzugehen. Wir hatten allen Grund, trübselig, deprimiert, entmutigt zu sein, unfähig, die Augen zu schließen und zu schlafen.
In jener Nacht spielte ich zuerst ein Stück von Mozart, dann eines von Brahms und schließlich eine Beethoven-Sonate, doch selbst die schaffte es nicht, meinen Freund aufzuheitern.
»Versuch’s mit einem anderen Stück«, sagte er.
»Was möchtest du hören?«
»Etwas Fröhlicheres.«
Ich überlegte, suchte in meinem kargen musikalischen Repertoire, jedoch ohne Erfolg. Dafür begann Luo, ein Revolutionslied zu summen. »Wie findest du das?« fragte er mich.
»Hübsch.« Und ich stimmte mit meiner Geige in das Lied ein. Es war ein tibetisches Lied, dessen Worte die Chinesen geändert hatten, um eine Lobeshymne auf den Großen Vorsitzenden daraus zu machen. Die Melodie hatte jedoch ihre Lebensfreude bewahrt, ihre unbezwingbare Kraft. Die Adaption hatte es nicht geschafft, die Seele des Liedes zu verfälschen. Luo sprang erregt aus dem Bett und begann zu tanzen und sich im Kreis zu drehen, während dicke Regentropfen durch die Lücken im Ziegeldach sickerten.
»Drei zu tausend«, dachte ich. »Drei Promille. Es bleibt mir eine Chance von drei Promille, und die Chance unseres melancholischen, tanzenden Rauchers ist noch geringer. Eines Tages vielleicht, wenn ich fleißig auf meiner Geige übe, wird mich ein kleines lokales oder regionales Propagandakomitee für die Aufführung roter Concertos engagieren. Aber Luo kann nicht Geige spielen, er kann nicht einmal Basketball oder Fußball spielen. Er hält keinen einzigen Trumpf in Händen, um sich der unbarmherzigen Konkurrenz der ›drei Promille‹ zu stellen. Schlimmer noch, er kann nicht einmal davon träumen.«
Was Luo meisterhaft konnte, war Geschichten erzählen, eine amüsante Begabung, gewiß, doch leider eine, die nicht zählte und kaum zukunftsträchtig war. Wir waren nicht mehr in der Zeit von Tausendundeiner Nacht. In unseren modernen Gesellschaften, ob sozialistisch oder kapitalistisch, gab es den Beruf des Geschichtenerzählers nicht mehr.
Ende der Leseprobe