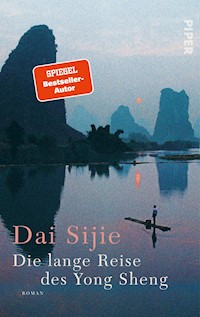
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine große Reise durch das China des letzten JahrhundertsEs ist das Jahr 1911. Zimmermann Yong, der die besten Taubenflöten im Bezirk Putian fertigt, wird ein Sohn geboren. Dem kleinen Yong steht ein außergewöhnliches Leben bevor. Mary, die Tochter des amerikanischen Pastors, in dessen Obhut er aufwächst, ermutigt ihn, der erste chinesische Pastor Putians zu werden. Und so beginnt für Yong eine Reise durch das ganze Land. Er studiert Theologie, erlebt Familienglück und Verrat, den Ausruf der Volksrepublik und die Gräuel der Kulturrevolution. Die Lebensreise eines Mannes auf der Suche nach Duldsamkeit und Demut, Liebe und Gerechtigkeit. Dai Sijie erzählt von seinem Großvater, der die großen Umbrüche im Reich der Mitte selbst miterlebte. Eine bewegende Geschichte von Liebe und Verrat, Demut und Glück, und davon, dem Leben mit Duldsamkeit zu begegnen. Der biografische Roman des Autors von »Balzac und die kleine chinesische Schneiderin« »Mit zarter Poesie erzählt, aberwitzig, tröstlich und geheimnisvoll zugleich.« Le Figaro Littéraire
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
Aus dem Französischen von Claudia Marquardt
Deutsche Erstausgabe
© Editions Gallimard, Paris 2019
Titel der französischen Originalausgabe: »L’Évangile selon Yong Sheng« bei Editions Gallimard, Paris 2019
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: Cornelia Niere
Coverabbildung: Dennis Cox / Alarmy Stock Photo
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1 – Mary
Kapitel 2 – Die Beschneidung
Kapitel 3 – Das Brandopfer
Kapitel 4 – Heling
Kapitel 5 – Das reinigende Wasser
Kapitel 6 – Der Taubenhüter
Kapitel 7 – Die theologische Fakultät
Kapitel 8 – Der Lange Marsch
Kapitel 9 – Helai
Zweiter Teil
Kapitel 1 – Vater sein
Kapitel 2 – Das Waisenhaus
Kapitel 3 – Die Arche Noah
Kapitel 4 – Das Leiden des Gottesknechts
Dritter Teil
Kapitel 1 – Die Rückkehr
Kapitel 2 – Die Ölmühle
Kapitel 3 – Der Einarmige
Kapitel 4 – Der Verrat
Kapitel 5 – Die Mühle in Aufruhr
Kapitel 6 – Die Zukunft eines Kindes
Vierter Teil
–
Das Ende
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Dieses Buch ist der Erinnerung an Pastor Dai Meitai gewidmet, meinen Großvater (1895–1973).
Prolog
Man kam, um sich den Sohn des Zimmermanns anzusehen.
Wie eine lange hellgraue Schlange wand sich der Weg in Serpentinen den leuchtend grünen Hang eines Hügels von Jiangkou im Bezirk Putian hinauf. Aus der Luft betrachtet ähnelte er einem offenen Riss in diesem Relief aus Kalksteinfelsen und sandigem Boden, in dem sich das Licht der Dämmerung brach. Jeden Augenblick, so sah es aus, musste man damit rechnen, in diesen engen Spalt zu stürzen, in den Tiefen einer anderen Zeit zu versinken, aber dann, endlich, richtete das Reptil seinen Kopf auf, wurde am Gipfel des Hügels zu Gestein, und in den Nebelschleiern zeichnete sich die Bleibe des Zimmermanns ab.
Unter einem Vordach, rechts des Hauses, das umgeben von Sägespänen war, fertigte Zimmermann Yong gerade eine seiner Taubenflöten, die die Züchter ihren Vögeln ins Gefieder banden. In einen kleinen Flaschenkürbis, den er zuvor ausgehöhlt hatte und der als Klangkörper diente, schob er ein feines, scharfes Rohrblatt aus Bambus, strich behutsam mit den Fingern über dessen Rand, der mit einem Beitel bearbeitet war und in den Strahlen der untergehenden Sonne blutrot schimmerte.
In diesem Moment trat die blinde alte Frau auf ihn zu, die mit fachkundiger Hand seinen zweijährigen Sohn untersuchen sollte. In der Mitte des Hofs hatte man einen Holztisch aufgestellt. Der kleine Junge tappte vorsichtig heran, er steckte in einem roten Seidenhöschen, das seine intimen Körperregionen bedeckte und ihm bis zur Brust reichte. Besorgt sah er nach rechts und nach links, hielt Ausschau wie ein Seefahrer, der unbekanntes Terrain betritt.
Die Blinde war winzig und trug einen langen grauen Rock, dazu ein scharlachrotes, trägerloses Oberteil, das mit violetten Blumen bestickt war, und einen roten Schal, den sie sich um den Hals geschlungen hatte. Oben auf ihrem Kopf saß ein strenger Haarknoten. Mit wiegendem Schritt, den ihre kleinen gebundenen Füße ihr vorgaben, näherte sie sich dem Tisch.
Mit ihrer knochigen Hand tippte sie auf eins der roten Filzschühchen des Kindes und kraulte mit den langen Nägeln der anderen, deren Finger so mager wie Vogelkrallen wirkten, seinen Schädel, der kahl rasiert war bis auf ein pfirsichgroßes Haarbüschel, das aussah wie eine dunkle Düne.
Dann nestelte sie am Unterleib des Kindes, hob schließlich den Kopf und rief:
»Es gibt ein Problem. Ihm fehlt ein Hoden. Der andere scheint aber, soweit ich es ertasten konnte, in Ordnung zu sein. Also ist einer genug.«
»Nur ein Hoden?«, erkundigte sich der Zimmermann entsetzt. »Wie soll er da jemals Kinder zeugen?«
»Einer reicht, um Ihre Nachfolge zu sichern.«
»Ach, wenn das so ist …« Der Zimmermann entspannte sich ein wenig.
»Keine Sorge. Wenn ich hierhin fasse, spüre ich deutlich, dass sein Vögelchen putzmunter ist.«
Zimmermann Yong seufzte erleichtert. Er stellte ein langes Bambusrohr im Hof auf, spaltete es mit seinem Messer, kniff die Augen zusammen und besah sich das Mark. Im Schein der Abendsonne glänzte der Stock wie eine schmelzende Goldstange.
Er führte die Blinde zu einem Strauch vor dem Haus. Zwei Jahre zuvor, im Frühjahr 1911, als sein Sohn gerade geboren war, hatte der Zimmermann einem chinesischen Pilger aus Vietnam, der zur Insel Meizhou unterwegs war, um der Göttin Mazu zu huldigen, einen Platz an seinem Tisch angeboten. Bevor der Mann weiterzog, wollte er seinem Gastgeber etwas Geld dalassen, und als dieser höflich ablehnte, überließ er ihm zum Dank einen Beutel mit Samenkörnern. Der Zimmermann hatte daraufhin ein Loch vor seinem Haus gegraben, die Körner hineingestreut und es mit Schlick wieder aufgefüllt. Nach einer Woche war der Schlick zwar getrocknet, doch es zeigte sich nicht der kleinste Trieb an der Oberfläche. Noch erstaunlicher war, dass die im Jahr zuvor ringsum gesetzten Pflanzen und Blumen, die bereits Knospen trugen, plötzlich verdorrten. Die Iris warfen ihre Kelchblätter ab, und ihre kleinen gelben Blüten verwelkten, noch ehe sie richtig aufgingen. Dasselbe Schicksal ereilte die Minze, die zwar in die Höhe geschossen war, aber auf einmal bitter schmeckte, und auch der Fenchel kümmerte vor sich hin. Dann, endlich, am zehnten Tag, durchstieß ein frischer grüner Trieb die Erde, ein erster Spross des einzigen exotischen Baums im Garten, dem es vergönnt war, unter der chinesischen Sonne zu gedeihen.
»Sagen Sie«, fragte Zimmermann Yong die Blinde, »kennen Sie den Namen dieses Baums? Er hat alles, was um ihn herum wuchs, vernichtet.«
Der Strauch war bereits einen Meter hoch. Die Alte ging in die Hocke, strich mit ihren Fingerspitzen über die Blätter, riss dann mit den Zähnen ein Stück Rinde heraus. Das Mark war frisch und zart und verströmte einen angenehm blumigen Duft.
»Es ist ein Aguilar«, sagte sie mit Bestimmtheit. »Ein Weihrauchbaum. Erzählen Sie bloß niemandem davon, es würde nur Neid und Missgunst erregen.«
»Warum?«
»Weil dieser Baum, sobald er größer ist, einen wertvollen Saft produziert. Ihr Sohn mag nur einen Hoden haben, aber wenn man Ihnen am Tag seiner Geburt Samenkerne des Aguilars geschenkt hat, ist ihm ein außergewöhnliches Schicksal beschieden.«
Die Spezialisten stimmten darin überein, dass die bemerkenswertesten Taubenflöten die der Marke Yong aus Putian waren. Was zweifellos daran lag, dass sie die Arbeit eines Zimmermanns waren, der sowohl über die geeigneten Werkzeuge als auch über eine immense Könnerschaft verfügte, denn nicht nur in der Herstellung von Taubenflöten hatte er sich einen Namen gemacht, er genoss darüber hinaus einen hervorragenden Ruf als Bautischler. Das Krankenhaus von Putian, die erste Einrichtung in der Provinz Fujian, die von protestantischen Missionaren gegründet wurde, und vor allem die große Treppe des Hauptgebäudes, die noch heute existiert, zeugten von Yongs außergewöhnlichem Talent. Damals waren die Handwerker in Putian – wie auch die in den meisten anderen chinesischen Städten – noch nie mit abendländischer Architektur in Berührung gekommen. Die Tischler und Zimmermeister, die chinesische Häuser bauten, hatten keine Ahnung, wie man einen Parkettboden, eine Zimmerdecke oder Glasfenster anfertigte. Geschweige denn etwas so Kompliziertes wie eine Treppe.
Zimmermann Yong hatte viele Stunden über der Zeichnung einer Treppe gebrütet, die ihm ein Fremder überlassen hatte, und eines Tages war der Groschen gefallen, er wusste plötzlich, wie er es anstellen musste.
Die Einweihung der ersten christlichen Kirche von Putian, an deren Fertigstellung er mitgewirkt hatte, war ein Ereignis, das die ganze Stadt bewegte. Das Krankenhaus befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Bau, trotzdem brüllten und drängten sich die Leute davor, um einer erstaunlichen Szene beizuwohnen: Vor aller Augen schwankte die Mutter von Zimmermann Yong mit leicht angehobenem Rock auf ihren gebundenen Füßen die Stufen einer Treppe hinauf. In den Gesichtern der Schaulustigen waren Angst und Verwirrung zu lesen. Sie hatte es bis nach oben geschafft, aber nun musste sie wieder herunter. Würde sie dabei ihr Leben lassen?
Der Kleine Yong war ebenfalls dabei. Sein Vater stellte ihn am Fuß der Treppe ab, und das Kind kraxelte auf Knien Stufe um Stufe empor, hielt nur ab und zu inne, um ein Detail der Ausführung zu bewundern. Vielleicht war dieser Tag der glücklichste seiner Kindheit. Oben angekommen, setzte sein Vater ihn rittlings aufs Geländer, ließ dann seine Hand los, lief zum unteren Ende der Treppe, um ihn dort aufzufangen: »Komm, mein Sohn, rutsch runter!«, rief er mit ausgebreiteten Armen. Der Kleine schloss die Augen und glitt, ohne sich festzuhalten, nach unten, ihm war, als würde er durch den Himmel fliegen. Er fühlte sich wie der Herr über die Geschwindigkeit, der Wind blies ihm um die Ohren, und er hörte den Gesang der Taubenflöten. Ein langer feiner Ton, der sich wie ein magisches Band durch die Luft zog, sich ihm näherte, schnell wie ein Blitz, und dann, ganz allmählich, in der Ferne wieder verhallte.
Drei Jahre waren seit der Konsultation der blinden Alten vergangen. Der Kleine Yong war kaum fünf, konnte jedoch bereits unterscheiden, und zwar beim ersten Ton, ob eine Taubenflöte aus der Werkstatt seines Vaters stammte oder nicht.
Die Flöten aus Putian und den benachbarten Ortschaften hatten in der Regel einen Durchmesser von höchstens zwei oder drei Zentimetern und etwa den Umfang einer Nuss (die größten erreichten immerhin bis zu zehn Zentimeter Durchmesser und waren faustgroß). Ein feines Rohrblatt, das in der Mitte der Flöte angebracht war, teilte sie in zwei Klangkörper. Man befestigte das Instrument an den Steuerfedern der Vögel, und wenn sie losflogen, entstanden, je nachdem, in welchem Winkel der Wind hineinblies, zwei verschiedene Töne, ein hoher und ein tiefer. Um die Klangpalette zu erweitern, konnte man nach Belieben unterschiedlich lange Bambusrohre hinzufügen (manche bevorzugten auch Schilfrohr). Zeigte sich dann eine Schar Tauben am Himmel, war es, als zöge ein ganzes Orchester vorbei, das ein beeindruckendes Konzert zum Besten gab. Jedes Instrument ertönte in einer anderen Stimmlage, Bariton, Tenor, Alt und Sopran antworteten einander in feinem Echo, überboten sich in lyrischen Tremolos und romantischen Vibratos, zur Freude des Publikums, das der Sinfonie lauschte.
In diesem Augenblick war die Musik, die am Himmel spielte, das Werk der Tauben von Pastor Gu, einem amerikanischen Evangelikalen, der aus den Vereinigten Staaten ein Paar weißer Tauben mitgebracht hatte, deren Füße, im Unterschied zu den chinesischen Tauben, mit seidenweichem Gefieder bedeckt waren (sie steckten in einer Art Muff, wie die Frauen ihn im Winter trugen, um ihre Hände vor der Kälte zu schützen). Der Pastor hatte just an diesem Tag zwei Yong-Flöten erworben und sie, in einem Moment wohltuender Muße, den er so noch nicht erlebt hatte, seit er in China war, höchstpersönlich mit Nadel und Faden am Schwanz seiner Vögel befestigt. Er war extra auf das Dach des im Auftrag seiner Kirche neu errichteten Krankenhauses gestiegen, um seine Tauben fliegen zu lassen. Von dort hatte er beobachtet, wie sie ihre Runden zogen, zwei Quarzkristalle, leicht und rein, wie sie sich an ihrer zauberhaften Serenade erfreuten, immer höher stiegen, bis sie zwei weit entfernten Sternen glichen und schließlich mit dem Himmel verschmolzen.
Ein wenig verloren harrte er auf dem Dach aus, noch völlig versunken in den Klang der fernen Flöten. Plötzlich aber tauchten die Tauben lautlos wieder auf und fielen wie Meteoriten vom Himmel. Ehe sie landeten, streiften sie das Gesicht des Pastors, schwangen sich dann mit raschelndem Flügelschlag wieder auf, um ihr himmlisches Ballett fortzuführen. Die Sonne umgab ihr schneeweißes Gefieder mit einem goldenen Schein, die Flöten sangen, das Herz von Pastor Gu schlug heftig, Tränen des Glücks liefen ihm über die Wangen. Niemand kannte den Wert dieser beiden Flöten, man wusste lediglich, dass die Mutter des Zimmermanns höchstpersönlich mit dem Pastor in Verhandlungen getreten war und dafür gesorgt hatte, dass er ihren Enkel bis zum Abschluss der Grundschule bei sich aufnehmen würde (die Ehefrau des Pastors hatte eine Schule eröffnet).
»Wie heißt Ihr Enkel?«, hatte der Pastor gefragt.
»Wir nennen ihn den Kleinen Yong, er hat keinen Vornamen, dafür ist er noch zu jung. Hätte er einen, würden ihn die Dämonen holen.«
»Wenn er in meiner Schule unterrichtet werden soll, muss er einen Namen haben.«
Nach einigem Überlegen willigte die Großmutter des Kleinen Yong ein:
»Gut. Dann suchen Sie einen für ihn aus, Sie sind schließlich Pastor.«
»Er soll Yong Sheng heißen. Sheng steht für Ton. Es ist eine Hommage an das Handwerk seines Vaters.«
Erster Teil
Kapitel 1 Mary
Es war zwei Uhr morgens, und es goss in Strömen.
Der Kleine Yong begriff nicht gleich, dass es regnete. Im ersten Augenblick glaubte er, das Geräusch der Holzsäge seines Vaters durch die Stille der Nacht zu hören, aber plötzlich erinnerte er sich, dass er ja gar nicht zu Hause in Jiangkou war, sondern in Hanjiang, bei der Frau von Pastor Gu, der Direktorin seiner Schule, oder genauer, er befand sich im Zimmer ihrer Tochter Mary, seiner Lehrerin, die ihm Rechnen, Schreiben, Lesen und Musik beibrachte.
Pastor Gu war verantwortlich für die amerikanischen Baptisten, die sich auf Mission in der Provinz Fujian aufhielten, und er hatte eine sehr tugendhafte Pastorentochter geheiratet (er selbst war Sohn eines Pastors, ein Amt, das die meisten Männer seiner Familie seit Generationen ausübten).
Da Yong Sheng der jüngste Zögling der Schule war, ließ Madame Gu ihn nicht mit den anderen Schülern im Schlafsaal übernachten, der im hintersten Trakt der Einrichtung lag. Anfangs wollte sie ihn bei sich unterbringen, dann aber fürchtete sie, dass seine Anwesenheit ihren Mann bei der Arbeit stören könnte, und so hatte sie ihn bei ihrer Tochter Mary einquartiert. Die Residenz des Pastors umfasste sieben Höfe, und Mary wohnte mit ihrer kleinen Tochter, die noch kein Jahr alt war, passenderweise im »Hof des kleinen Mädchens«. Ihre Wohnung bestand aus dem sogenannten Hauptzimmer (das im Westen als »Wohnzimmer« bekannt war), in dem sich das Familienleben abspielte, außerdem einem Arbeitszimmer, in dem Mary ihre Unterrichtsstunden vorbereitete, und einem Schlafzimmer, in dem ihr Bett und, gleich daneben, die Wiege ihrer Tochter aufgebaut waren, sodass sie die Kleine nachts ohne großen Aufwand stillen konnte. Gegenüber von Marys Bett stand ein weiteres, kleineres Bett für Yong Sheng, und zwischen beiden hing als Trennwand ein weißes Laken.
Vom Prasseln des Regens geweckt, stand der Junge auf, um zur Toilette zu gehen, und stellte fest, dass das Baby zwar friedlich schlief, Marys Bett jedoch leer war. Wo war sie nur?
Früher waren die Fenster im ganzen Gebäude mit Papier verhängt, wie es in China üblich war, erst seit Pastor Gu die Residenz gekauft hatte, gab es zweiflügelige Glasfenster, die in zwölf Felder unterteilt waren. Yong Sheng durchquerte das Hauptzimmer, leise tappte er auf nackten Füßen über den mit purpurroten Rosen und grünen Flechten verzierten Teppich. Der Boden unter diesem Teppich war nicht aus gestampfter Erde wie sonst in den chinesischen Häusern, sondern mit Parkett ausgelegt. So wie auch im christlichen Krankenhaus von Putian.
Mary war weder im Hauptzimmer noch in ihrem Büro zu finden.
Sie musste die Wohnung verlassen haben, und offenbar hatte es da noch nicht geregnet, denn ihre alten schwarzen Gummistiefel mit den rosafarbenen Flicken standen am Fuß ihres Betts. Der Kleine verspürte plötzlich den dringenden Wunsch, sie ihr zu bringen, obwohl ihn draußen Nässe und Dunkelheit erwarteten. Mit den Stiefeln in der Hand stieg er die Stufen hinunter, die in den Hof führten. Der Regen peitschte ihm ins Gesicht, gleichzeitig durchströmte ihn ein angenehmes Gefühl von Frische. Unzählige Tropfen trommelten gegen seine Haut, sie kamen ihm vor wie winzige Kristallperlen, die vom Himmel fielen und wieder zurücksprangen, als hingen sie an einem elastischen Band; mit Wasser gefüllte Perlen, die nie platzten, sondern kaum dass sie ihn berührt hatten, zurückschnellten, um dann erneut auf ihn niederzuprasseln.
Er war noch keine sechs Jahre alt und konnte die Größe des Anwesens von Pastor Gu nicht genau fassen. Als er wenige Wochen zuvor hier angekommen war, hatten ihn das riesige Grundstück, die imposante, bei aller Gleichförmigkeit doch geheimnisvolle Architektur und die dicken, meterhohen Mauern, die das Gelände umgaben, schier überwältigt. Er hatte den Kopf in den Nacken legen müssen, um von unten die Unkrautbüschel zu entdecken, die sich auf der Kante der Ziegelmauer im Wind wiegten und an den Wolken festzuklammern schienen.
Zwei umlaufende Gänge, die östliche und die westliche Galerie, führten an den Mauern entlang und umschlossen das Anwesen mit seinen sieben Höfen wie zwei riesige Arme. Zu Beginn jeder neuen Stunde schlug der Nachtwächter auf ein Holzbrett und schritt dort oben auf und ab. Der erste, ziemlich große Hof, »Der Hof der Tauben«, gehörte den Vögeln des Pastors. Im zweiten, dem »Hof der Ahnen«, hatte der Hausherr eine Baptistenkirche errichten lassen. Es folgten »Der Hof der Gäste«, »Der Hof des Pastors«, »Der Hof des kleinen Mädchens«, »Der Hof der Küchen« und schließlich der siebte und letzte Hof mit der von Madame Gu gegründeten Schule.
Einige Jahre später erstellte Yong Sheng eine genaue Skizze des Geländes: Mit Ausnahme des großen Eingangsportals, das im Verhältnis zur Hauptachse der Anlage leicht versetzt war (die Erbauer, ebenso naiv wie einfallsreich, glaubten, auf diese Weise den Dämonen Einhalt zu gebieten, schließlich war allgemein bekannt, dass diese sich nur in einer geraden Linie fortbewegten), hatte man die Zugänge der anderen sechs Höfe, ganz nach dem Vorbild der Kaiserstadt, parallel zueinander auf derselben Achse angeordnet. An den hohen christlichen Feiertagen befahl Pastor Gu seinen Bediensteten, sämtliche Pforten zu öffnen, damit die Gebete und Gesänge vom Hof der Ahnen ungehindert durch alle anderen Höfe hindurch bis zu dem Reisfeld hinter der Residenz dringen konnten. Im letzten Hof stand eine Steinmühle, an der sich ein kleiner Esel mit verbundenen Augen tagein, tagaus damit abmühte, Sojabohnen zu einer weißen Masse zu zermahlen, aus der man Tofu herstellte. An den Feiertagen jedoch nahm man dem Esel die Augenbinde ab und ließ ihn sich ausruhen. Und nur zu solchen Gelegenheiten konnte man die sieben Höfe auf einen Blick erfassen.
Auf nackten Sohlen lief Yong Sheng nun im strömenden Regen durch den Hof des kleinen Mädchens, er wollte über den Korridor des Nachtwächters zu den Unterrichtsräumen gelangen, aber er hatte kaum den Hof der Küchen erreicht, als er schon von Kopf bis Fuß durchnässt war. Wie ein begossenes kleines Huhn rannte er dennoch tapfer weiter bis in den Hof der Schule, wo Mary mehr Zeit verbrachte als in ihrer Wohnung.
Doch in dieser Nacht war sie nicht dort. Die Gebäudetrakte links und rechts der Pforte, in denen früher die Hausangestellten und inzwischen die Klassenzimmer untergebracht waren, lagen dunkel vor ihm. Auch in den ehemaligen Scheunen und Ställen, die heute als Schlafsäle dienten, waren alle Lichter gelöscht, das einzige Geräusch, das durch die Stille ging, war der Atem der Jungen, die dort schliefen.
Der Regen hämmerte gegen das Ausgangstor des letzten Hofs. Im Gegensatz zu dem großen Eingangsportal, dessen zwei Flügel in Angeln hingen und auf einem hohen Sockel saßen, hatte dieses Tor keine Schwelle. Es bestand aus mehreren grün gestrichenen großen Holzplanken, die wie Tischplatten übereinandergestapelt waren, und ließ sich, je nach Höhe der Karren, auf denen man die Lebensmittel für die Küche transportierte, entweder ganz oder nur teilweise öffnen. Yong Sheng drückte sein Gesicht gegen das Holz und sah durch einen Spalt auf das Reisfeld, wo er jedoch außer Wasserlachen nichts erkennen konnte.
Er machte kehrt, lief zum gegenüberliegenden Korridor, der sich wie eine Mondsichel an jedem Übergang zum nächsten Hof öffnete. Hof der Schule, Hof der Küchen, Hof des kleinen Mädchens, Hof des Pastors, Hof der Gäste … Yong Sheng rannte immer weiter, bis er das Tor zum Hof der Ahnen erreichte.
Die Pforte zu diesem Hof unterschied sich deutlich von den anderen, selbst das große Eingangsportal, so majestätisch es auch war, hatte nicht dieselbe erhabene Wirkung wie dieses, über dem sich ein zu den Seiten offener Wachturm erhob, der auf zwei dicken schwarzen Säulen ruhte. Der Regen rann in Sturzbächen über die breiten Dachziegel des Turms, die Blitze ließen seine Stützbalken wie helle Streifen aufleuchten, und in ihrem zuckenden Licht schienen die in Stein gehauenen Tierfiguren zum Leben zu erwachen.
Der Junge hielt einen Moment inne, trotz der dreckigen Pfützen, die sich unter seinen Füßen bildeten, und der lauwarmen Tropfen, die, so kam es ihm vor, sich durch seine dünne Haut bohren wollten.
An einem der breiten Stützbalken schaukelte eine Sturmlaterne, die im Regen zischte. Yong Sheng erschrak, denn er fürchtete, das Glas könne jeden Moment explodieren.
Die Schwelle des Tors war so hoch, dass der Junge darüber wie über eine Mauer klettern und sich auf die andere Seite fallen lassen musste. Danach hatte er keine Kraft mehr zu rennen, mit kleinen Schritten durchquerte er den Hof der Ahnen. Das Wasser ging ihm bis zu den Knöcheln, unter seinen Füßen spürte er die Ziegelsteine und die großen runden Kiesel, mit denen der Boden gepflastert war. Hier und da rutschte er auf dem Moos aus, das zwischen den Steinen wuchs, aber er achtete darauf, immer in einer geraden Linie zu laufen, um einer Katastrophe zu entgehen, denn er wusste, dass neben der Hauptachse ein befestigter Graben klaffte, der einen Meter breit, drei Meter lang und zwei Meter tief war, und dass das Wasser darin einem Erwachsenen bis an die Hüfte reichte.
Sonntags, nach dem Gottesdienst, stieg Pastor Gu ein Treppchen in dieses Becken hinab und begrüßte dort mit ein paar feierlichen Sätzen die neuen Mitglieder seiner Kirche, bevor er ihren Oberkörper ins Wasser tauchte. Der Kleine Yong hatte die Zeremonie schon ein paar Mal miterlebt, ohne zu wissen, dass es sich dabei um eine Taufe handelte, also einen symbolischen Akt, mit dem man sich von begangenen Sünden reinwusch. Immer wenn Pastor Gu einen Getauften wieder aus dem Wasser zog, hieß er ihn als neuen Menschen willkommen. Noch Jahre später erinnerte sich Yong Sheng an das strahlende Gesicht des Missionars am Ende dieses Rituals.
Vor der großen Halle im Hof der Ahnen leuchtete ein Licht, das den Schatten der verglasten Sprossentür auf den Steinboden des Innenraums warf. Das Schattenmuster dehnte sich zu den langen Holzbänken hin – um die jeden Sonntag die Kinder der versammelten Christen aus Putian herumtobten – und noch weiter, bis zu dem Rednerpult, von dem aus Pastor Gu seine Predigten hielt. Früher hatte an dieser Stelle ein großer Altar gestanden, an dem die ehemaligen Besitzer ihre Vorfahren verehrten. Jetzt wurde der Raum als Gebetsstätte genutzt, ein Vorhang teilte ihn in einen Bereich für Männer und einen für Frauen. Und wenn Pastor Gu von seinem Pult aus zu den Männern sprach, ragte er so weit über den Vorhang hinaus, dass die Frauen ihn nicht nur hören, sondern auch bis zu den Schultern sehen konnten.
Die Stiefel, die Yong Sheng immer noch in der Hand trug, hatten sich mit Regenwasser gefüllt, und als er den verlassenen Gebetsraum betrat, hallte ein plätscherndes Echo von den Wänden wider. Er hielt zu beiden Seiten des Vorhangs Ausschau nach Mary – nichts. Vom Dachgebälk tropfte es auf den Kopf des Jungen und auf die Bänke.
Plötzlich bemerkte er einen Lichtstrahl, der durch einen Riss in der Mauer fiel. Er trat näher und stieß unverhofft auf Marys geheime Kapelle.
Natürlich hatte er keine Ahnung, was eine Kapelle war. Selbst erwachsene, vor langer Zeit konvertierte Chinesen taten sich schwer mit der Unterscheidung von Protestantismus und Katholizismus, und sicher hätte niemand eine Antwort darauf gehabt, warum sich in einer Baptistenkirche eine katholische Kapelle verbarg. Jahrzehnte später brachte ein Freund Yong Sheng ein kleines Buch aus den USA mit, das die Frau von Pastor Gu 1928 unter dem Titel Meine Grundschule in Hanjiang veröffentlicht hatte und in dem der geheime Raum erwähnt wurde, den ausschließlich ihre Tochter nutzte, die zum Katholizismus übergetreten war. Mary war, bis sie nach Paris ging, um Kunstgeschichte an der Sorbonne zu studieren, eine glühende Protestantin gewesen, dort allerdings verliebte sie sich in einen ihrer Professoren, einen kultivierten jungen Mann, der aus einer erzkatholischen Familie stammte. Ihm zuliebe gab sie ihre eigene Konfession auf und nahm seine an, die Zeremonie fand in der Kirche seines Heimatdorfes statt. In ihrem Buch zitierte Madame Gu aus einem Roman der Schriftstellerin K. C. Carter, einer amerikanischen Freundin von Mary, die den Feierlichkeiten beigewohnt hatte:
Es war ein kleines französisches Dorf, das hauptsächlich von der Pflaumenverarbeitung lebte. Wir folgten einem verschlungenen, von Kastanienbäumen gesäumten Weg. Weiter unten stand eine Kirche aus Stein, bescheiden, aber hübsch, auf deren Vorplatz dienstags und freitags Markt war. Abends tauchten Laternen sie in ein sanftes Licht.
In einem Brief an eine Freundin gab K. C. Carter zu, dass sie von der Zeremonie geradezu entzückt gewesen sei: »Eine blütenreine Spitzendecke bedeckte den Altar, auf dem Kelche und Ziborien aus glänzendem Silber standen. Und daneben, zu beiden Seiten, Chorkinder in weißen Hemdchen und violetten Röcken.« Pastor Gu und seine Frau hingegen hatte das Ereignis in tiefe Verzweiflung gestürzt, so sehr, dass sie sich weigerten, nach Frankreich zu reisen, um der Hochzeit ihrer Tochter in ebendieser Dorfkirche beizuwohnen. Doch als in Europa der Erste Weltkrieg ausbrach und sein Schwiegersohn, den er nie kennengelernt hatte, an die Front geschickt wurde, besann Pastor Gu sich eines Besseren und lud seine einzige Tochter ein, mit ihrem Neugeborenen Zuflucht bei ihm in China zu suchen. »Gott beschert uns das Glück, Dich wieder bei uns zu haben«, schrieb er in seinem Brief.
In eine der Mauern des Gebetsraums war ein Alkoven aus behauenem Stein eingelassen, der von den Vorbesitzern der Residenz für einen dem Himmel und der Erde geweihten Altar gedacht war und den Pastor Gu in eine Kapelle für seine Tochter umgewandelt hatte. Die Öffnung hatte er mit einer Schiebetür versehen lassen, sodass, wenn sie geschlossen war, niemand die Existenz dieser Andachtsnische erahnte.
Vorsichtig bewegte Yong Sheng die Tür mit seiner kleinen Hand zur Seite, und sogleich fuhr ihm ein Schreck durch alle Glieder, denn im flackernden Schein einer Kerze tat sich vor seinen Augen die Gestalt eines fast vollständig entkleideten Mannes auf, der an ein Kreuz genagelt war und dem man eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt hatte. Der Mann hatte den Blick leicht abgewandt, aber seine Brauen und die Falten auf seiner Stirn drückten unendlichen Schmerz aus. Seine tief liegenden Augen und die Furche, die sich ihm vom Wangenknochen bis zum Kinn ins Gesicht gegraben hatte, gaben ihm etwas Strenges.
Verstört kniff Yong Sheng die Augen zu, und als er sie wieder öffnete, wurde ihm klar, dass das, was er für einen Menschen gehalten hatte, nur eine Holzfigur war, die irgendwann einmal mit einer Goldschicht verziert gewesen sein musste, ihren Glanz inzwischen aber eingebüßt hatte. Ihn beschlich das Gefühl, dass der Gekreuzigte den Blick auf ihn richtete, als wäre er gerade im Gespräch mit einer dritten Person unterbrochen worden. Außerdem schien er überrascht von der Tatsache, dass Yong Sheng Marys Stiefel in der Hand hielt, als handelte es sich nicht um alte, geflickte Gummistiefel, sondern um den Filzpantoffel von Aschenputtel – das Lieblingsmärchen seiner Lehrerin. Er rechnete fast damit, dass der Mann ihm befahl, vor Mitternacht zu Hause zu sein, wie man es auch Aschenputtel aufgetragen hatte, als sie vor der Kutsche stand (wobei er sich nicht mehr daran erinnerte, wer Aschenputtel den Befehl gegeben hatte). Mary behauptete, dass Aschenputtels Pantoffeln wie Diamanten glitzerten, so scharf seien wie Kristall und so zerbrechlich wie das Paradies, weshalb Yong Sheng nun fürchtete, dass der Mann am Kreuz wütend werden und sein kleines, ebenfalls sehr fragiles Paradies mit einem Schlag zunichtemachen könnte.
Und dann sah er Mary, sie stand versteckt im Halbschatten einer Mauer des feuchten Alkovens.
Ihr Hals war nackt, sie hatte den Blick gesenkt, die Lippen leicht geschürzt, sie schien wie in Trance. Als sie sich kurz regte, glitt ihr der violette Schal von den Schultern und entblößte eine üppige Brust, die im Kerzenlicht wirkte wie aus reinem Alabaster und von der eine sinnliche Wärme ausging.
Er beobachtete, wie Mary ihre Linke auf eine ihrer geschwollenen Brüste legte, sie andächtig massierte, bis ein Strahl Milch hervorspritzte. Yong Sheng verspürte plötzlich eine angenehme, duftende Wärme, die seinen aufgewühlten Körper wie eine zärtliche Berührung umfing.
Mit der freien Hand griff Mary nun nach einem silbernen Kelch, in den ihre Milch sich in einem cremigen Schwall ergoss, ein paar Spritzer perlten vom Rand des heiligen Gefäßes, so weiß, dass sie im Halbdunkel zu leuchten schienen. Mit halb geschlossenen Augen und leicht geöffnetem Mund, als träumte sie, saß Mary da und gab ein seltsames Geräusch von sich, es hörte sich an wie ein leises Stöhnen. Schließlich hob sie den Kelch (in dem die katholischen Priester normalerweise den Messwein weihen) und führte ihn an den Mund des Gekreuzigten. Milch floss über den Körper der Statue und drang durch die rissige Farbe tief in das Holz ein.
Der Mann hatte Yong Sheng nicht aus den Augen gelassen, der Junge meinte sogar, ein Zwinkern gesehen zu haben, während die Milch ihm über die hohlen Wangen lief.
Nachdem Mary verschwunden war, erfüllte der Duft ihrer Milch noch lange den Alkoven.
In dem Raum standen zwei Schränke, der auf der linken Seite hatte sieben Schubladen mit Kupfergriffen. Yong Sheng zog eine heraus, es war die, in der Mary den silbernen Kelch verstaut hatte. Sie hatte ihn zuvor gereinigt, vor seinen Augen, er glänzte unsagbar geheimnisvoll, als wollte er ihm ein Geheimnis offenbaren.
In dem Schrank rechts war die Holzfigur des Gekreuzigten aufbewahrt, sie schimmerte noch feucht. Aus der Nähe wirkte die Farbe weniger abgeblättert, das Holz glatter, und durch die Feuchtigkeit trat der goldbraune Ton kräftiger hervor, er glitzerte wie feines Gold auf dem Grund eines Flusses.
Ein elfenbeinfarbener Tropfen hing an der Dornenkrone wie eine reife Litschi an einem Ast, ein Tropfen Milch, der von seinem eigenen Gewicht in die Tiefe gezogen wurde. Für einen kurzen Augenblick sah es so aus, als zöge er sich zusammen, doch gleich darauf schwoll er wieder dick an. Yong Sheng öffnete seinen Mund und streckte die Zunge heraus.
Warm und feucht fiel der Tropfen herunter, und der Junge sog ihn in sich auf wie trockene Erde das lang ersehnte Wasser.
Nach dieser ersten seltsamen Begegnung mit dem Gekreuzigten verließ der Sohn des Zimmermanns die Gebetsstätte, lief über den Hof der Ahnen und fiel, aus Unachtsamkeit, in den Graben.
Der Regen hatte nachgelassen, und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dazu kam, war ich plötzlich unter Wasser. Ich hatte den Grund noch nicht berührt, aber mir war klar, dass ich mich in dem Becken befand, in dem der Pastor die Taufe vollzog.
Nach dem Wolkenbruch stand das Wasser höher als sonst und war seltsam lau. Als ich endlich Boden unter meinen nackten Füßen hatte, spürte ich den Schlamm, auch der war nicht kalt.
Ich wusste, dass ich sterben würde. Schon bald würde mir die Luft ausgehen. Doch auf einmal drang ein Lichtstrahl von der Oberfläche zu mir. War es Mary, meine Lehrerin, die mich suchte, mit einer Taschenlampe, deren wunderbares Licht Himmel und Erde erleuchtete? Dieser Gedanke verlieh mir Kraft, und mit einiger Anstrengung schaffte ich es, wieder aufzutauchen. Aber als ich versuchte, am Rand des Beckens Halt zu finden, zog es mich erneut in die Tiefe.
Mein Gott!, dachte ich. Ich verstand nun endlich, warum Pastor Gu ausgerechnet hier seine Zaubereien veranstaltete, denn der Grund dieses Grabens übte eine übernatürliche Anziehungskraft aus.
Während ich also ertrank, nahm ich das Geräusch einer Holzsäge wahr, sah ihre Zähne vor meinem geistigen Auge, wie sie sich unablässig durch die Wasseroberfläche arbeiteten, auf der kleine Blitze tanzten.
Das Geräusch der Säge war mir vertraut, überraschend war nur, dass nicht mein Vater sie in der Hand hielt!
Es gab übrigens immer zwei Sägewerker, einen, der oben, und einen, der unten stand. Der hier unten, auf dem Grund, das war ich. Den anderen konnte ich nicht genau erkennen. Ein bisschen ähnelte er der Figur des Gekreuzigten, aber ich war mir nicht sicher. Ich fragte ihn nach seinem Namen, und er antwortete: »Warum willst du meinen Namen wissen?« Dann wandte er sich mit den Worten »die Morgenröte ist aufgestiegen« zum Gehen. Ich umklammerte mit beiden Händen sein Bein, um ihn zurückzuhalten. »Wenn Sie mir Ihren Namen nicht verraten, werde ich Sie nicht gehen lassen.« Er wehrte sich nicht und sprach: »Ich bin der Vater des Gekreuzigten.« Im selben Augenblick erschien eine Leiter, die er mich hinaufklettern ließ, und während ich glaubte, nun in den Himmel zu gelangen, stieg ich zu meinem großen Erstaunen bloß aus dem Wasser.
Es war Mary, die ihn rettete. Als sie das Bett des Jungen bei ihrer Rückkehr leer vorgefunden hatte, war sie voller Sorge wieder zurückgelaufen, um ihn zu suchen. Im Hof der Ahnen waren ihr sofort die Stiefel aufgefallen, die auf dem Wasser des Taufbeckens trieben, und daneben eine kleine schwarze Kugel – der Kopf ihres Schützlings. Zunächst glaubte sie allerdings, dass er sich einen Spaß daraus machte, in dem Becken herumzuplanschen.
Im Hof des kleinen Mädchens zündete Mary ein Licht an und legte Yong Sheng auf ihrem großen Holzbett ab.
Der Junge öffnete die Augen und schloss sie sogleich wieder. In seinen Ohren dröhnte es, als ginge die Sintflut über die Erde. Nach und nach aber wandelte sich das Rauschen gewaltiger Wasserstürze in das Gurgeln eines Gebirgsbachs, das immer leiser wurde, bis nur mehr zu hören war, wie ein feiner Strahl Milch auf einen silbernen Kelch traf. Als auch dieser letzte Ton allmählich verklang, drang Marys Stimme zu ihm durch, sie las ihm aus Robinson Crusoe vor. Er liebte es, wenn sie ihm vorlas, und mit einem Mal erinnerte er sich daran, dass ihm der Mann aus dem Graben schon in einer ihrer Bibelgeschichten begegnet war. Er drückte seine Nase in das Kopfkissen, in der Hoffnung, etwas vom Duft der Milch wiederzufinden.
Mary war gerade bei der Liste der Dinge angelangt, die Robinson aus dem Wrack eines untergegangenen Schiffs geborgen hatte – Dinge, die er den Klauen des Meeres entrissen, Dinge, die ihm der Himmel geschickt hatte – und die er auf seine einsame Insel mitnehmen wollte. Die Namen der Gegenstände waren wie heilige Worte in Yong Shengs Ohren: Kohleneimer zum Beispiel. Mary las ihm die Wörter nicht einfach nur vor, sie sang sie wie das schönste aller Lieder, und gehüllt in den Duft ihrer Milch prägten sie sich für immer in sein Gedächtnis ein. Er lag auf einem fadenscheinigen Baumwolllaken, auf dessen blauem Grund zwei ausgeblichene Kindergestalten zu erkennen waren. Das größere Kind hatte ein Lotusblatt voll Wasser in der Hand, mit dem es den Kopf des kleineren begoss. Der Künstler hatte das tropfende Wasser mit kleinen weißen Strichen dargestellt, die unter Yong Shengs Blick zu Spritzern aus Marys Brust wurden, die den Mund des Gekreuzigten trafen. Der Junge erinnerte sich, wie frisch und rosig die dunklen Brustwarzen seiner Lehrerin ausgesehen hatten, als die Milch versiegte.
Sie erklärte ihm, dass die Figur, die er in der Kapelle entdeckt hatte, Jesus Christus zeigte. Vor wenigen Monaten war das Schiff, auf dem sich ihr Mann befand, von einem deutschen U-Boot bombardiert worden. Niemand hatte überlebt, zwischen den Wrackteilen aber hatten französische Soldaten diese Statue gefunden, die Mary mit Genehmigung der Admiralität behalten durfte.
»Denk immer daran: Was man nach einer Katastrophe aus den Trümmern rettet, wird zum größten Schatz der Welt.«
Kapitel 2Die Beschneidung
Es kam. Man sah es am fernen Horizont wie eine verirrte Insel im Meer treiben.
Eine Stunde später zeichneten sich seine Konturen deutlicher ab: Ja, es war das Schiff der Göttin Mazu[1], das vor der Insel Meizhou abgelegt hatte, wo sich der berühmte, ihr geweihte Tempel befand. Bei Tagesanbruch hatten gottesfürchtige Inselbewohner Mazu, verkörpert von einem jungen Mädchen aus der Region, das man seiner Schönheit wegen auserwählt hatte, auf einer Sänfte durch eine tosende Menschenmenge über die Schwelle des Tempels getragen, waren mit ihr die tausend steilen Stufen hinunter zu dem prächtig geschmückten Schiff gestiegen, das die menschgewordene Göttin zur Stadt Putian bringen sollte.
Die echte Mazu war ein paar Jahrhunderte zuvor gestorben, sie ruhte in einer Gruft im Innern des Tempels, aus der sie jeden Abend hervortrat, strahlend schön wie ehedem, um sich am Fuß eines Aguilars niederzulassen und dem Wind zu lauschen, der raunend durch die Blätter ging. Noch Hunderte Jahre nach ihrem Tod brachte dieser Baum einen Saft hervor, dessen Duft so betörend war wie zu ihren Lebzeiten. Im Hof des Tempels gab es einen Brunnen, den die Göttin selbst gegraben hatte und in dessen Wasser sie Abend für Abend, mit einem langen weißen Rock und einem leuchtend blauen Schal bekleidet, ihr Spiegelbild betrachtete. Dann schwang sie sich, als steige sie vom Himmel herab, die tausend Steinstufen hinunter zu einem Felsen, der sich aus dem Meer erhob, und segnete die Boote der Fischer.
Die Feierlichkeiten in diesem Jahr glichen denen der vergangenen Jahre. Das Ende des Sommers war gekommen. Die Tage waren schön, aber schon recht kühl, am Himmel bauschten sich weiße Schäfchenwolken, das Meer lag ruhig da. In Putian wimmelte es von Schaulustigen, und nicht alle stammten aus der Umgebung der Stadt, es waren auch Fischer von den benachbarten Inseln unter ihnen, Verehrer von Mazu, und Pilger aus ganz Südostasien.
Und dann kam sie. Die Träger mussten über fünfhundert Meter zurücklegen, um zum südlichen Tor der Stadt zu gelangen, deren grauer Schutzwall sich bereits dunkel abzeichnete. Zehn Minuten später erkannten sie die Schießscharten in der Festungsmauer, dahinter ließen gelbe Emailleschindeln den Konfuziustempel erahnen. Endlich erreichte die Prozession den südöstlichen Abschnitt der Anlage, der an dieser Stelle vom geschwungenen Dach des Pavillons der Prüfungen überragt wurde.
Unterdessen leitete ein Trommelwirbel die Zeremonie in der Stadt ein. Die Leute strömten in Richtung Zentrum, wo der Pavillon der Trommeln bald von einem Menschenmeer umschlossen war. Am Ende der Qing-Dynastie hatten die Bezirkschefs mehrere Jahre lang darauf verzichtet, den Vorsitz der Feierlichkeiten zu führen, und die neue Regierung der Republik, die einiges Chaos kannte, schien vergessen zu haben, dass die Küstenstadt Putian überhaupt existierte. Es fiel also einem der Honoratioren der Region zu, sich auf dem Balkon des Pavillons zu zeigen und das Fest mit einer Rede zu eröffnen. Allerdings hatte der Mann kaum ein paar Sätze gesprochen, als auch schon die Prozession Einzug hielt. Mit einem Schlag trat Stille ein. Die jungen Leute im Sonntagsstaat verloren für einen Moment das Interesse aneinander, die Augen der Alten wurden feucht, man brachte sich in Positur.
Die Fischer stimmten ein uraltes Lied an.
Wir alle sind gekommen für sie,
Mazu, unsere Ewige Mutter,
die uns vom Himmel ihr Lächeln schenkt.
Vor ihr lasst uns tanzen und singen,
ihr unsere Verehrung darbringen.
Mary und Yong Sheng waren nicht mit dem Schiff gekommen. Von Hanjiang bis Putian war der Mulan ganz schwarz von kleinen Booten, sodass sich Mary dafür entschieden hatte, ihr Hollandrad zu nehmen. Der Junge war inzwischen sieben und seit seiner Ankunft bei Pastor Gu, zwei Jahre zuvor, zusehends aufgeblüht. Sie legten die Strecke bis Putian auf einem holprigen Pfad zurück, mischten sich dort unters Volk und beobachteten voller Bewunderung, wie die Sänfte von Mazu über ihre Köpfe hinwegschwebte. Vor dem Pavillon der Trommeln jubelten sie mit der Menge dem feierlichen Umzug zu, doch auf einmal stieß Yong Sheng einen Schrei aus und krümmte sich auf dem Gepäckträger, auf dem er eben noch gestanden hatte.
»Es tut so weh, es tut so weh!«, sagte er zu Mary und deutete auf seinen Bauch. Vor lauter Schmerz brachte er kein weiteres Wort über die Lippen, glitt vom Gepäckträger und sank, von Krämpfen geschüttelt, zu Boden. Mary hob ihn sofort wieder auf das Fahrrad und bahnte sich einen Weg durch die Menge in Richtung Krankenhaus. Immer wieder wandte sie sich zu ihm um, trocknete ihm die Tränen oder richtete ihn wieder auf, denn er konnte sich kaum noch halten.
Plötzlich klopfte jemand dem Jungen auf die Schulter, und der Kleine sah auf: Es war sein Vater, der sich zur Feier des Tages die Haare hatte schneiden lassen und eine neue blaue Stoffjacke trug. Seine Frau hatte gerade eine Fehlgeburt erlitten und musste zu Hause das Bett hüten, weshalb er in Begleitung der Großmutter unterwegs war.
Als der Vater begriff, dass sein Sohn ein ernsthaftes Problem hatte, nahm er ihn auf den Arm und rannte los zum Krankenhaus.
Rasch stieg Mary auf ihr Rad und fuhr ihnen hinterher.
Atemlos erreichten sie das Yali-Krankenhaus, an dessen Bau der Zimmermann mitgewirkt und dessen von ihm gefertigtes Treppengeländer er seinen Sohn voller Stolz hatte hinunterrutschen lassen. Er trug den Jungen über die Schwelle und betrat das Foyer.
Der amerikanische Architekt, der mit den Plänen für den Bau betraut gewesen war, hatte sich bemüht, den Anmerkungen des Zimmermanns zur Psychologie der Chinesen, denen Häuser mit mehreren Etagen nicht behagten, Rechnung zu tragen. Er hatte die Hanglage genutzt und ein Ensemble aus drei Gebäuden entstehen lassen, von denen nur das dritte, das für längere Krankenhausaufenthalte vorgesehen war, über zwei Etagen verfügte.
Marys Rufe verhallten ungehört im Warteraum des ersten Gebäudes, niemand war da, alle schienen ausgeflogen zu sein. Der Schalter der Apotheke war geschlossen, das Labor lag verlassen da. Auch das zweite Gebäude, wo die Untersuchungen stattfanden, war menschenleer, erst im dritten trafen sie auf einen Bereitschaftsarzt, Doktor Charley, einen amerikanischen Chirurgen von ungefähr fünfzig Jahren, der einen stolzen, grau melierten Schnauzbart trug.
Sehr schnell stellte er eine Diagnose, die keinen Raum für Zweifel ließ: Der Junge litt an einer einseitigen testikulären Ektopie.
Auf Chinesisch erklärte er dem Zimmermann, dass ein Hoden seines Sohnes in den Unterleib gewandert sei. Als der Zimmermann das hörte, kamen ihm die Worte der alten Blinden in den Sinn, die den Jungen seinerzeit mit ihren knochigen Fingern zwischen den Schenkeln abgetastet hatte. »Ihm fehlt ein Hoden«, hatte sie behauptet.
»Wo ist denn der fehlende Hoden hin?«, fragte er den Chirurgen.
»Ich weiß es noch nicht. Vielleicht in der Leisten-, vielleicht auch in der Bauchgegend. Ich tippe auf Letzteres, da der Junge ja Anzeichen einer Kolitis zeigt. Ich werde ihn finden und ins Skrotum zurückverlegen.«
»Ist es nicht möglich, dass er sich von allein wieder dorthin bewegt?«, fragte Mary.
»Unmöglich. Der Junge ist schon sieben. Es führt kein Weg an einem chirurgischen Eingriff vorbei.« Er wandte sich an den Zimmermann: »Gestatten Sie, dass ich Ihren Sohn operiere?«
»Selbstverständlich«, sagte der Vater, ohne zu zögern.
Tatsächlich hatte er die genaue Bedeutung dieses »chirurgischen Eingriffs« nicht erfasst. Er glaubte, es handele sich um eine Art medizinischen Zaubertrick, also mehr oder weniger um ein Wunder, das den Hoden wieder an seinen Platz verwies. Die wissenschaftlichen Erklärungen von Doktor Charley verstand er nur insoweit, als dass sein Sohn nach dem »Eingriff« eine Woche im Krankenhaus bleiben und er selbst nach Hause gehen sollte, um eine Decke und andere Dinge herbeizuschaffen, die der Kleine für die Dauer dieses Aufenthalts brauchen würde. Also machte er sich auf den Weg und erzählte allen Bekannten, denen er begegnete, stolz: »An meinem Sohn wird ein chirurgischer Eingriff vorgenommen!«
Doktor Charley bat Mary, während der Operation an seiner Seite zu bleiben.
»Ich habe meine Ausbildung zur Krankenschwester abgebrochen, weil ich beim Anblick von Blut jedes Mal ohnmächtig wurde«, gestand sie ihm. »Deshalb bin ich auf Kunstgeschichte umgeschwenkt und Lehrerin geworden.«
»Das spielt keine Rolle, gucken Sie einfach nicht auf den Operationstisch. Ich möchte Sie lediglich darum bitten zu notieren, was ich sage, denn der Bericht über den Verlauf des Eingriffs soll in die Annalen der chinesischen Medizin eingehen. Es ist nämlich die erste Operation einer testikulären Ektopie, die in China stattfindet.«
Als die Großmutter des Jungen endlich am Krankenhaus ankam, war der Operationstrakt geschlossen.
Sie hämmerte mit all ihrer Kraft gegen die Tür, aber niemand reagierte. Ohne sich davon abschrecken zu lassen, ging sie um das Gebäude herum. Hinter einem Fenster auf der Rückseite entdeckte sie einen großen weißen Raum, in dem, ausgestreckt auf einem Brett, das größer war als eine Tür, ihr Enkel lag. Es war so groß, dass der Körper des Jungen darauf winzig, geradezu mitleiderregend wirkte, er schien zu ertrinken in dieser Welt, in der von den Wänden bis zur Decke alles weiß war. Auf den weißen Ablageflächen lagen, sorgfältig aufgereiht, verschiedene Instrumente aus Metall: Scheren in unterschiedlichen Größen, Nadeln und Werkzeuge mit langen Griffen, an deren Enden scharfe Klingen aufblitzten.
Ein seltsamer Mann in weißem Kittel und mit weißen Handschuhen strich sich über seinen grau melierten Schnauzbart, näherte sich ihrem Enkel, steckte ihm einen sonderbaren Gegenstand in den Mund und sagte dabei etwas, das sie nicht hören konnte.
Ohne zu wissen warum, jagte ihr das lange Glasröhrchen, so schmal und glänzend es war, einen fürchterlichen Schreck ein, ihre Beine begannen so stark zu zittern, dass sie sich auf ihren gebundenen Füßen nicht mehr halten konnte. Sie fing an zu weinen. Mary, die nicht wusste, dass sie die Großmutter von Yong Sheng war, zog unwillkürlich die dicken Vorhänge vor dem Fenster zu. Und vermutlich war das der Auftakt zu dem Drama, das sich später abspielen sollte. Wer konnte es ahnen? Hätte Mary das Fenster geöffnet, um der in Tränen aufgelösten Frau zu erklären, dass es sich bei dem Glasröhrchen, das der Arzt dem Jungen in den Mund geschoben hatte, bloß um ein Thermometer handelte – vielleicht hätte sich in der Folge alles anders ergeben.
Als Doktor Charley sich über sein Gesicht beugte, roch Yong Sheng den Duft von Zitrusfrüchten, den der Schnauzbart des Mannes verströmte. Ein Geruch, der ihm vertraut war, denn jeden Sonntag trank Pastor Gu, bevor er seine Predigt hielt, einen Zitronentee, der seinen Worten – von denen der Junge übrigens nicht viel verstand – denselben zitronigen Duft verlieh.
Lachend streckte er die Hand aus, um an den abstehenden Bartspitzen des Arztes zu zupfen.
Ein Jammer, dass die Großmutter, die sich inzwischen davongestohlen hatte, um sich auf anderem Wege Zutritt zum Operationssaal zu verschaffen, dieses Lachen verpasste. Sie war fest entschlossen, ihren Enkel aus dieser unheilvollen weißen Welt zu befreien. Womöglich hatte er das seltsame Ding, mit dem der Fremde ihm den Mund gestopft hatte, schon verschluckt? Vielleicht breitete sich bereits ein schlimmes Gift in seinem Körper aus? Das ihn am Ende umbrachte?
»Du kleiner Schlingel!«, flüsterte der Chirurg Yong Sheng ins Ohr. »Lass mich dich mit dem Chloroform betäuben.« Dann sagte er, an Mary gewandt: »Ich habe in diesem Krankenhaus noch nie Äthyläther bekommen, immerzu muss ich mich mit Chloroform begnügen.«
Sie notierte den Satz, Wort für Wort.
Er griff nach einer Maske, mit der er die Nase des Jungen bedeckte.
Was für ein merkwürdiger Geruch, dachte Yong Sheng. Viel intensiver als Zitrone. So riecht der Aguilar, wenn ich mit dem Taschenmesser ein Stück Rinde aus dem Stamm schneide.
Mit diesem komischen Bart ähnelte das Gesicht von Doktor Charley auf einmal der Fratze eines Hampelmanns. Es war lustig, immer wenn der Hampelmann die Lippen bewegte, stellten sich die Bartspitzen auf. Und mit diesem Gedanken sank der Junge in die Bewusstlosigkeit.
Just in dem Moment wurde die Tür aufgerissen, und die Großmutter stand auf der Schwelle. Gott weiß, wie es ihr gelungen war, hier hereinzukommen.
Sie dachte wohl, ihr Enkel sei tot.
»Mörder!«, brüllte sie und stürzte auf den Operationstisch zu. »Sie haben ihm eine Muschel auf die Nase gedrückt, damit er keine Luft mehr kriegt!«
Wie ein wildes Tier warf sie sich auf das Kind und versuchte, ihm die Maske vom Gesicht zu zerren, doch Doktor Charley packte sie am Handgelenk und beförderte sie vor die Tür. Er hielt sie für eine der psychiatrischen Abteilung entflohene Irre.
Arme alte Frau! Sie wollte ihren Enkel von dem Folterinstrument befreien, das ihn erstickte, doch alles, was dabei herauskam, war ein Riss in ihrer weißen Baumwollbluse.
Der Chirurg machte sich geschäftig und mit ernster Miene wieder ans Werk. Mit lauter, feierlicher Stimme, die durch nichts zu erschüttern war, bat er Mary, seine Aushilfsassistentin, Datum, Ort und jeden einzelnen Schritt des Eingriffs festzuhalten.
»Mit dem Skalpell Nummer 11 werde ich zunächst einen diagonalen Schnitt von viereinhalb Zentimetern Länge in der Leistenregion vornehmen. Da Sie so flink mit dem Bleistift sind, junge Dame, fertigen Sie doch bitte eine Skizze der Sehnen an, die hier unter der Haut liegen. Nun begebe ich mich auf die Suche nach dem Hoden. Da ich in anderen Ländern schon einige Operationen dieser Art erfolgreich durchgeführt habe, weiß ich, dass er sich manchmal unter den Bauchmuskeln versteckt, aber bei diesem Patienten finde ich ihn dort nicht. Ich suche weiter in der Denis-Browne-Hülle, aber auch hier ist nichts zu sehen. Also muss ich mit dem Skalpell Nummer 9 einen Schnitt am unteren Peritoneum setzen.«
Er fuhr sich mit der Zunge über die vollen Lippen. Ein fröhlicher, stolzer Glanz lag in seinen Augen, als er zu Mary sagte: »Riechen Sie das? Diesen widerlichen Gestank der Gedärme? Hier! Der Hoden des Patienten steckt im Leistenkanal. Ich muss eine Orchidopexie vornehmen.«
Mary suchte in jedem Winkel ihres Gedächtnisses nach diesem Begriff, den sie sicher irgendwann in der Schwesternschule in Kansas gelernt hatte. Aber sie erinnerte sich nicht mehr, was mit »Orchidopexie« gemeint war.
Plötzlich fiel ihr etwas auf.
»Doktor Charley«, sagte sie.
»Soll ich Ihnen das Wort buchstabieren?«
»Sehen Sie nur, Doktor Charley, da ist jemand auf dem Dach.«
»Wir haben jetzt keine Zeit, uns dafür zu interessieren, was auf dem Dach vor sich geht, meine Liebe. Reichen Sie mir bitte den Stechzirkel. Ich werde den Hoden herausholen, um seine genaue Größe zu messen.«
Gehorsam griff sie nach dem gewünschten Instrument und legte es in seine Hand.
»Notieren Sie: 1,5 Zentimeter Länge, vier Millimeter Breite, und der Samenstrang misst vier Zentimeter.«
»Doktor Charley!«
»Was denn noch?«
»Die Frau dort, auf dem Dach, schwenkt eine weiße Fahne, als wollte sie um Hilfe rufen, es ist die alte Dame, die eben hereingestürmt kam.«
»Sie bringen mich völlig aus dem Konzept, Herrgott. Nun schreiben Sie schon mit: Ich nehme einen Schnitt von zwei Zentimetern über dem Bauchmuskel vor. Es ist bedauerlich, dass ich keine richtige Assistentin zur Seite habe, ich muss den Hoden nach unten bewegen, und da der Samenstrang zu kurz ist, benötige ich eine gebogene Pinzette, damit ich ihn vorsichtig Richtung Skrotum schieben kann.«
Mary wurde von einem leichten Schwindel gepackt, den ihr nicht etwa der Anblick des Bluts verursachte, sondern der seltsame Kontrast zwischen dem englischen Fachvokabular des Arztes und dem, was sich dort draußen vor dem Fenster abspielte.
Im diffusen Licht der Spätsommersonne wirkte die Szene auf Mary wie ein überbelichtetes Foto. Die alte Frau, die mit ihrem weißen Stofffetzen herumwedelte, schien geradewegs einem schlecht entwickelten Stummfilm entstiegen (Mary hatte in Paris dem Wunder des Jahrhunderts beigewohnt: der Geburt des Kinos). Wie ein Gespenst vollführte sie die immer gleiche, übertriebene Bewegung und reckte ihren Hals, als zöge eine unsichtbare Kraft ihren Kopf nach hinten. Unermüdlich schwenkte sie ihre weiße Fahne. Doch plötzlich krampfte Marys Herz sich zusammen, als sie nämlich erkannte, dass es sich gar nicht um eine Fahne handelte, sondern um das kleine Hemd von Yong Sheng, das sie selbst gewaschen und gestärkt hatte. Sie hatte noch im Ohr, wie es auf ihrem Hof im Wind flatterte.
In diesem Moment begriff sie, dass die Frau dabei war, Yong Shengs Seele zu beschwören.
Zu spät. Vor dem Eingang des Krankenhauses hatte sich bereits eine aufgebrachte Menge versammelt. Über den schwarzen Köpfen wehten die Banner zu Ehren Mazus. Mary befürchtete, dass die Alte mit ihrem Gefuchtel tatsächlich die gesamte Prozession mobilisiert hatte.
Erneut versuchte sie, Doktor Charley zu warnen: »Die Situation läuft aus dem Ruder, es kommen immer mehr Menschen. Man könnte meinen, die ganze Stadt hätte sich vor dem Krankenhaus eingefunden.«
»Die Meute verhält sich immer wie ein Kind, das mit glückseliger Faszination seine eigenen Exkremente betrachtet. Die Leute sind gekommen, um die verrückte Alte auf dem Dach tanzen zu sehen«, gab er zurück, ohne das Ganze auch nur im Geringsten ernst zu nehmen.
Durch einen kleinen Spalt zwischen den Vorhängen entdeckte Mary Zimmermann Yong, seinen Gesichtsausdruck allerdings konnte sie nicht erkennen (abgesehen von einem gelegentlichen nervösen Zucken war seine Miene versteinert). Ebenso wenig sah sie, dass ihm der Schweiß über die Stirn lief. Was sie hingegen sah, war, dass er sich, schnell wie ein Pfeil, einen Weg durch die Menge bahnte, als hätten seine Beine die Schwerkraft überwunden.
Er ließ all die Menschen hinter sich, einen nach dem anderen, und als sie auf den Eingang des Krankenhauses zustürzten, stand er in der ersten Reihe.
Mary ahnte bereits, dass sie keineswegs gekommen waren, um die Pantomime der alten Dame zu bewundern, sondern deutlich kriegerische Absichten hegten.
Doktor Charley leitete die letzte Phase der Operation ein. Ein Teil des leeren Skrotums des Kindes lag offen da. Der Chirurg setzte erneut an, sein Vorgehen zu erläutern: »Meine liebe Assistentin, ich empfehle Ihnen, das, was nun folgt, mit einer schematischen Zeichnung festzuhalten, denn es ist der schönste Part dieses chirurgischen Eingriffs. Schauen Sie, mit der gebogenen Pinzette packe ich den Testikel am unteren Rand seiner Hülle und schiebe ihn vorsichtig in den Hodensack. Moment, ich erkenne eine leichte Torsion des Samenstrangs, sicher harmlos, ich werde sie dennoch korrigieren. Schon passiert. Mit ein paar Stichen schließe ich nun die Membran des Samenstrangs und die intramuskuläre Membran, setze den Hoden in seinen Sack und vernähe die Haut des Skrotums.«
Dieser letzte Satz endete in einem ohrenbetäubenden Lärm, der die Wände des Operationsraums erbeben und den Chirurg vor lauter Schreck die Nadel fallen ließ.
»Was ist das für ein Krach?«, fragte er mit zitternder Stimme.
»Jemand will die Tür mit einer Axt einschlagen«, sagte Mary. »Ich glaube, es ist der Vater des Kleinen.«
»Will er mich umbringen?«, krächzte der Arzt, stürzte zum Fenster und riss die Vorhänge auf. Es ging auf die Rückseite des Krankenhauses hinaus, wo niemand zu sehen war. Nur der Hang, an dem das Gebäude lag. Er öffnete das Fenster, sprang ins Freie und suchte das Weite.
Aber wie konnte die Operation einer Hodenektopie für einen derartigen Aufruhr sorgen?
Betrachten wir zunächst den Ort des Eingriffs: das Krankenhaus einer fremden Kirche.
Dann, der Operateur: ein ausländischer Chirurg.
Und schließlich, was am schwersten ins Gewicht fiel: die betroffene Körperregion. Es handelte sich um das sensibelste Organ eines Mannes, kein anderes war symbolisch stärker aufgeladen und mit dem Ursprung des Lebens verknüpft, sodass schon das kleinste Missverständnis leicht in einen Albtraum umschlagen konnte.
In Putian lebte ein weiser alter Mann, der viele Jahre zuvor die ersten Missionare in der chinesischen Sprache unterrichtet hatte und von ihnen gebeten worden war, ein paar Korrekturen an der chinesischen Übersetzung des Neuen Testaments vorzunehmen, die aus der Feder ihrer Vorgänger stammte. Er hatte ein Jahr lang daran gearbeitet und ließ die Menge nun an seinem großen Wissensschatz teilhaben:
»Sie behaupten, ›einen versteckten Hoden zu suchen‹, aber das ist Unsinn. Das sind Betrüger. Der Sohn von Zimmermann Yong wird gerade schlicht und ergreifend beschnitten. Es handelt sich nicht um einen chirurgischen, sondern um einen religiösen Eingriff, den man als ›Beschneidung‹ bezeichnet.«
Er war der Einzige unter den Bewohnern von Putian, der dieses Wort kannte.
Lauthals stellte er sein außergewöhnliches Erinnerungsvermögen unter Beweis und zitierte eine Stelle aus der Bibel:
Das ist mein Bund zwischen mir und euch samt deinen Nachkommen, den ihr halten sollt: Alles, was männlich ist unter euch, muss beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch.
Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, bemühte er eine weitere Episode aus der Heiligen Schrift, in der Gott beinahe Moses’ erstgeborenen Sohn tötete, dann jedoch Abstand davon nahm, da dessen Frau Zippora Einspruch erhob.
Unterwegs am Rastplatz trat der Herr dem Mose entgegen und wollte ihn töten. Zippora ergriff einen Feuerstein und schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab. Damit berührte sie die Beine des Mose und sagte: Ein Blutbräutigam bist du mir. Da ließ der Herr von ihm ab. »Blutbräutigam«, sagte sie damals wegen der Beschneidung.
Man kann sich vorstellen, welche Bestürzung diese Worte in den Herzen der Versammelten auslösten, zumal im Herzen von Zimmermann Yong. Eiskalte Schauer überkamen die Zuhörer, sie hatten Gänsehaut am ganzen Körper. Was war das für ein seltsamer Gott, der sein Bündnis mit dem Volk besiegeln wollte, indem er das Geschlecht der Jungen beschneiden ließ?
Als sie dann die Großmutter erblickten, die noch immer das weiße Hemdchen des Kindes schwenkte, wussten sie, dass sie den Operationssaal, in dem ein Fremder einen der Ihren beschnitt, stürmen mussten.





























