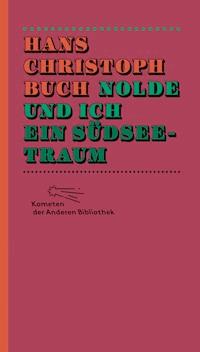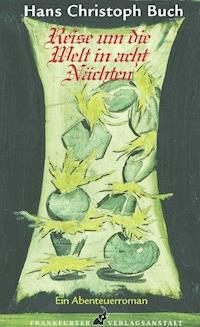Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Hans Christoph Buch versteht es wie kein anderer, Atmosphäre zu erzeugen, Stimmungen zu evozieren, Bilder zu entwerfen, so dass sich der Leser, auf dem Sofa liegend, wie unter Zwang mitgezogen fühlt und das Fremde hautnah erlebt." Frankfurter Allgemeine Zeitung Hans Christoph Buch ist der große Reisende unter den deutschen Schriftstellern. Sein neuer Roman lädt die Leser zu einer Zeitreise ein, einer Expedition ins Ich, die den Erzähler an die Orte seiner in Südfrankreich verbrachten Jugend führt: ins Kloster La Sainte Baume, wo Buch Französisch lernte, nach Marseille, wo sein Vater als Konsul amtierte, und nach Sanary, wo er den Spuren von Bertolt Brecht, Thomas Mann und anderen prominenten Exilanten nachgeht - und in Buchs zweite Heimat: das vom Erdbeben zerstörte Haiti. Der Weg in die Erinnerung führt in die Fiktion: Buch erzählt eine geheimnisvolle Reise ins Innere, vom Leben als Reise ins Totenreich, als Gottsuche, deren Protagonist und Erzähler sich in einen lebenden Toten verwandelt, voll neuer Leichtigkeit und doch dazu verdammt, die Fehler und Irrtümer zu wiederholen, die ihm zu seinen Lebzeiten unterlaufen sind. Hans Christoph Buchs neuer Roman ist ein literarisches Vexierspiel: Aufgesplittert in ein Kaleidoskop verschiedener Erzählungen, mehrfach gespiegelt in Geschichten literarischer Vorbilder und Figuren, nähert sich der Text in spiralförmiger Struktur dem Leben des Autors, ohne je den Anspruch auf biographische Authentizität zu erheben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Christoph Buch ist der große Reisende unter den deutschen Schriftstellern. Sein neuer Roman lädt zu einer phantastischen Zeitreise ein, einer Expedition ins Ich, die den Erzähler an die Orte seiner in Südfrankreich verbrachten Jugend führt: ins Kloster La Sainte Baume, in dem er Französisch lernte, nach Marseille, wo sein Vater Generalkonsul war, und Sanary, wo der Erzähler den Spuren prominenter Exilschriftsteller nachgeht, darunter Brecht und Feuchtwanger, Thomas und Heinrich Mann. In Haiti erlebt er die Folgen der Erdbebenkatastrophe und damit den Untergang des Landes, so wie er es kannte. Angesichts des Verlusts von Vergangenem stellt sich Buch schließlich selbst dem Zerfall. Nach seinem Tod ist es seine Ex-Frau Judith, die an seiner statt nach Kolumbien reist und sich im Herzen der Finsternis auf Spurensuche begibt.
»Ich ist ein Anderer« – dieses Motto von Rimbaud könnte Hans Christoph Buch seinem neuen Roman voranstellen. Aufgesplittert in ein Kaleidoskop verschiedener Erzählungen, mehrfach gespiegelt in Geschichten literarischer Vorbilder und Figuren, nähert sich der Text in spiralförmiger Struktur dem Leben des Autors, ohne je Anspruch auf biographische Authentizität zu erheben. Buch erzählt vom Leben als Reise ins Totenreich, als Gott- suche, und verwandelt seinen Erzähler in einen lebenden Toten, voll neuer Leichtigkeit und doch dazu verdammt, die Fehler und Irrtümer zu wiederholen, die ihm zu seinen Lebzeiten unterlaufen sind.
HANS CHRISTOPH BUCH
Baron Samstag
oder das Leben nach dem Tod
Roman
Inhaltsverzeichnis
Bildbeschreibung
ERSTES BUCH
Gott in Frankreich
Haiti gibt es nicht
Das dritte Ufer des Flusses
ZWEITES BUCH
Gott in Frankreich
Haiti gibt es nicht
Das dritte Ufer des Flusses
DRITTES BUCH
Gott in Frankreich
Haiti gibt es nicht
Das dritte Ufer des Flusses
BILDBESCHREIBUNG
Im Zentrum des sechzig mal fünfundvierzig Zentimeter großen, nein kleinen Bildes des Malers und Voodoo-Priesters André Pierre steht der Totengott Baron Samedi alias Maître Lacroix: Nicht, wie in Haiti üblich, als androgyner Gott dargestellt mit breiten Hüften und dem Busen einer Frau, sondern als alter Mann mit gezwirbeltem Schnurrbart und buschigen Koteletten, der einen mit Voodoo-Symbolen bestickten Anzug im Stil des Fin de siècle trägt, dazu einen schwarzen Zylinder, auf den ein an eine Piratenflagge erinnernder Totenschädel mit gekreuzten Knochen gezeichnet ist. Statt der auf Hochglanz polierten Lackschuhe, in denen er sonst immer auftritt, ist Baron Samstag barfuß, um den Kontakt zur Erde nicht zu verlieren, aus der er wie Antaios seine Kraft bezieht, denn dort ruhen die Gebeine der Vorfahren, deren Totenruhe er durch Trommeln stört und die er mit Tanzschritten und rhythmischem Sprechgesang zum Leben erweckt. Vielleicht ist das der Grund, warum man vor Beginn einer Voodoo-Zeremonie den Boden des Tempels mit Friedhofserde bestreut, auf die der Laplace genannte Gehilfe des Priesters mit Maismehl geometrische Muster malt. Die Rede ist von einem als manger morts bezeichneten Ritual, das in der Nacht vor Allerheiligen in den Houmforts von Haiti gefeiert und vor den Blicken Unbefugter, nicht in die Mysterien Eingeweihter, abgeschirmt wird. Erst als der Lehmboden des Tempels mit an Freimaurersymbole erinnernden Ornamenten verziert war, genannt Vévés, begann die Zeremonie, bei der die Priesterin, in der Baron Samstag sich um Mitternacht inkarnierte, mich von einem Schlangenbiss heilte, der meinen Fußknöchel hatte anschwellen lassen auf die Größe einer Kokosnuss. Das ist jetzt dreißig Jahre her: Genau genommen war es keine Giftschlange, sondern ein Riesenblutegel, haementeria ghilianii, der sich in Französisch-Guyana, an der Wasserscheide zwischen Amazonas und Orinoko, an meiner Ferse festgesaugt hatte, als mein Mietwagen, ein altersschwacher Citroën, auf einer Dschungelpiste im Schlamm steckenblieb, und ich hatte keine Zeit, das wie ein Aal sich windende Tier genauer in Augenschein zu nehmen, bevor Raphaël, mein einheimischer Führer und Chauffeur, seine Gauloise oder Gitane auf ihm ausdrückte. Auf dem Rückflug von Cayenne nach Port-au-Prince entzündete sich der kreuzförmige Biss und tat höllisch weh, die Schuhe passten mir nicht mehr und ich bewegte mich mühselig humpelnd am Stock, bis die Priesterin, will sagen Baron Samstag, mit Friedhofserde und einer monotonen Litanei, von der ich nur die Hälfte verstand, meinen Fuß entgiftet und mich von den Folgen des Bisses kuriert hatte.
Auf dem eingangs erwähnten Bild hat Maître Lacroix alias Simon der Sargtischler das Kreuz geschultert, das er für die Hinrichtung Christi gezimmert und diesem abgenommen hat, als der Messias, durch Folter und Blutverlust geschwächt, auf dem nach Golgatha führenden Kalvarienweg unter der Last des Kreuzes zusammenbrach. Vielleicht ist Baron Samstag mit dem ewigen Juden identisch, der seit zweitausend Jahren Länder und Meere durchstreift, ohne leben oder sterben zu können: Ein Vorläufer des fliegenden Holländers, dem man in allen Häfen die Landung verwehrt, und ein Zombie im wahren Sinn des Wortes, denn es ist kein Zufall, dass die lebenden Toten wie die Boat People in Haiti beheimatet sind.
Zu Füßen, nein: unter den Fersen des Barons befindet sich ein mit Vévés verziertes Grab, auf dem eine Kerze brennt neben einem Kreuz mit der Inschrift HINRI, die auf Jesus von Nazareth, den König der Juden, ebenso verweist wie auf Henri Christophe, den König von Haiti, der im Norden der Insel von befreiten Sklaven, die er erneut versklavte, eine Festung errichten ließ, genannt La Citadelle, bei deren Bau zwanzigtausend Zwangsarbeiter ums Leben kamen. Hier schoss König Christophe, nach einem Schlaganfall gelähmt, sich, um seinem Sturz zuvorzukommen, eine goldene Kugel in den Mund, die ihm das Direktorium der Republik zusammen mit einer Pistole aus der Manufaktur von Versailles für seine historischen Verdienste verliehen hatte.
Beim Aufstieg nach Golgatha, ein hebräischer Ortsname, der Galgenberg oder Schädelstätte bedeutet, tritt Grande Brigitte, die Herrin der Friedhöfe, Baron Samstag entgegen – im Pantheon der Voodoo-Götter wird Grande Brigitte mit Maria Magdalena oder der Heiligen Veronika identifiziert. Sie trägt ein mit Voodoo-Symbolen besticktes Kleid und einen lila Turban auf dem Kopf, hält einen aus Perlen geflochtenen Rosenkranz in der linken und das Grabtuch der Veronika in der rechten Hand, ein Laken mit dem Abdruck des Kopfes eines bärtigen Mannes, ein Haupt voll Blut und Wunden, bei dem es sich um unseren Herrn und Heiland Jesus Christus handeln soll: Aus der Dornenkrone rinnen mit Essig vermischte Blutstropfen, die das Leintuch aufgesogen hat. Für den Fall, dass Baron Samedi den Weg nicht freimachen will, hat Grande Brigitte ihren Cousin Zaca mitgebracht, den Geist der Erde und der Landwirtschaft: Er ist barfuß und hat, wie die Tontons Macoutes genannten Schergen des Diktators Papa Doc, eine Trommel und eine Machete umgeschnallt. Doch es ist nicht ganz klar, ob sie Baron Samstag zur Umkehr bewegen kann, indem sie ihm das Grabtuch entgegenstreckt, oder ob Grande Brigitte, alias La Reine, auf dem Weg nach Golgatha ein Wunder bewirkt, indem sie Jesus Christus noch vor dessen Kreuzestod aus dem Totenreich auferstehen lässt. Diese Frage könnte nur der Maler und Voodoo-Priester André Pierre beantworten, der nach Fertigstellung des Gemäldes, das er mir zu treuen Händen übergab, das Zeitliche gesegnet und die Antwort mit ins Grab genommen hat.
ERSTES BUCH
GOTT IN FRANKREICH
»… er entschuldigte seine Unbeständigkeit in einer Sache damit, dass er in einer anderen sehr beharrlich war …«
(Henry James)
1
Fünfzig Jahre, fünf Monate und fünf Tage nach seinem Aufenthalt in La Sainte Baume kehrte H. C. Buch an die Stätten seiner Jugend zurück – ohne zu wissen, warum. War es das Novemberwetter, der Tunnelblick auf immer kürzer und dunkler werdende Tage, der ihm das auf einer Hochebene gelegene Kloster als Stern von Bethlehem erscheinen ließ, von dem er sich Rettung erhoffte – Rettung von wem oder was? Die Hotellerie des Klosters, das er im Internet anklickte, hatte keinen Stern: La Sainte Baume war ein Hotel ohne Stern, eine Herberge, besser gesagt, mit brettharten Betten und Zimmern ohne Bad; das Fehlen von heißem Wasser wurde durch Wein wettgemacht – Rotwein und Rosé waren im Zimmerpreis inbegriffen. Das war schon vor fünfzig Jahren so: Nicht nur die Mönche, auch die Gäste des Klosters bekamen zu den Mahlzeiten mit Wasser verdünnten Wein vorgesetzt.
»Sie haben dich zum Alkoholiker gemacht«, sagte Buchs Ex-Frau, eine Ex-Feministin, mit der er sich seit der Scheidung wieder besser verstand: Mit sie meinte sie die französischen Katholiken. »Wie hieß der Orden doch gleich? – Dominikaner«, fuhr sie nach einer Denkpause fort, in der sie vor dem Schlafzimmerspiegel ihre Frisur ordnete – auftuffen nannte sie das. »Die Jesuiten waren fürs Geistige zuständig, und die Dominikaner erledigten die Dreckarbeit: Ketzerverfolgung, Hexenprozesse, Inquisition. Man hat dich betrunken gemacht und sexuell missbraucht. Kein Wunder, dass du dich an nichts mehr erinnern kannst!«
Ende der fünfziger Jahre, als das Bonner Auswärtige Amt seinen Vater nach Marseille versetzte, hatte der ihn ins Kloster La Sainte Baume geschickt. Dort hatte Buch unter Anleitung eines Dominikanermönchs unregelmäßige Verben gepaukt, die er heute noch auswendig konnte – einschließlich subjonctif, imparfait, passé simple und futur antérieur. In seiner Erinnerung waren die Wochen auf der mit Felstrümmern übersäten Hochebene eine glückliche Zeit, überwölbt von einem strahlend blauen Himmel, durchzogen vom bittersüßen Duft von Pinienharz, Lavendel und Thymian, und er erinnerte sich nicht daran, sexuell belästigt oder missbraucht worden zu sein. Aber der Erinnerung ist nicht zu trauen, sein Gedächtnis war ein breitmaschiges Netz, in dem nur das Gröbste hängen blieb, bis zur Unkenntlichkeit entstellt und verformt wie von einer Schrottpresse, die Limousinen auf das Format von Postpaketen zusammendrückt – selbst forensische Experten können die im Kofferraum versteckte Leiche nicht finden. Vielleicht hatte Buchs Ex-Frau doch recht gehabt. Judith hatte Jura und Psychoanalyse studiert und hielt seine partielle Amnesie für die Spätfolge eines Kindheitstraumas: Unzucht mit Abhängigen sei an der Tagesordnung gewesen in Priesterseminaren und Klosterschulen; erst kürzlich habe sich der Papst im Namen der Kirche für sexuellen Missbrauch entschuldigt – ob ihm das nicht zu denken gebe, sagte Judith, kniff das rechte Auge zusammen und zog den linken Lidschatten nach.
Ausschlaggebend für seine Rückkehr nach La Sainte Baume war nicht der Wunsch nach Aufarbeitung der angeblich dunklen Vergangenheit, die ihm im Rückblick von blendendem Licht durchflutet schien, sondern etwas anderes. Die Temperatur entspreche der Jahreszeit, teilte man ihm auf Anfrage mit: Morgens sei es empfindlich kalt, doch tagsüber scheine die Sonne, und nachts würden die Zimmer beheizt. Die Zentralheizung sei die einzige Neuerung in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, und er würde das Kloster so vorfinden, wie er es vor fünfzig Jahren verlassen hatte, schrieb der an der Rezeption Dienst tuende Mönch, der seine E-Mail mit »salutations fraternelles« unterzeichnete: Eine Grußformel, die Buchs Herz erwärmte und ihn zur Reise nach La Sainte Baume bewog.
2
H. C. Buch war kein religiöser Mensch, er war ungläubig wie viele Angehörige seiner Generation, die bei dem Wort Ostern nicht an die Kreuzigung Christi dachten, sondern an Protestmärsche gegen den Atomkrieg. Evangelisch getauft und konfirmiert, war er aus der Kirche ausgetreten aus Empörung über einen Pfarrer, den er auf einer Delegationsreise nach Moskau begleitet hatte – für Frieden und Entspannung, wie es damals hieß. Statt in der UdSSR verbotener Bibeln hatte der Entspannungspfarrer Strumpfhosen im Gepäck, mit denen er seine Moskauer Geliebte bei der Stange hielt – hier stimmte die Redensart; dass der KGB den Kuppler spielte, verstand sich von selbst. Der Entspannungspfarrer ließ durchblicken, er habe von Marx und Lenin mehr gelernt als aus dem Marcus-, Lukas- oder Johannes-Evangelium. Und als H. C. Buch »Ihr seid das Salz der Erde« ins Gästebuch eines Höhlenklosters schrieb, warf er ihm vor, die sowjetischen Gastgeber mit friedensfeindlichen Parolen zu provozieren.
Aber es gab auch Gegenbeispiele wie den Erzbischof von Monrovia, Michael Francis, der ein Programm zur Enttraumatisierung minderjähriger Mörder ins Leben gerufen hatte: Damit waren Kindersoldaten gemeint: Von Warlords zwangsrekrutiert, hatten sie Gräueltaten begangen, die ihnen die Rückkehr ins Zivilleben verbauten – von Folter und Vergewaltigung bis zum Kannibalismus.
Die Enttraumatisierung vollzog sich in drei Phasen: Entwaffnung, Verzeihung und Rehabilitierung. Hinterher wurden die ehemaligen Kindersoldaten von der Dorfgemeinschaft verprügelt – auf eigenen Wunsch, wie Michael Francis betonte, der in Turnschuhen und T-Shirt eher einem Laienprediger ähnelte als einem Erzbischof. Buch hatte ihn gefragt, wie er reagieren würde, wenn Rebel King, ein entlaufener Missionsschüler, der zwei italienische Nonnen sadistisch zu Tode gequält hatte, die verdiente Strafe ereilen würde: »Ich hätte kein Mitleid mit ihm, aber ich würde beten für Rebel Kings Seelenheil!«
Oder Fra Angelo – hieß er wirklich so? – ein Salesianer-Pater aus Rom, der seine von Moslemrebellen zerstörte Kirche in Rumbek, Südsudan, allein wiederaufgebaut und mit Fresken ausgemalt hatte, auf denen Johannes der Täufer, umschwärmt von Heuschrecken, in der Wüste zu sehen war. Als Farbe diente ihm rotbraune Erde, die er mit bloßen Händen auf die weißen Wände auftrug. Fra Angelo kochte Spaghetti auf einem Gaskocher – ohne Soße, weil es auf dem Markt von Rumbek kein Tomatenmark gab, und sagte, lieber würde er den Märtyrertod sterben, als sein Gotteshaus den Rebellen zu überlassen. Die Kirchenleitung hatte ihn nach Rom zurückbeordert, aber Fra Angelo ignorierte den Befehl und blieb gegen den Willen seiner Vorgesetzten im Sudan.
Buch hätte nicht zu sagen gewusst, warum ihn das Beispiel dieser Priester beeindruckte, die christliche Werte nicht bloß gepredigt, sondern gelebt hatten. Trotzdem hatte er es nie bereut, dass er aus der Kirche ausgetreten war – nicht, um Steuern zu sparen, sondern weil er die Mehrzahl der Protestanten für saft- und kraftlose Gutmenschen hielt, deren salbungsvolle Reden von Frieden und Umweltschutz nur zur Beruhigung ihres schlechten Gewissens dienten: Selbstgerechte Pharisäer, die mit Luther nur noch der Buchstabe verband, nicht der Geist, und die statt Bach’scher Choräle kitschige Bluesweisen sangen – Pseudo-Jazz aus zweiter und dritter Hand.
Demgegenüber hatte er von seinem verstorbenen Vater, der mit zweitem Vornamen Maria hieß und gegen seinen Willen evangelisch erzogen und konfirmiert worden war, eine stille Liebe zur katholischen Kirche geerbt, wahrte aber trotzdem – oder gerade deshalb – eine heilsame Distanz.
3
Die Straße nach La Sainte Baume führte in Serpentinen bergan, höher und immer höher hinauf. Er hatte vergessen, wie kurvenreich der Weg und wie einsam die Gegend war – einzig eine Richtfunkantenne am Bergkamm und ein stillstehendes Windrad, bei dem es sich auch um ein Kruzifix handeln konnte, wiesen auf die Anwesenheit von Menschen hin. Nur einmal überholte er einen Radfahrer, der sich, tief über die Lenkstange gebeugt, abstrampelte, um die Steigung zu überwinden, nicht mit dem Mountain-Bike, sondern auf dem Rennrad: Im Schweiße seines Angesichts – hier passte die alttestamentarische Redensart. Buch dachte an Vater Vivie, genannt Vélocio, den Apostel der Radrennfahrer, an den eine Marmorplakette in La Sainte Baume erinnerte, gestiftet vom Marseiller Radsportverband am 11. September 1949: Ein geschichtsträchtiges Datum, wenn man sich klarmachte, was an diesem Tag sonst noch alles passieren würde, vom Militärputsch in Chile bis zum World Trade Center in New York. Ein mit Bauholz beladener Lastwagen bog um die Ecke, blendete auf und hupte, um entgegenkommende Fahrer zu warnen, und Buch stellte sich vor, wie Vater Vivie die Teilnehmer der Tour de France zum Christentum bekehrte, indem er den Radchampions Rosenkränze in die Hände drückte, obwohl Paul Vivie kein Priester, sondern Sportreporter gewesen war. 1949 hatte der Kalte Krieg begonnen, und in Buchs Phantasie wurde Vélocio zu einer Kreuzung aus Don Camillo und Peppone, eingeschreint ins Herz der Arbeiterklasse, wie es damals so schön hieß.
Einem Wegweiser folgend mit der Aufschrift DFCI, bog er von der Straße ab und parkte in einem windzerzausten Olivenhain. Er hatte keine Ahnung, was sich hinter der Abkürzung verbarg: Etwas wie RSVP oder VSOP – ein Glasfaserkabel oder eine Sprinkleranlage vielleicht? Er lief über einen mit Grillkohlen übersäten Picknickplatz und erleichterte sich am knorrigen Stamm einer Krüppeleiche. Lockeres Geröll rieselte den Berghang hinab, und Buch trat einen Schritt zurück: Vor ihm brach die Felskante abrupt ab, und zu seinen Füßen öffnete sich ein S-förmiges Tal, einmündend in eine sanft geschwungene Bucht. Die Sonne stand tief über dem Horizont, und trotz seines schlechten Gehörs drang der Verkehrslärm einer nicht sichtbaren Autobahn an sein Ohr. In der Tiefe des Tals flammten Lichter auf, vielleicht die Lichter von Aubagne, auf halbem Weg zwischen der Küste und dem Massiv von La Sainte-Baume. Erst jetzt begriff er, dass er auf den Ort herabblickte, an dem er die glücklichste Zeit seiner Jugend zugebracht hatte: Marseille.
4
H. C. Buch war mittelgroß und schlank; weil er schlecht hörte, hielt er den Kopf schräg geneigt, was seiner von Querfalten zerfurchten Stirn einen leidenden Ausdruck gab. Er sah aus wie ein Priester oder Soldat, ein Jesuit vielleicht. Doch der melancholische Zug um seinen Mund erinnerte eher an einen pensionierten Sheriff, dessen Hand zittert, weil er zu oft und zu tief ins Whisky-Glas schaut, statt auf der Main Street Banditen ins Visier zu nehmen.
»Du machst dich älter, als du bist«, hatte Judith zu ihm gesagt, während er die Sicherheitskontrolle am Flughafen durchschritt, in löchrigen Socken, eine Hand am Hosenbund, um das Rutschen der Hose zu verhindern, deren Gürtel zusammen mit Schuhen, Portemonnaie und Brieftasche in der Black Box verschwand. »Reiß dich zusammen – Kopf hoch!«
Der Zuspruch bewirkte Wunder, er straffte sich, ein Ruck ging durch seine Wirbelsäule, und er saß kerzengerade auf seinem Gangplatz, die aufgeschlagene Zeitung auf den Knien, während die Stewardess ihm einen Imbiss anbot, für den das Wort Sandwich zu hoch gegriffen war. »Tomatensaft mit Pfeffer und Salz wird nur noch in Flugzeugen serviert«, dachte Buch und zerteilte die Wochenendbeilage der Zeitung mit geübtem Griff, als handle es sich um ein erlegtes Wild.
Es war ein verspäteter Honeymoon, mit dem das Ex-Ehepaar den Jahrestag seiner Scheidung oder Hochzeit feierte: Erstere lag zehn, Letztere dreißig Jahre zurück. Mit einem ramponierten Auto waren sie von New York nach San Francisco gefahren und weiter bis Yucatán, wo der Rambler – so hieß der lädierte Gebrauchtwagen – den Geist aufgab. In Mérida hatte er das Autowrack stehengelassen, statt es nach Texas zurückzuschaffen, wie es der mexikanische Zoll verlangte, und zusammen mit Judith ein Flugzeug nach New Orleans bestiegen, wo sie im French Quarter eine vorgezogene Hochzeitsnacht feierten. Ursprünglich hatten sie in Gretna Green oder Las Vegas heiraten wollen, aber das gehört in ein anderes Kapitel dieser wie ein Flussdelta verzweigten Geschichte.
»Von all unseren Orangen ist die Nase am wichtigsten« – diesen bei der Zeitungslektüre entdeckten Druckfehler hatte er in sein Tagebuch notiert, weil er eine hinter den Wörtern verborgene, tiefere Wahrheit aufblitzen ließ. H. C. Buch war Karnevalskritiker von Beruf, vergleichender Karnevalsforscher genauer gesagt: Er verglich den Karneval in Rio de Janeiro, Trinidad, New Orleans und Port-au-Prince mit dem Kölner Karneval, der Mainzer Fastnacht, dem Fasching in München und der Basler Fasnacht – auch die Echternacher Springprozession und die römischen Saturnalien bezog er in seine Untersuchungen ein. Als Mitglied des Karnevalsvereins Narhalla hatte er, mit Turban oder Fez getarnt, Strichlisten angelegt, um die Zahl der Helau- und Alaaf-Rufe zu registrieren, ebenso wie den in Dezibel gemessenen Applaus, wenn ein Büttenredner einen Witz zum Besten gab. Buch hatte Kunstgeschichte und Romanistik studiert, dazu Slawistik im Nebenfach, und er hatte gelernt, Verbindungslinien zu ziehen zwischen der von Michail Bachtin analysierten Lachkultur der Renaissance und den Gottsuchern und Narren in Christo der russischen Literatur, von Rabelais bis Gogol, Dostojewski und Tolstoj.
Seine Monographie über Jazz als Schauspiel ohne Rampe, das die Trennung zwischen Bühne und Publikum überwand, war in mehrere Sprachen übersetzt worden: Demnach war die Jazzmusik Ausdruck eines karnevalistischen Weltempfindens, das nicht nur die Hierarchie der Gesellschaft durcheinanderwirbelte, sondern auch die Dogmen der Religion, einschließlich des Glaubens an ein Leben nach dem Tod, vom Kopf auf die Füße stellte. Und seine Charakterisierung der chinesischen Kulturrevolution als blutiger Karneval hatte ihm eine Einladung nach Hongkong verschafft.
In Wahrheit hatte ihn das närrische Treiben nie interessiert, und Buch wusste selbst nicht mehr, was er gemeint hatte mit dem zum geflügelten Wort gewordenen Satz, von der Elferratssitzung zur Schwarzen Messe sei es nur ein Katzensprung, die Grätsche eines Liliputaners – oder musste es Blutgrätsche heißen? Der verordnete Frohsinn in den Hochburgen des Karnevals – schon das Wort Hochburg war eine Peinlichkeit – das Trampeln, Grölen und Schunkeln ließen ihn kalt, denn trotz der Kusshände, schlanken Beine und feschen Uniformen der Funkenmariechen hatte das, was an den tollen Tagen vom 11.11. um 11 Uhr 11 bis zum Aschermittwoch des folgenden Jahres geschah, mehr mit Alkohol als mit Sex zu tun: Die durch nackte Waden geweckte Begierde ertrank in Strömen von Billigsekt, und an die Stelle der erotischen Ausschweifung trat der Alkoholexzess.
5
Auf den ersten Blick wirkte das Kloster enttäuschend – Buch hatte es größer in Erinnerung. So wie die Helgebachstraße, in der er geboren und aufgewachsen war, ihm als Kind prächtiger vorgekommen war als die Fifth Avenue oder die Champs Elysées, konnte er das unscheinbare Gebäude nur schwer in Übereinstimmung bringen mit dem strahlenden Bild, das er in sich trug. Einzig die Marmortafel zum Gedenken an Vater Vivie, den Apostel der Radrennfahrer, war ihm vertraut, alles Übrige sah fremd und abweisend aus: Zwei mit Dachziegeln gedeckte, halbrunde Türme, verbunden durch einen Mittelgang mit Torbogen. Rechter Hand parkte ein Kastenwagen, links ein Schotterplatz, auf dem er das Mietauto abstellte im Schatten einer Feldsteinmauer, hinter der sein Französischlehrer begraben lag. Der Name des Mönchs war ihm entfallen: Hatte er Bruder Martin geheißen oder Pater Paul? War seine Kutte braun oder beige? War er in deutscher Kriegsgefangenschaft gewesen und hatte vom Gesang der Landser geschwärmt und vom Sprudelwasser, das ihm besser schmeckte als Vittel oder Perrier: »Il est bon, le sproudel!« Oder verwechselte er den Mönch mit Monsieur Henri, dem Kellner aus Sanary, der ihm Briefkuverts mit Mimosenblüten nach Berlin geschickt hatte, wo es seiner Ansicht nach das ganze Jahr über regnete? Buch nahm sich vor, der Sache auf den Grund zu gehen, und kritzelte Monsieur Henri in sein Notizbuch, während Judith vor der Pförtnerloge wartete, die nicht besetzt zu sein schien. ACCUEIL stand in Großbuchstaben über der Tür, an deren Klinke ein Pappschild hing mit der Aufforderung, sich zu gedulden. Irritierender als die geschlossene Rezeption war die auf einer Hinweistafel gegebene Information, dass La Sainte Baume, anders als Kloster Eberbach, wo Der Name der Rose gedreht worden war, nicht aus dem Mittelalter, sondern aus dem 19. Jahrhundert stammte. Nach der Christenverfolgung im Zuge der Französischen Revolution, las Buch kopfschüttelnd, hätten Trappistenmönche sich hier niedergelassen in einem als Bauernhof getarnten Kloster, das 1860 von Dominikanern übernommen worden sei, die das Gebäude renoviert und die von den Jakobinern zerstörte Grotte der Heiligen Magdalena restauriert hätten. Im Zweiten Weltkrieg hatte das zur Hotelschule umfunktionierte Kloster polnischen Nonnen und jüdischen Kindern Zuflucht gewährt, die auf diese Weise der Deportation entgingen – davon hatte Buch nichts gewusst.
Die Glocken läuteten. Es war sechs Uhr, Zeit für die Abendandacht. Er betrat die angrenzende Kapelle und kniete nieder – nicht um zu beten, das hatte er seit Jahrzehnten nicht mehr getan, sondern um die Kirchenbänke zu testen. Zu seinem Leidwesen waren sie nicht gepolstert. Er klopfte ans Fenster der Rezeption, hinter dem sich nichts regte. Die Pförtnerloge blieb dunkel, und er ging nach draußen, um das Gepäck aus dem Auto zu holen. Erst jetzt, als er den scharfkantigen Schotter unter den Schuhen fühlte – Kalksteine aus den Bergen, von Wind und Sonne zu grobem Geröll zerlegt – spürte Buch, dass er am Ziel der Reise angekommen war: Die Erinnerung hatte sich den Fußsohlen eingeprägt, sein Körper hatte ein präziseres Gedächtnis als sein Gehirn. Zum ersten Mal seit der Ankunft in La Sainte Baume hob er den Blick gen Himmel, zu dem von Nebel umhüllten Bergmassiv: Die Wolkendecke riss auf, und er sah die Grotte der Heiligen Magdalena mit der in den Fels gehauenen Kirche, hinter deren Fenster ein Licht aufflammte – oder war es der Schein der untergehenden Sonne, die sich in der Glasscheibe spiegelte?
6
H. C. Buch war ein Sünder, obwohl er, um keinen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei zu bekommen, jedes Bußgeld sofort überwies – eine moderne Form des Ablasshandels wie das Geschäft mit CO2-Emissionen, das Martin Luther angeprangert hätte, wenn er heute leben würde. Buch besaß kein Kohle- oder Atomkraftwerk, keinen Regenwald und keine Rinderherde, die mit ihren Blähungen die Erdatmosphäre aufheizte; er zahlte pünktlich seine Steuern und trennte so sorgfältig seinen Müll, dass Judith ihn als Dr. Müll verspottete.
Buch war ein Meister der Sekundärtugenden, aber es gab keine Todsünde, von der er sich nicht vorstellen konnte, sie selbst begangen zu haben. Er steckte voll krimineller Energie: Ein notorischer Ehebrecher, Lügner und Dieb, vielleicht sogar ein Mörder, denn er hatte nicht nur falsch Zeugnis abgelegt und seines Nächsten Haus, Hof und Weib begehrt. Er hatte ein Menschenleben auf dem Gewissen und fragte sich, ob es sich um unterlassene Hilfeleistung gehandelt habe oder um Schlimmeres. Aber das war history, wie Winston Churchill zu sagen pflegte – oder war es Franklin D. Roosevelt?
Buch war sich sicher, dass das Böse kein Resultat seiner Umwelt oder Erziehung war, sondern in ihm rumorte wie die Dämonen, die Christus aus dem Leib der Maria Magdalena vertrieben hatte, als die Sünderin ihm die Füße wusch. So besehen, waren die Gemälde von Hieronymus Bosch, die er im Prado bewundert hatte, keine Visionen eines krankhaft genialen, überreizten Gehirns, sondern realistische Darstellungen der Wirklichkeit: Es genügte, Suchbegriffe wie oral oder anal, Sado oder Fetisch in den Computer einzugeben, um Bilderfolgen zu sehen, im Vergleich zu denen Hieronymus Bosch ein harmloser Chorknabe war: »Seine Hände griffen lauter Henkel, / und der Schatten schob sich auf wie Schenkel / warm und zu Umarmungen erwacht«, hatte Rilke geschrieben, der letzte deutsche Dichter, der noch religiöse Anfechtungen gekannt hatte und für den Christentum mehr bedeutete als ein leeres Wort.
»Du stehst da wie ein Fragezeichen«, sagte Judith und schob ihm eine Haarsträhne aus der Stirn. Er lud das Gepäck aus dem Kofferraum, und sie folgte ihm in respektvollem Abstand, mit Plastiktüten beladen wie eine türkische Ehefrau, während Buch die Fresken in Augenschein nahm, die er beim ersten Rundgang übersehen hatte: Jugendstilfresken, wie er mutmaßte, auf denen Maria Magdalena zum Zeichen ihrer Sündhaftigkeit mit rotem Haar dargestellt war, üppig gelockt und bestens geeignet, um dem Messias die Füße zu trocknen.
Er hörte ein dezentes Räuspern, und als er sich umdrehte, stand eine schwarz gekleidete Nonne in der Tür, die Judith und ihn aufforderte, das Gepäck im Vestibül abzustellen und ihr zu folgen. Sie sprach französisch mit hartem, spanisch klingendem Akzent, passend zu ihrem dunklen Teint, und als Buch fragte, ob sie aus Südamerika komme, murmelte sie ¿como no? und nickte erfreut, wie ihm schien: »¡Soy de Barranquilla!« Es sei Essenszeit, fügte die Nonne hinzu und führte ihn durch einen gekachelten Flur zu einem gedeckten Tisch, auf dem Wasser, Wein und Brot bereitstanden. Die roten Keramikfliesen, die grünen Fensterläden, dazu die Tischdecke aus weißem Papier und der Geruch von Eau de Javel, einem in Südfrankreich gebräuchlichen Putzmittel – alles erinnerte Buch an seine Kindheit in der Provence, obwohl er nicht separiert, sondern zusammen mit den Mönchen im großen Speisesaal gegessen hatte – damals gab es noch keine Nonnen in La Sainte Baume. Die Kolumbianerin verschwand in der Küche und kehrte zurück mit einer dampfenden Terrine, aus der sie Suppe ausschenkte.
»Kressesuppe«, sagte Judith, und Buch goss Wein in ihr Glas, aber als er ihr zuprosten wollte, gebot die Schwester Oberin ihm Einhalt: Nicht die Nonne aus Kolumbien, sondern eine ältere, streng blickende Spanierin namens Sidonia, die an den Tisch getreten war und mit gefalteten Händen das Vaterunser sprach. Buch hatte das Beten verlernt, und bei dem Satz »Und vergib uns unsere Schuld/ wie auch wir vergeben unseren Schuldigern« verhedderte er sich. Doch das fiel niemandem auf, weil die Schwester Oberin nur gebrochen französisch sprach. Sie wünschte ihnen guten Appetit, und er nahm sich vor, den Text des Gebets im Computer zu checken. Oder war die Übersetzung von Martin Luther überholt, und Walter Jens hatte das Vaterunser verschlimmbessert und verkitscht?
7
H. C. Buch schlief traumlos und tief, ohne nachts zur Toilette zu müssen. So gut hatte er seit Wochen nicht mehr geschlafen, und körperliches Wohlbefinden, das mehr war als bloße Wellness, durchströmte ihn, als er den Fensterladen aufstieß und ins goldbraune Laub einer Eiche blickte, von der trockene Blätter rieselten, eingerahmt vom Fenstergeviert, mit Feldsteinen beschwerten Ziegeln und einer verzinkten Dachrinne, in der eine Dohle planschte. Dahinter gelbrot geflammte Wälder und das graue Massiv von La Sainte-Baume, angestrahlt vom Schein der Morgensonne, die den durch die Täler wabernden Nebel überwand. Buch kniete nieder und verrichtete seine Morgenandacht, bestehend aus Kniebeugen, deren Zahl er von dreißig auf vierzig steigerte – genau genommen kein Gottesdienst, sondern eine Leibesübung, die der Austreibung niederer Dämonen und damit seiner seelischen Gesundheit diente. Schwer atmend stellte er die Dusche von heiß auf kalt, während seine Ex-Frau eine Etage tiefer ihren Morgenkaffee trank. Anschließend würde Judith barfuß vor die Tür treten und im Lotussitz auf taufrischem Gras Yogaübungen machen, bei denen er sie nicht stören durfte.
Er verließ durch die Hinterpforte das Haus und streifte durch den Klostergarten. Das Wort Ratzefummel meldete sich zurück, während er die Namen auf windschiefen Kreuzen und verwitterten Grabstelen zu entziffern suchte, die halb eingesunken aus der bemoosten Erde ragten. Ratzefummel hatte sein Enkelsohn gerufen, als Buch ihm einen Vierfarbstift mit Radiergummi zum Geburtstag schenkte – dieses Wort hatte er seit einem halben Jahrhundert nicht mehr gehört. Die alles nivellierende Zeit hatte nicht nur die Namen von den Grabsteinen, sondern auch den Aufenthalt in La Sainte Baume aus seinem Gedächtnis radiert. Ratzefummel war der richtige Ausdruck dafür, ein Kindheitswort, das vergessene Erinnerungen heraufbeschwor, abgesunkenes Kulturgut wie der Film Liane,das Mädchen aus dem Urwald