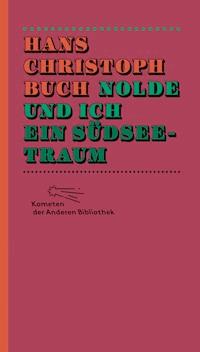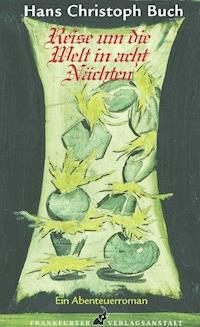
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hans Christoph Buch ist der große Reisende unter den deutschen Schriftstellern. Jetzt legt er einen neuen abenteuer- und Reiseroman vor, voller unterhaltsamer Geschichten. Wir begleiten den namenlosen Erzähler, einen furchtlosen und kritischen Beobachter, auf acht seiner Reisen. In Mumbai bewegt sich der Erzähler durch die Rotlichtbezirke der Stadt, er ist gleichermaßen angezogen und abgestoßen vom Schmutz und vom billigen Sex an jeder Ecke. Eine Minderjährige bietet sich ihm an, um ein Haar gibt er einem seltsamen Verlangen nach. Er begleitet einen arzt und HIV-Experten, der ihn mit dem ganzen Elend der Prostitution konfrontiert. In der Hitze ein nicht enden wollendes Hupkonzert, die abgase formen schwere Wolken, darüber steht die flirrende Sonne. Weiter reisen wir nach Islamabad, folgen dem Erzähler auf seiner Suche nach einem halbwegs legalen Whiskey und dem verschwundenen deutschen Kriegsreporter Kapruner. Zusammen mit einer kleinen deutschen Kulturdelegation kommen wir nach Beijing und Shanghai, sitzen mit ihm in der Kälte im Packeis der Antarktis fest, delirieren in der Hitze des Senegals und des Kongo und landen inmitten der Wirren eines Putsches auf Haiti. Entstanden ist ein lebendiger und humorvoller Reiseroman, der die Welt abseits bekannter touristischer Ziele ebenso liebevoll wie aufmerksam beobachtend beschreibt. Eine Travestie und Burleske, eine abenteuerliche Reise um die Welt in acht Nächten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Christoph Buch
REISEUM DIE WELTIN ACHT NÄCHTEN
Ein Abenteuerroman
1. Auflage 2009© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH,Frankfurt am Main 2009Alle Rechte vorbehaltenHerstellung und Umschlaggestaltung: Laura J GerlachUmschlagmotiv: Neo RauchSatz: Fotosatz Reinhard Amann, AichstettenDruck und Bindung: GGP Media GmbH, PößneckPrinted in GermanyISBN: 978-3-627-00164-3
ERSTES BUCH: DER SCHWARZE DAMPFER
Prolog: Bildbeschreibung
Erste Nacht: Taj Mahal-Hotel, Bombay, Indien
Zweite Nacht: United Nations Club, Islamabad, Pakistan
Dritte Nacht: Hotel für nationale Minderheiten, Beijing, China
Vierte Nacht: Eisbrecher Almirante Irizar, Deception Island, Antarctica
ZWEITES BUCH: ICH TARZAN, DU JANE
Fünfte Nacht: Hôtel de la Poste, Saint Louis, Senegal
Sechste Nacht: Hôtel Tombouctou, Timbuktu, Mali
Siebente Nacht: Morgan’s Guest House, Ituri-Provinz, Kongo
Achte Nacht: Hôtel Brise de Mer, Cap Haitien, Haiti
Epilog
ERSTES BUCH: DER SCHWARZE DAMPFER
PROLOG: BILDBESCHREIBUNG
In der linken oberen Ecke des achtzig Zentimeter hohen und einen Meter breiten Gemäldes ist eine wie eine Niere geformte Wolke zu sehen, aus der ein Lichtkegel auf eine Kaimauer fällt; hinter dieser ragt ein Leuchtturm empor, bei dem es sich auch um den Geschützturm eines im Hafen ankernden Zerstörers handeln könnte. Am rechten Bildrand eine Strandpromenade, flüchtig skizzierte, nur durch Umrisse angedeutete Häuser und Hotels, gruppiert um eine im Schatten dämmernde Kirche, über die sich ein Getreidesilo erhebt.
Im Mittelpunkt des Bildes steht die das Hafenbecken umschließende Bucht, am unteren Bildrand links ein Streifen gelber Sand mit einem zum Meer schauenden Menschenpaar: Die Frau trägt einen Regen- oder Sonnenschirm und ein helles Kostüm, wie es in der Belle Époque Mode war, während ihr Begleiter, ein braun gekleideter Herr, ein Fernglas ans Auge führt. Am unteren Bildrand rechts ist ein zinnoberrotes Zelt aufgeschlagen, vielleicht ein Strandkorb, vor dem ein Mann im dunklen Anzug auf einem Liegestuhl sitzt, in die Lektüre einer aufgeschlagenen Zeitung vertieft. Auf halbem Weg zwischen dem Zeitungsleser und dem Eheoder Liebespaar sind gebückte Männer in weißen Hosen zu sehen, die Austern oder Schnecken von durch die Ebbe freigelegten Steinen klauben, und auf der Mittelachse des Bildes, noch immer am unteren Rand, steht mit wehender Jacke, auf den ersten Blick kaum zu erkennen, der Künstler vor seiner Staffelei und malt.
Er blickt auf das mit Schaum gesprenkelte, in Wellen anbrandende Meer, durch das auf halber Höhe eine Frau im schwarzen Badeanzug schwimmt, während im Vordergrund rechts ein Mann mit blauer Hose ins Wasser watet, um eine Reuse auszulegen oder einzuholen – das ist nicht genau zu erkennen. Das Zentrum des Gemäldes wird von einem schwarzen Dampfer eingenommen, der mit voller Kraft, wie es scheint, auf den Betrachter zufährt, umhüllt von einer düsteren Wolke, die wie ein schwarzes Loch die auf dem Bild vorhandene Materie aufsaugt und in Antimaterie verwandelt, bis nichts mehr übrig bleibt von Kaimauer und Strandpromenade, Leuchtturm und Kirche, Muschelfischern, Touristen und von dem Künstler an seiner Staffelei.
Der Sinn des Ganzen ist leicht zu erschließen, die Botschaft liegt auf der Hand, denn dies ist das letzte Bild, das Raoul Dufy, nachdem er sein Leben lang Seestücke, Hafen- und Strandszenen gemalt hatte, vollendete, kurz bevor er im März 1953 starb: Le cargo noir – der schwarze Dampfer – heißt das verstörende Gemälde, das im Lyoner Kunstmuseum hängt, und als sei der Titel nicht schon sprechend genug, hat der Künstler sein Werk so kommentiert: »Le soleil au zénith, c’est le noir; on est ébloui, on ne voit plus rien« – die Sonne im Zenit ist schwarz, man ist geblendet, man sieht nichts mehr . . .
ERSTE NACHT:TAJ MAHAL-HOTEL, BOMBAY, INDIEN
»My officer’s hands can see me in the dark . . .«
(Indische Whiskyreklame)
1
Als ich aus dem Taj Mahal-Hotel in Bombay auf die Straße trat, sprach mich eine Blumenverkäuferin an, die Maria hieß, aber keine Jungfrau mehr war. So etwa könnte das erste Kapitel meines Romans beginnen. Aber so einfach ist es nicht, denn die Geschichte hat viel früher angefangen, und während ich diese Sätze zu Papier bringe, schreibt sie sich selber fort – wie die sich unaufhörlich aus sich selbst hervorbringende und wieder in sich selbst zurücknehmende Brandung des Indischen Ozeans. Wie soll ich dem Leser die Gerüche und Geräusche des Straßenverkehrs von Bombay vermitteln, das nicht enden wollende Hupkonzert und die Wellen von Hitze und Wolken von Autoabgasen, durch die ich mir hustend einen Weg bahne, verfolgt von Taxifahrern und Touristenführern, die mir unverständliche Obszönitäten nachrufen, betäubt vom Lärm der Lastwagen und Busse, die mit verbranntem Dieselöl die Luft verpesten, und geblendet von dem durch Smog gefilterten, flirrenden Sonnenlicht, das Häuser, Straßen und Plätze wie Leopardenfelle sprenkelt und Autos, Motorroller und Rikschas mit einer schlierigen oder schmierigen Staubschicht überzieht. Mein Hemd ist nass geschwitzt, als ich in den kühlen Schatten des Gateway of India eintauche und mich aufatmend an eine der in den Bergen von Ghat gebrochenen Basaltsäulen lehne. Das dreiflügelige Tor, durch dessen Mittelgang der König von England, George V., am Arm seiner Gattin geschritten sein soll, weist aufs Meer hinaus, über das griechische, persische, portugiesische und britische Eroberer kamen, um Indien zu unterjochen; der Subkontinent lag ihnen zu Füßen, und das Gateway of India bezeichnete den Punkt, an dem das besiegte Land die Schenkel spreizte, um die fremden Herren ungehindert eindringen zu lassen. Unter einem ziselierten Spitzbogen, der besser in einen gotischen Dom gepasst hätte, stand ein braunes Mädchen mit Blumengirlanden im Arm, deren weiße Blüten mit seinem schwarzen Haar kontrastierten; die Kleine lächelte mich an, schüchtern, wie mir schien.
»Wie heißt du?«
»Ich heiße Hans. Und du?«
»Maria. Ich bin Christin.« Zum Beweis spreizte sie die rechte Hand, auf die, zwischen Daumen und Zeigefinger, ein Andreaskreuz tätowiert war.
»Was machst du hier?«
»Ich verkaufe dir Blumen.«
»Ich brauche keine Blumen.«
»Dann gib mir Geld.«
»Wie viel?«
»Das liegt an dir. Ich bin keine Bettlerin. Warte einen Augenblick!«
Sie verschwand im Schatten einer Säule und kam erst wieder zum Vorschein, als ein Polizist außer Sichtweite war, der mit unter dem Arm geklemmtem Bambusstock die Durchfahrt inspiziert hatte.
»Hier bin ich wieder. Gib mir etwas. Oder kauf Blumen von mir.«
»Ich kaufe keine Blumen. Warum hast du Angst vor der Polizei?«
Sie lächelte. Wenn Inder sich unsicher fühlen, lächeln sie.
»Gib mir Geld. Ich muss Milchpulver kaufen für meinen kleinen Bruder.«
»Was kostet das Milchpulver?«
»Hundert Rupien.«
»Das ist viel Geld.«
»Ein halbes Kilo kostet nur fünfzig Rupien.«
»Wie alt ist dein kleiner Bruder?«
»Zwei, nein, er ist erst anderthalb.«
»Und wie alt bist du?«
»Ich bin fünfzehn, nein, sechzehn Jahre alt.«
»Du lügst. Du bist höchstens dreizehn.«
Wieder lächelte sie.
»Du bist ein hübsches Mädchen.«
»Das sagen alle Ausländer. Ich hätte lieber helle Haut wie du. Bist du Japaner?«
»Nein, Deutscher.«
»Du lügst.«
»Woher weißt du das?«
»Du siehst nicht wie ein Deutscher aus. Deutsche haben blaue Augen und blondes Haar.«
»Ich lade dich zu einem Glas Fruchtsaft ein. Oder möchtest du lieber einen Milkshake?«
»Das geht nicht. Ich bin noch zu jung, um in eine Bar zu gehen – schon gar nicht in Begleitung eines Ausländers. Komm mit mir!«
Sie nahm mich an der Hand, und das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, steigerte die Erregung, die ich empfand, während sie mich durch Hinterhöfe und gewundene Durchgänge, vorbei an schwelenden Abfallhaufen zu einem mit Plastikmüll übersäten Strand führte, auf dem streunende Hunde schnüffelten und Krähen hin und her hüpften. Ein penetranter Geruch nach Scheiße lag in der Luft. Ich presste mir ein Tempotaschentuch vor die Nase. »Hier«, sagte Maria und blieb vor einem nach Urin stinkenden Bauzaun stehen, »hier sieht uns keiner. Gib mir ein Taschentuch. Soll ich es mit der Hand oder mit dem Mund machen?«
2
Am Tag zuvor war ich, aus Berlin kommend, am Frankfurter Flughafen umgestiegen in die Lufthansa-Maschine nach Mumbai, das damals noch Bombay hieß. Obwohl die Stewardess mich nach Vorlage meiner Miles-&-More-Karte auf Business Class umgebucht hatte, wo die Beinfreiheit größer war als in der Touristenklasse, fiel es mir schwer, mich auf den in Fraktur gedruckten Text zu konzentrieren, den ich aus einem alten Buch fotokopiert hatte, um ihn während des Fluges zu lesen.
»Der Anblick Bombays vom Meer her ist äußerst malerisch«, hieß es im Baedeker von 1886: »Links erhebt sich das Fort, rechts Inseln, mit grünen Pflanzungen geschmückt; tiefer unten erblickt man den Hafen mit seinem Leuchtturm, im Hintergrund die im Dunst verschwimmenden Konturen der Ghats. Es gibt ein deutsches Konsulat, eine anglikanische und eine katholische Kirche, eine Synagoge, einen botanischen Garten und Hospitäler für Christen, Moslems und Hindus (auch für Tiere). Die Europäer wohnen inmitten üppiger Gärten auf dem Malabar Hill, auf dessen höchstem Punkt sich die Türme des Schweigens befinden, wo die Parsen ihre Toten bestatten.«
»Alles genau wie damals«, sagte ein neben mir sitzender Biochemiker aus Bombay, der bei Bayer Leverkusen in Köln angestellt war und nach zwölf Jahren zum ersten Mal seine Heimatstadt wieder besuchte. »Alles genau wie damals – nur die Einwohnerzahl hat sich verdoppelt, und die Abwässer von sechzehn Millionen Menschen fließen ungeklärt ins Meer.«
»Mitsamt der Scheiße«, rief ein am Fenster sitzender deutscher Geschäftsmann, der nach eigenem Bekunden Bombay wie seine Westentasche kannte. Er esse lieber Basmati-Reis als Pommes frites, fügte er nach einer Pause hinzu, aber der Inder hatte ihn falsch verstanden und fragte: »Mit oder ohne Mayonnaise?«
Bevor das Missverständnis aufgeklärt werden konnte, setzte der Airbus zur Landung an.
3
Das Hotelzimmer war kalt wie eine Tiefkühltruhe, aber in dem mit tropischen Stauden bepflanzten Innenhof war es schwülwarm, und ich zog das Jackett wieder aus, das ich nach dem Duschen übergestreift hatte, und nippte an dem von einem Sikh mit schwarzem Turban servierten Willkommensdrink, Mango-Lassi mit Old Monk – so hieß der indische Rum. Beim Hinaustreten auf die Straße zuckte ich zurück vor der feuchtheißen Luft, die Krischna, Kali oder wer auch immer für das indische Wetter zuständig war, mir wie ein nasses Handtuch um die Ohren schlug. Schon nach wenigen Schritten war ich in Schweiß gebadet, während ich, umkurvt von hupenden Autos, einen breiten Boulevard überquerte und mich in labyrinthischen Gassen verlief, ohne zu wissen, ob ich mich in einem Basar, einem Slumviertel oder einem Rotlichtbezirk befand. Reste von Bürgersteigen waren zu erkennen, Schlammpfützen, die ich weiträumig umschlich, Wellblechhütten und ein nicht zu Ende gebautes Haus, hinter dessen Gitterfenster ein nacktes Kind Grimassen schnitt. Eine Frau wrang einen Sari aus, ein Bettler spuckte Blut, bei dem es sich auch um Betelnusssaft handeln konnte, und auf einem Flachdach bauschten sich weiße Bettlaken, während aus einem defekten Kanalrohr schwarzes Wasser über meine Schuhe schwappte.
Hier sollte Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz neu schreiben, dachte ich, während ich die Inschriften auf Ladenschildern und Namen von Geschäften in mein Ringbuch notierte: All India Fisherman’s Bank – Eros Beauty Saloon – Shiva’s Water Supply – Thumbs Up Tandoori Chicken – No Photographs Please. Beim Gedanken an Günter Grass und Salman Rushdie klappte ich den Notizblock zu und bat einen schmutzig grinsenden Typ, der sich an meine Fersen geheftet hatte, mich zum India Gate zu geleiten, ohne zu wissen, ob der verdächtig aussehende junge Mann ein Dieb oder ein Zuhälter war – vermutlich beides zugleich.
4
»Gib mir ein Taschentuch. Hier sieht uns keiner. Soll ich es mit der Hand oder mit dem Mund machen?«
»Du sollst gar nichts machen. Hier sind hundert Rupien, damit du für deinen kleinen Bruder Trockenmilch kaufen kannst. Der Rest ist für dich«, hörte ich mich sagen, und im selben Augenblick bereute ich meinen Entschluss. Aber es war zu spät, denn Maria – falls sie wirklich so hieß – war geistesgegenwärtiger als ich, riss mir das Geld aus der Hand und verschwand genauso schnell, wie sie aus dem Nichts aufgetaucht war. Einem spontanen Impuls folgend, rannte ich hinter ihr her, aber beim Verlassen des Gateway of India traten mir zwei mit Bambusstöcken bewehrte Polizisten in den Weg und wollten wissen, wen oder was ich suchte. »Es gibt viele Blumenmädchen in Bombay«, sagte einer der beiden, während der andere in meinen Papieren blätterte, »warum muss es unbedingt diese eine sein?«
Der Polizist pfiff anerkennend durch die Zähne beim Anblick des amerikanischen Visums in meinem Pass. »Sie kennen die Welt«, fügte er hinzu, nachdem sein Kollege sich entfernt hatte, »und Sie sollten wissen: Nicht überall, wo Maria draufsteht, ist Maria drin. Hier ist meine Telefonnummer. Wenn Sie Sex mit Minderjährigen wollen, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich!« Er befeuchtete mit der Zungenspitze seinen Schnurrbart, als spreche er von einer kulinarischen Spezialität, und gab mir augenzwinkernd den Pass zurück.
5
Als ich an der Rezeption des Taj Mahal-Hotels den Zimmerschlüssel verlangte, reichte mir der Nachtportier einen Zettel mit der Nachricht »Dr Gilada has called / Will call again«. Früh am Morgen hatte ich vergeblich versucht, Dr. Gilada zu erreichen. »Welchen Dr. Gilada wollen Sie sprechen«, hatte die Sekretärin der Universitätsklinik am Telefon gefragt, als gäbe es mehrere Ärzte, die so hießen, Gilada junior und senior vielleicht. Oder war es eine zufällige Namensgleichheit?
»Ich möchte den Aids-Spezialisten sprechen!«
»Etwas Geduld, bitte.« Als ich Dr. Gilada beim dritten Versuch endlich erreichte, wurde das Gespräch, noch bevor ich Zeit gefunden hatte, ihm mein Anliegen vorzutragen, mitten im Satz unterbrochen durch eine technische Panne oder durch höhere Gewalt. Jetzt aber klingelte, als ich den Duschraum betrat, um mir den Dreck der Millionenmetropole vom Leib zu spülen, hektisch das Telefon, und die Rezeptionistin teilte mit, ein Dr. Gilada warte in der Hotelhalle auf mich.
»Auf der Falkland Road leben und arbeiten 70 000 Prostituierte – die genaue Zahl kennt keiner«, sagte der aus einer Brahmanenfamilie stammende Arzt, der Bedürftige kostenlos behandelte und ein Programm zur Eindämmung der Aids-Epidemie ins Leben gerufen hatte: Die Frequenz der Sexualkontakte im Rotlichtmilieu sei so dicht, dass die Seuche sich explosionsartig ausbreite. Erst kürzlich – Dr. Gilada nippte an seinem Tee – erst kürzlich sei ein Geschäftsmann aus einem Bürohochhaus in den Tod gesprungen, weil er seine Frau und sein neugeborenes Baby mit Aids infiziert habe. »Sechzig Prozent aller sex workers sind HIVpositiv, Tendenz steigend, aber nur ein Zehntel wird statistisch erfasst, medizinisch untersucht und mit Kondomen oder Medikamenten versorgt. Polizei und Behörden sind bestochen oder schauen weg.« Dr. Gilada nahm die Brille ab, schloss die Augen und rieb eine wie ein Fragezeichen gekrümmte Falte über seiner Nasenwurzel.
6
Wir fuhren im Auto des Doktors in den Rotlichtbezirk von Bombay, der sich von der Falkland Road in die angrenzenden Straßen erstreckte – eine No-Go-Area und ein Staat im Staate, der eigenen Gesetzen unterlag. Links ein Meer von Kerzen in einem Hindutempel, vor dem Kinder anstanden, um sich Hände und Gesichter bunt färben zu lassen – morgen war das Fest der Freude, und an den Straßenecken lauerten Jugendliche, die sich einen Spaß daraus machten, Vorübergehende mit roter und gelber Farbe zu beschmieren. Rechts eine Moschee, in deren grüner Dämmerung Moslempatriarchen mit bestickten Mützen und langen Bärten knieten und mit hochgereckten Hintern beteten, die Köpfe nach Westen, in Richtung Mekka, gewandt.
»Wir arbeiten mit den Puffmüttern zusammen«, erläuterte Dr. Gilada, während er von der Hauptstraße abbog und den Wagen durch ein unübersichtliches Gewirr enger Gassen steuerte. »Herbergsmutter ist ein besseres Wort dafür. Die Phais sind ältere Prostituierte, die zwischen zehn und hundert sex workers betreuen. Sie kontrollieren Einnahmen und Ausgaben, schlichten Streitfälle, kümmern sich um Essen und Kleidung, sorgen für ein Minimum an Hygiene und sind eine Art Mutterersatz, weil sie die Sorgen und Nöte der Mädchen am besten kennen.«
Einem ungeschriebenen Gesetz zufolge kämen die sex workers stets von außerhalb, fuhr er fort, in diesem Fall aus Nepal oder aus Bangladesh. Kleine Kinder würden von ihren Eltern verkauft, an Schlepperbanden vermietet und von Zuhältern zur Prostitution gezwungen. Die meisten hätten nie eine Schule besucht und nur gelernt, ihren Freiern zu Willen zu sein, ganz egal, was die von ihnen verlangten.
»Von einundzwanzig untersuchten Patientinnen sind achtzehn HIV-positiv«, rief Dr. Gilada und schwenkte einen gelben Briefumschlag, der die Testergebnisse eines einzigen Tages enthielt. Die Angst vor Aids habe zu Umsatzeinbußen geführt, aber statt kostenlose Kondome zu benutzen, wichen die Kunden zur Victoria Station aus, wo käuflicher Sex billiger sei als auf der Falkland Road.
Am Vortag hatte ich den Bahnhof besucht, und der einstige Stolz des Britischen Empire war mir wie der Einstieg zur Hölle erschienen: Vorortbahnen mit offenen Waggons, in denen die Passagiere wie Vieh zusammengepfercht reisten, und Überlandzüge mit abgeschabten Holzbänken – Polstersitze gab es nur in der ersten Klasse. Noch ekelerregender als der Zustand der Bahnhofstoilette war der Gestank des das Gelände umschließenden Gitterzauns, an dem Tausende von Männern ihr Wasser abschlugen – die Harnsäure hatte die Eisenstäbe verätzt.
»Haben die Freier keine Angst vor Aids?«
»Viele von ihnen sind Analphabeten, Slumbewohner oder Tagelöhner aus der Provinz. Ihre Lebenserwartung ist kurz – denen ist alles egal.«
7
Der Wagen hielt vor einem offenen Abwasserkanal, über dem wie ein Trauerflor eine Wolke von Mücken schwebte, und Dr. Gilada besprühte meine Unterarme mit Moskitospray – zum Schutz vor Malaria, wie er erklärte: Das Gerücht, die Anopheles-Mücke übertrage HIV, sei purer Aberglaube. Kloakengeruch stieg mir in die Nase, und wir durchquerten einen Hinterhof, vorbei an kindlich wirkenden Prostituierten, in Käfigen oder auf die Straße geschobenen Gitterbetten zur Schau gestellt, während ich, ohne ihr Lächeln zu erwidern, das stockfleckige Gebäude betrat. Der Anblick hatte nichts Verführerisches, nur unendliche Traurigkeit und Müdigkeit lag auf den Gesichtern der Mädchen, die uns mit blass gepuderten Wangen, frisch gewaschen, frisiert und parfümiert, im Empfangsraum des Bordells erwarteten, artig aufgereiht vor einem Nylonvorhang, hinter dem gerade ein Kunde abgefertigt wurde. Unterdrücktes Stöhnen war zu hören, dazu leises Klirren von Halsketten, Armreifen und Ohrringen aus echtem oder falschem Gold, während die Puffmutter eine Lichterkette anknipste über dem mit Plastikblumen geschmückten Hausaltar. Der Schein bunter Glühbirnen glitt über Poster indischer Filmstars und einen Kalender mit dem Panorama eines Bergsees, in dem sich ein Himalaya-Gletscher spiegelte, während die Phai uns die Mädchen vorstellte, von denen das älteste gerade mal zwanzig war. Das jüngste war angeblich sechzehn, sah aber wie vierzehn aus, ein halbes Kind, das dankbar lächelnd aus der Hand des Arztes sein Todesurteil entgegennahm, ein mit dem Vermerk POSITIV gestempeltes Formular. Im besten Fall habe sie noch fünf Jahre zu leben, flüsterte Dr. Gilada mir zu: Sie werde noch ein, zwei Jahre lang ihren Beruf ausüben und Männer, die keine Kondome benutzten, mit HIV infizieren, das andere auf sie übertragen hätten. »Die Mehrzahl der Prostituierten weiß Bescheid und ist über das Risiko informiert, aber bei acht bis zehn Freiern pro Nacht ist es unmöglich, die Ansteckung zu vermeiden.«
Ein paar Meter weiter war der Eingang zum nächsten Bordell, in dem drangvolle Enge herrschte. Es roch wie in einer Umkleidekabine, eine schwer erträgliche Mischung aus Körperausdünstungen und süßlichem Parfüm, überdeckt vom Duft der Räucherkerzen, die der Gehilfe der Phai, ein Eunuche, bei meinem Eintritt entzündete und auf einem dem Glücksgott Ganesch gewidmeten Altar deponierte. Im Fernsehen lief ein Bollywood-Musical ohne Ton, unterbrochen von Werbespots, und hinter einem zugezogenen Vorhang drang Gelächter hervor. »One moment, I have a customer here«, sagte eine junge Frau mit verschwitztem Gesicht und schlang sich ein Handtuch ums nasse Haar, während Dr. Gilada ihren Hals befühlte. Die Mandeln waren dick geschwollen, und der Arzt ermahnte sie, regelmäßig Antibiotika einzunehmen, um die Infektion unter Kontrolle zu halten. Zum Abschied übergab er der Puffmutter drei Schuhkartons mit in Plastik eingeschweißten Kondomen, deren Gebrauch er in Englisch und Hindi erläuterte, und nahm allen Anwesenden das Versprechen ab, keinen ungeschützten Sex mehr zu gestatten, während die Phai seine Worte auf Kannada und Marathi übertrug.
Auf dem Weg zum Auto kamen wir an einer Phalanx wartender Männer vorbei, die bis zur Straßenecke Schlange standen, um in einem durch Vorhänge abgeteilten Verschlag, kaum größer als eine Hundehütte, ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Fliegende Händler boten Speisen und Getränke an, während die Prozession Meter um Meter vorrückte; kaum hatte ein Kunde seine Verrichtung beendet und zog sich die Hosen hoch, stand schon der nächste in der Tür. Die von der Akkordarbeit erschöpften Mädchen saßen oder lagen auf Bettgestellen im Hof, von männlichen Blicken taxiert, zogen Lidschatten nach oder legten Rouge auf, um sich auf die Nachtschicht vorzubereiten.
8
Ich wollte wissen, warum die Menschen hier sehenden Auges dem Tod entgegengingen, aber Dr. Gilada kam meiner Frage zuvor. »Hindi Fatalism«, wisperte er und steckte einem das Auto bewachenden Straßenkind eine Münze zu: »Der Glaube, dass Tod und Wiedergeburt von Ewigkeit vorherbestimmt sind und niemand dem rollenden Rad in die Speichen greifen darf. Die Schicksalsergebenheit ist Indiens gefährlichster Feind!«
Dr. Gilada beugte sich über den Beifahrersitz und entriegelte die Tür, da spürte ich einen heißen Atem im Nacken und schaute, als ich mich erschrocken umdrehte, in ein grell geschminktes Gesicht mit schwarz umrandeten Augen, die, so schien es mir in diesem Augenblick, auf den Grund meiner Seele blickten. Eine mit Ringen geschmückte Hand, deren Haut sich rau anfühlte, streichelte meinen Unterarm, der Duft von Patschuli stieg mir in die Nase, und eine tiefe Stimme, deren rauchiger Klang mich gegen meinen Willen erregte, hauchte mir ins Ohr: »Follow me. My name is Sheela. I will make you happy!«
»This man is no customer, he is a doctor!«, rief die Puffmutter dazwischen, meine Verfolgerin zuckte zurück, ich setzte mich ins Auto und zog die Tür hinter mir zu. Dr. Gilada steckte den Zündschlüssel ins Schloss und schaltete den Motor ein. Der Schreck saß mir in den Knochen. »Wer oder was war das?«, fragte ich aus sicherer Entfernung, als wir Kamathipura verlassen hatten – so hieß der Rotlichtdistrikt.
»Kein Eunuche, auch kein Transvestit oder Transsexueller, obwohl von all dem etwas in ihnen steckt. Hijras sind Männer, die Frauenkleider tragen und ihr Leben der Liebe weihen. Früher gaben sie sich in Tempeln den Gläubigen hin, heute gehen sie auf den Strich. Die Hijras haben die höchste Aids-Rate aller sex workers – ANAL PENETRATION, verstehen Sie?«
Ich wusste nicht, was oder wie mir geschah, mein Atem ging stoßweise, mir wurde schwindlig. »Ist Ihnen nicht gut? Kein Wunder bei der Luftfeuchtigkeit! Der Monsun macht müde und verursacht Kopfschmerzen.« Dr. Gilada stoppte vor der Auffahrt des Hotels. Halb betäubt stieg ich aus dem Auto, das mit blinkenden Rücklichtern im Dunkel der Nacht verschwand. Die Drehtür beförderte mich ohne mein Zutun in die Hotelhalle, wo der Portier mir den Zimmerschlüssel aushändigte, und ich fiel erschöpft ins Bett. Nein, das war kein Schwächeanfall – eine überpersönliche Macht hatte Besitz ergriffen von mir, ein rauschhaftes Verlangen, das meinen Herz- und Pulsschlag beschleunigte, und es dauerte lange, bis ich mir, pendelnd zwischen Ekel und Erregung, mein sexuelles Begehren eingestand. »Follow me. My name is Sheela. I will make you happy.«
Der Blick der schwarz umrandeten Augen hatte mich verhext, und eine rasende, nein: tobsüchtige Geilheit überschwemmte mich wie die Brandungswelle eines tropischen Ozeans. Dr. Gilada hatte von analer Penetration gesprochen. Das war es: Ich wollte dem Liebesgott – oder war es eine Göttin? – mein Sperma ins Arschloch spritzen, und nur die Angst vor Aids hatte mich davon abgehalten, es zu tun.
9
Früh am Morgen fuhr ich mit dem Taxi zum India Gate. Trotz des sanften Winds, der die Wogen kräuselte, war es drückend heiß, als ich das am Fuß der Treppe ankernde Boot bestieg, das mich zu den Elephant Caves befördern sollte. Der Hindutempel stand auf einer der Küste vorgelagerten Insel, benannt nach den Kolossalstatuen zweier Elefanten, die beim Abtransport ins Wasser gefallen und später vom Meeresgrund geborgen und im Victoria and Albert Museum aufgestellt worden waren. Oder hatten portugiesische Piraten die Skulpturen geraubt?
Ich drückte dem Fährmann meinen Obolus in die Hand und nahm auf der Rückbank des Bootes Platz. Der Schiffsführer, eine indische Inkarnation des Totengottes Charon, der die Verstorbenen ins Schattenreich übersetzt, schnalzte mit der Zunge und machte die Leine los. Die Sonne brannte mir ins Genick und tanzte auf den Wellen der von den Abwässern der Sechzehnmillionenstadt verdreckten Bucht. Ich fühlte mich wie der einsame Passagier auf dem Bild von Böcklin, der beim Anblick der Toteninsel den Mantel enger um sich zieht, und trotz der Hitze fröstelte ich. Nur die vor der Küste ankernden Containerschiffe passten nicht in das antike Szenario, so wenig wie ein stahlgrauer Zerstörer, an dem unser Kahn vorüberglitt, und ein Schnellboot der Küstenwache, dessen Besatzung mir mit rudernden Armen signalisierte, dass Fotografieren verboten sei. Hinter meinem Rücken versank die Skyline von Bombay im grauen Dunst: Abgase von Taxis, Bussen und Lastwagen der Marke Tata, deren Firmenlogo – vom Zementsack bis zur Warenhauskette – in Indien allgegenwärtig war. Die Kanonen des die Hafeneinfahrt bewachenden Forts zielten auf den Indischen Ozean, hierzulande Arabischer Ozean genannt, weil die Gefahr stets von jenseits des Meeres kam.
Das Boot kreuzte eine Pipeline, die zu einer Plattform mit Ölraffinerie führte, an der Supertanker ihre Ladung löschten. DANGEROUS CARGO – DON’T SMOKE stand auf Warnschildern, über denen öliger Rauch aus Feuer speienden Schloten quoll. Dann kam Elephanta in Sicht, ein felsiges Eiland, von dessen tropischer Vegetation nur Trockenwald übrig geblieben war: kahle Bergflanken, Dornbüsche, abgestorbene Mangroven, an denen Plastikfetzen hingen. Eine Neonröhre schwamm vorbei, und ich fragte mich, warum die natürliche Elektrizität des Meeres die Lampe nicht aufleuchten ließ. Kinder planschten im flachen Wasser, das, anders als in Bombay, durchsichtig war bis auf den Grund.
10
Das Boot hatte am Pier angelegt, und ich stieg auf breit ausgehauenen Felsstufen zum Tempel hoch, vorbei an Kiosken, die Souvenirs und Erfrischungen feilboten. Es war drückend heiß, und ich hielt die Fremdenführer auf Distanz, indem ich weder Postkarten noch Korallenketten, weder Thumbs-Up-Limonade noch Kingfisher-Bier kaufte, sondern mich mit dem Saft einer frischen Kokosnuss begnügte.
Der Zugang zu den heiligen Grotten kostete eine halbe Rupie – weniger als zehn Cent. Der älteste Tempel stammte aus der Zeit der Tang-Dynastie, als ein buddhistischer Mönch von China nach Indien pilgerte, das damals, glaubt man seinem Bericht, von affenköpfigen Dämonen bevölkert war – eine Anspielung auf den Affenkönig Hanuman. Die jüngeren Teile der Anlage wurden unter den Gujarat-Herrschern erbaut, kurz vor Ankunft der Portugiesen, die Schießübungen mit den aus den Felsen herausgemeißelten Statuen veranstalteten, wobei sie deren Geschlechtsteile als Zielscheiben benutzten.
»Die Haupthöhle ist 39,5 m lang, 40 m breit und 4,5 m hoch«, las ich im Baedeker von 1886. »Die Decke stützen 36 fein bearbeitete Säulen aus stehen gelassenem Fels, heute stark beschädigt, und an der dunklen Hinterwand erhebt sich ein 5,5 m hohes Relief der indischen Dreifaltigkeit, das Brahma, Wischnu und Schiwa darstellt.« Hier werde der Schöpfergott in all seinen Inkarnationen verehrt, hieß es weiter: als Demiurg und Zerstörer, Erhalter und Ernährer, der das Eis des Himalaya schmelzen lässt, um Indiens Felder zu bewässern, als Familiengründer und Vater des Glücksgottes Ganesch; als Krieger, der auf dem abgeschlagenen Kopf eines Dämons tanzt, die kosmische Ordnung durcheinanderwirbelt und gleichzeitig neu erschafft, oder als Yogi, der den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt durchbricht und ins Nirwana entschwebt. Schiwa habe tausend Beinamen: Sankara, der Wohltäter, Rudra, der Zerstörer, Nataraja, der Tänzer, Daksinamurti, der Lehrmeister . . .
Ich hatte die indische Weisheit nie gemocht, deren angeblicher Tiefgang mir wohlfeil und kitschig erschien wie das Angebot eines Basars, aber ich musste mein Vorurteil revidieren, mir stockte der Atem, als ich Schiwa Ardhanarishvara gegenüberstand, dem androgynen Gott, halb Mann und halb Frau, Bewegung und Stillstand, erotische Ekstase und mystische Askese verkörpernd. Dies ist eine Welt von Leibern, mit Öffnungen, dazu bestimmt, sich ineinander zu verhaken und zu verschlingen: Das Zitat aus dem Marat/ Sade-Stück von Peter Weiss ging mir durch den Kopf angesichts der knospenden Brüste, der schwellenden Hüften und sanft gerundeten Arme, die himmlische Seligkeit und höllische Verdammnis verhießen, und das größte Wunder war die wie Marmor polierte Oberfläche des schwarzen Steins, auf dem Schweißperlen glänzten: keine optische Täuschung, sondern von der Decke tropfende Feuchtigkeit.
Die Grotte erweiterte, nein: verengte sich zu einem wie eine Vulva geformten Hohlraum, und hier, am Ausgang des Tempels, wo ursprünglich der Eingang gewesen war, erhob sich das Allerheiligste, ein Lingam aus spiegelglattem, dunkelrotem Porphyr, bei dessen Anblick ich eine Erektion bekam. Und während ich unfreiwillig meinen Samen ergoss, wurde mir klar, dass mir auf der Falkland Road kein Transvestit, sondern ein indischer Gott begegnet war.
ZWEITE NACHT: UNITED NATIONS CLUB, ISLAMABAD, PAKISTAN
»Ich habe meinen Mut erdrosselt . . .«
(Boris Vian: J’irai cracher sur vos tombes)
1