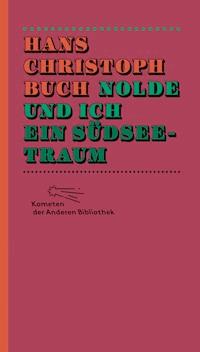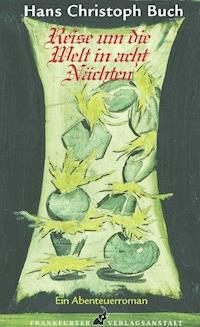Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Krick? Krack!" sagen die Märchenerzähler in Haiti, der zweiten Heimat von Hans Christoph Buch, die ihn zum Erzählen von Abenteuern und zum Abenteuer des Erzählens inspirieren. Sein "Romanbaukasten" ist Fortsetzung und Abschluss seiner autobiographischen Tetralogie und enthält Wunschbiographen von Ausonius, dem letzten lateinischen und ersten deutschen Dichter, der die Mosel besang, bis zu Monika Ertl, die den Mörder Che Guevaras erschoss. Geschichten, die tödlich enden, weil das Leben selbst sie schrieb. In diesem Sinn gedenkt H. C. Buch berühmter Vorläufer wie Alexander Selkirk, Vorbild von Defoes Robinson, und Hitlers Abwehrchef Canaris, der als Widerstandskämpfer im KZ starb. Auch literarische Zeitgenossen lässt er Revue passieren, allen voran Buch nahestehende Autoren, deren Karrieren er mit einem lachenden und einem weinenden Auge schildert, anknüpfend an die einfühlsamen Porträts in seinem hochgelobten Essayband "Tunnel über der Spree".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Krick? Krack!« sagen die Märchenerzähler in Haiti, der zweiten Heimat von Hans Christoph Buch, die ihn zum Erzählen von Abenteuern und zum Abenteuer des Erzählens inspirieren. Sein »Romanbaukasten« ist Fortsetzung und Abschluss seiner autobiographischen Tetralogie und enthält Wunschbiographen von Ausonius, dem letzten lateinischen und ersten deutschen Dichter, der die Mosel besang, bis zu Monika Ertl, die den Mörder Che Guevaras erschoss. Geschichten, die tödlich enden, weil das Leben selbst sie schrieb. In diesem Sinn gedenkt H. C. Buch berühmter Vorläufer wie Alexander Selkirk, Vorbild von Defoes Robinson, und Hitlers Abwehrchef Canaris, der als Widerstandskämpfer im KZ starb. Auch literarische Zeitgenossen lässt er Revue passieren, allen voran Buch nahestehende Autoren, deren Karrieren er mit einem lachenden und einem weinenden Auge schildert, anknüpfend an die einfühlsamen Porträts in seinem hochgelobten Essayband »Tunnel über der Spree«.
»Hans Christoph Buch hat nicht nur einen unverwechselbaren Ton, sondern er führt in jedem seiner Romane vor, was Literatur kann: Dinge beschreiben, die unbeschreiblich sind.« Deutschlandfunk
Inhalt
Erschossen im Morgengrauen. Vorspann
Ich, Ausonius
So schreiben wie hier und jetzt (1)
Weit weg und lange her
Okidoki (1)
Robinsons Rückkehr
Fortschreibung meiner selbst (1)
Aus dem Leben meines Urgroßvaters
So schreiben wie hier und jetzt (2)
Tollkühne Männer in fliegenden Kisten
Okidoki (2)
Schiffe versenken
Fortschreibung meiner selbst (2)
Mein Name sei Monika
Ewige Jagdgründe. Epilog
ERSCHOSSEN IM MORGENGRAUEN
Vorspann
Getting shot is easy
Tried it seven times
Now I’m just a solo poet
Working on my rhymes …
Don DeLillo
1
Ich war ganz unten gelandet, in der Tiefebene des Frankfurter Hauptbahnhofs, von der aus eine Rolltreppe in tiefere Kreise der Hölle, nein: zu den Bahnsteigen der U-Bahn hinabführt. Zapfhahn hieß das von außen unbeleuchtete, im Innern aber schummrig erhellte Lokal, an dessen Tresen zwei Abiturientinnen – so heißen die sex workers in Westafrika – aus Ghana oder Nigeria sich ein Stelldichein gaben mit einem anonymen Alkoholiker, der teilnahmslos in sein Bierglas starrte und ab und zu aufsprang, um Geld in einen Spielautomaten zu stecken, auf dem Herzasse, Pikdamen und Kreuzbuben rasend schnell rotierten, bevor der Automat zum Stillstand kam und mit schrillem Klingelton einen Schwall von Münzen ausspuckte, die der Gast vom Boden klaubte, unter dem Beifall der sex workers und des Zuhälters, der kein Bier, sondern Coca-Cola trank und seinem Schnauzbart nach aus den Schluchten des Balkans stammte. Der anonyme Alkoholiker war ich, und ich frohlockte über den Geldsegen, den ich in den Hosentaschen verstaute, bis ich, vom Beifall angespornt, eine Lokalrunde ausgab, das war ich meinem schlechten Ruf schuldig, denn ich war ganz unten angekommen, ich sagte es schon, auf der ganzen Linie gescheitert in Ehe Beruf Liebe Arbeit, ein Schreiberling, der tausend Texte und an die hundert Bücher geschrieben hatte, die kein Mensch kaufen, geschweige denn lesen wollte, obwohl es sich um Spitzenprosa handelte, ein Spitzenprodukt wie der Rotkäppchensekt, den ich ausgab und in den die Bardame, vielleicht war es auch die Wirtin der Bahnhofskneipe, um den Preis hochzutreiben, Bols Blue goss, Herrengedeck nannte sie das, während ich meinen falschen Ehrgeiz, der Erste und Größte sein zu müssen, ad acta legte und endlich begriff, was Lao Tse gemeint hatte mit dem Satz: Wer nichts tut, erreicht alles. Das Nichtstun ist die höchste Stufe des Nirwana, alles glitt von mir ab, und statt den Kopf hängen zu lassen, spürte ich einen Zuwachs an frischer Kraft wie die himmelstürmenden Riesen der Vorzeit, die ohne Kopf weiterkämpften, und erst jetzt, an der Schwelle zum Nirwana, entdeckte ich in der trüben Tiefe des Glases die Wahrheit über die Welt draußen und über mich selbst, die so genial wie einfach war: Wú wéi er wú bù wéi – wer nichts tut, erreicht alles.
2
Zwölf Stunden später befand ich mich noch tiefer unten, im Keller einer Stadtvilla, der eine Einliegerwohnung beherbergte, wo Dichterinnen und Dichter übernachteten, ich war eine(r) von ihnen, lag diagonal auf dem Kingsize-Bett und stellte mir vor, wie die DichterInnen es miteinander trieben auf der ausgeleierten Matratze, die wie ein Trampolin vibrierte. Alles vibrierte, Boden Wände Decke Dusche Waschbecken und Toilette des als Gästezimmer dienenden Kellerraums, in dem man mich einquartiert hatte, das Haus war mit Partygästen überfüllt, die auf der Suche nach dem Klosett an der verschlossenen Tür rüttelten, hinter der ich mich schlaflos hin und her wälzte in meinem Kingsize- oder Queensize-Bett.
Die gute Stimmung, die mich beim Betreten der Bahnhofskneipe überkam, war verflogen und hatte sich zu nichts verflüchtigt, zusammen mit dem Geldgewinn, den ich lustlos eingestrichen und restlos ausgegeben hatte in der Bierbar, die Ozapft is oder so ähnlich hieß. Ich lag auf dem Rücken und konnte nicht schlafen wegen des Lärms über mir, wie jedes Jahr während der Buchmesse feierte mein Verleger ein bis zum Morgengrauen dauerndes Fest, bei dem Wein und Bier in Strömen flossen, auch für Essen war gesorgt, vegane Spezialitäten ohne Laktose Fruktose Glukose Cholesterin oder Cholesterol, Durchsagen und Rufe ertönten, und das Scharren der Schuhsohlen machte rhythmischen Tanzschritten Platz, unterlegt von Bässen und Trommeln, deren Sound wie ein Tamtam Decke und Wände durchdrang und meine inneren Organe in schwingende Bewegung versetzte. An Schlaf war nicht zu denken, vergeblich stülpte ich mir das Kopfkissen über die Ohren und verstöpselte die Gehörgänge mit Ohropax – und halbbetäubt wie ein dem Meer entstiegener Taucher identifizierte ich die Musik, die mich am Einschlafen hinderte, es war die gestopfte Trompete von Miles Davis, die schwerelos über eine von Pierre Michelot am Bass und Kenny Clarke am Schlagzeug erzeugte Meeresdünung surfte, und der Titel des Films, zu dem Miles Davis die Musik improvisierte, passte zu dem Kellerloch, in dem ich mich befand, ebenso wie zu der bodenlosen Depression, die mich nach kurzer und hektischer Euphorie überfiel: L’ascenseur pour l’échafaud – Fahrstuhl zum Schafott hieß der von Louis Malle gedrehte Schwarz-Weiß-Film mit Jeanne Moreau in der Hauptrolle, und während ich darüber nachsann, warum Hinrichtungen stets im Morgengrauen stattfinden, sah ich beim Blick auf das phosphoreszierende Ziffernblatt meiner Swatch, dass es fünf Uhr früh war und dass hinter der herabgelassenen Jalousie ein neuer Tag dämmerte, während im Vorgarten eine Amsel zu zwitschern begann.
ICH, AUSONIUS
1
Mein Name ist Decimus Magnus Ausonius, und ich bin der erste deutsche und der letzte lateinische Dichter. Andere sagen, ich sei überhaupt kein Dichter und mein Nachruhm werfe ein bedenkliches Licht auf den literarischen Geschmack meiner Zeit. Aber ich will die üble Nachrede nicht zurückweisen, denn das vermehrt nur das Renommee ihres Urhebers, eines gewissen Gibbon, und schmälert meinen mehr als bescheidenen Ruhm. In einem leider noch immer benutzten Nachschlagewerk über spätantike Autoren steht, meine Gedichte hätten mehr kulturgeschichtlichen als poetischen Wert, böten aber Einblicke in die Ursachen für den Zerfall des Römischen Reichs. Zitat: »Mit seinem lyrischen Dilettantismus und seinen Formspielereien ist A. ein Zeuge für das Absterben der lateinischen Dichtung.« Zitat Ende. Somit werde ich nicht nur für den Niedergang der Literatur, sondern auch für den Untergang Roms verantwortlich gemacht. Früher hätte ich die Verbreiter solcher Verleumdungen von einem Küchensklaven vergiften oder von einem Auftragsmörder beseitigen lassen; aber gegen postume Verunglimpfungen bin ich machtlos, und sie haben Eingang gefunden in Lexika, deren Objektivitätsanspruch über jeden Verdacht erhaben ist.
Meine Verächter behaupten, ich sei weder ein römischer noch ein germanischer Dichter gewesen, sondern ein keltischer Barde, der versucht habe, das in den Grenzprovinzen des Imperiums gesprochene Küchen- und Kirchenlatein von Barbarismen zu säubern und auf die Höhe der klassischen Vorbilder zurückzuführen: Vergebliche Liebesmüh, denn zusammen mit der augusteischen Literatur war auch deren Stilwille im Orkus der Geschichte verschwunden, und was bei meinen eklektischen Versuchen herauskam, war nur ein matter Widerschein der silbernen Latinität. Wieder andere sagen, je nach landsmannschaftlicher Affinität, ich sei ein Aquitaner gewesen, dessen Muttersprache das schon damals altertümliche Baskisch gewesen sei. Oder sie beanspruchen mich für Länder wie Belgien oder Luxemburg, die es noch gar nicht gab, ohne Rücksicht zu nehmen auf das i, das die von Cäsar erwähnten Belger von den späteren Belgiern trennt. Wie alle ernst zu nehmenden Schriftsteller habe ich eine multiple Identität, und auf die Gefahr hin, die Verwirrung noch zu vergrößern, wiederhole ich hier, was ich in meinem Opus magnum, dem Gedicht Mosella, zur Frage meiner Herkunft in Wachstäfelchen ritzen und auf Schriftrollen kopieren ließ: »Dies sang ich, der ich mein Geschlecht vom Volk der Biskayer herleite, doch auch den Belgern in Freundschaft verbunden bin: Ausonius, römischer Bürger aus dem Land zwischen Galliens Grenze und den Gletschern der Pyrenäen, dort, wo das alte Aquitanien edle Sitten bewahrt; kühn ist mein Lied, mag die Leier auch schwach sein.«
2
Ich habe mich oft gefragt, ob man Schlaf nachholen kann, denn wie Seneca, der Lehrer des jungen Nero, möchte ich jede schlaflos verbrachte Nacht aus dem Kalender streichen, weil der darauffolgende Tag diesen Namen nicht verdient – aber vielleicht hat nicht Neros Lehrer Seneca, sondern Aristoteles, der Erzieher Alexanders des Großen, diesen Satz geschrieben oder gesagt. Seit ich an Schlaflosigkeit leide, lässt mich mein Gedächtnis im Stich, und nächtelanges Grübeln behebt nicht das Übel, sondern verschlimmert es. Früher weckte ich um Mitternacht meinen Sklaven, der auf einer Bastmatte vor der Tür zu meiner Kammer schlief; er entzündete die Öllampe, und im warmen Lichtschein durchstöberte ich die Schriftrollen meiner Bibliothek, bis ich die Werke des unsterblichen Plato oder Aristoteles in Händen hielt. Aber ich habe keinen Sklaven mehr und auch keine Bibliothek, die bei der Plünderung unserer Stadt einer von Alemannen – oder waren es Burgunder? – entfachten Feuersbrunst zum Opfer fiel. Ich habe es aufgegeben, mir die Namen der germanischen Stämme zu merken, die zuerst Augusta Treverorum, wo ich als Prinzenerzieher und Konsul wirkte, und später mein geliebtes Burdigala in Schutt und Asche legten. Rückblickend scheint es mir, als seien es Wellen ein und desselben Ozeans, dessen Sturmflut über den Limes schwappte, bevor sie sich in den Okeanos ergoss. Was die Barbaren nicht mitschleppen können, zerstören sie; und als im Winter das Brennholz knapp wurde, heizten sie ihre zugigen Öfen mit den Schriftrollen meiner Bibliothek. Am Ende gibt es keine Bücher, aber auch keine Öllampen mehr, nur noch Talglichter, deren Flackern mir die Augen verdirbt, und die Nächte sind so finster wie am Ursprung der Zeit, als Jahwe – oder war es Zeus? – aus dem Chaos das Licht des Tages erschuf.
3
Alles fing an mit einem kaum hörbaren Summen, einem feinen Brummton, der zu nachtschlafender Zeit, zwischen zwei und vier Uhr früh, ausgehend von einer weit entfernten, unbekannten Lärmquelle, nicht nur das Trommelfell meines inneren Ohrs vibrieren ließ, sondern Bettpfosten und Matratze, Fußboden, Wände und Decke in schwingende Bewegung versetzte. Nein, das war kein Tinnitus, denn Bissula, die damals noch das Bett mit mir teilte, bestätigte auf Befragen die Existenz des Geräuschs, das sie jedoch nicht vom Weiterschlafen abhielt, im Gegenteil, sie drehte sich gähnend zur Seite, und am Morgen hatte sie die Gespenster der Nacht aus ihrem Tagesbewusstsein verdrängt. An Schlaf war nicht zu denken: Vergebens stopfte ich mir Wachspfropfen in die Ohren, zog mir ein Kissen über den Kopf, verbarrikadierte mit Säcken die Tür und dichtete die Fenster mit Wolldecken ab – das Brummen nahm nicht ab, sondern zu, und während ich mich schlaflos hin und her wälzte, dröhnten Trommeln, Becken und Pauken in meinem Kopf, immer lauter und immer schneller, bis mir der Schädel zu zerspringen drohte und der Lärm wie auf Kommando erstarb. Hinterher fiel ich in kurzen, traumlosen Schlaf, doch beim Aufwachen fühlte ich mich müde und zerschlagen, meine Muskeln und Knochen schmerzten, als hätten Folterknechte mich auf einem Streckbett so lange auseinandergezogen, bis die Gelenke knackten.
Im Traum ziehe ich mit einer Schar von Flüchtenden, ächzend unter Kisten und Ballen, im Ascheregen über eine Heerstraße und bemerke als Erster das Fehlen der Dächer im Weichbild der hinter mir liegenden Stadt, bei der es sich um Pompeji oder Herculaneum handeln könnte. »Also doch«, sage ich halblaut zu mir selbst, obwohl ich Pompeji und Herculaneum nie besucht und nur Berichte von Überlebenden des Vulkanausbruchs gelesen habe. Mein Begleiter zur Linken fällt stöhnend zu Boden, und als ich mich umblicke, ist die Heerstraße in ihrer ganzen Länge von Toten und Sterbenden gesäumt, an denen ich vorbeilaufe, ohne etwas zu empfinden, bis auch ich den Schmerz in der linken Brust spüre, der mich niederwirft.
4
Während mein Augenlicht zusehends schwächer wird – die mich umgebenden Menschen und Dinge nehme ich nur noch als Schatten wahr, allein die Schriften der Dichter und Philosophen stehen greifbar nah und gestochen klar vor mir –, ist mir ein drittes Auge gewachsen. Zuerst war es nur eine Furche, wie sie die Pflugschar des Bauern im Frühjahr durch den Acker zieht (»o glücklich, wer wie ihr mit selbst gezognen Stieren den angestorbnen Grund vom eignen Acker pflügt!«, heißt es in einer holprigen Übersetzung von Vergils Georgica), eine senkrecht stehende Furche, die wie ein Ausrufe- oder Fragezeichen meine Stirn ritzte und zwei Falten aufwarf, zwischen denen sich ein drittes Auge öffnete oberhalb der Nasenwurzel, dort, wo nach Angaben von Aristoteles’ Neffen Kallisthenes, der Alexander den Großen nach Indien begleitete, fromme Hindus sich einen Kreis auf die Stirn malen in Stellvertretung des geistigen Auges, das Gott erblickt. Seitdem sehe ich Polyphem mit anderen Augen: Er war nicht plump und ungeschlacht, noch weniger blind und dumm, und durchschaute den Betrug des Odysseus, der sich ihm gegenüber als ούτις (niemand) ausgab: Odysseus war ein Hirngespinst seines Autors, falls sich hinter dem Pseudonym Homer nicht mehrere Verfasser verbergen, wie gelehrte Gräzisten behaupten. Dass er die Gefährten des Odysseus verspeist haben soll, passt nicht ins Bild, denn wie kann ein Niemand über Begleiter verfügen, mit denen ein Zyklop seinen Hunger stillt?
Gestern war ich auf einer Beerdigung. Wir trugen meinen besten Freund zu Grabe, doch die Beisetzung erfolgte nicht nach den ehrwürdigen Riten der Götter, mit Klageweibern, die sich die mit Asche geschwärzten Gesichter zerkratzen, die Haare zerwühlen und wie Furien jammern, sondern nach dem neuen Ritus des Barfußpredigers aus Galiläa, der sich als König der Juden und Gottes Sohn ausgab und dafür auf Befehl des Prokonsuls Pontius Pilatus ans Kreuz geschlagen wurde, wie das Gesetz es befahl. Unter Sklaven und anderem Gesindel aus den Randgebieten des Römischen Reichs gewinnt die Lehre des Gekreuzigten mehr und mehr Anhänger, aber mir drehte es den Magen um beim Anhören der misstönenden Gesänge und beim Anblick der roh gezimmerten Kiste, in der man den Toten zu Grabe trug. Den Einflüsterungen meiner Gattin Bissula erliegend, hatte er sich auf dem Sterbebett zu der neuen Religion bekehrt. Von Bissula wird im Folgenden noch öfter die Rede sein, von der neuen Religion ebenfalls.
5
Mein Name sei Ausonius, und ich hätte im Vorland des Limes gelebt, in einer Villa rustica, wie sie das römische Heer den Centurionen am Ende ihrer Dienstzeit zur Verfügung stellte, auf einem von der Morgensonne beschienenen Stück Land am Westhang des Rheinischen Schiefergebirges, das ich von Feldsklaven roden und terrassieren ließ, um Wein anzupflanzen, der auf dem vulkanischen Boden gut gedieh – die Reben der von mir gesetzten Weinstöcke ranken sich noch heute die Berge hinauf und hinab, obwohl die Villa mit dem rostroten Dach, auf dessen in der Sonne getrockneten Lehmziegeln Bissula, damals noch ein Kind, ihre zierlichen Fußabdrücke hinterließ, längst abgebrannt und von Barbaren geplündert worden ist, bevor ein Erdrutsch sie verschüttete. Siebzehnhundert Jahre später haben Archäologen das Fundament meines Hauses freigelegt und wissenschaftlich durchsiebt, bevor es unter dem Asphalt einer Schnellstraße wieder verschwand: Nur die Hypocauston genannte Fußbodenheizung, deren kompliziertes Lüftungssystem schon zu meinen Lebzeiten versandet ist, wird einschlägig interessierten Touristen gezeigt, ebenso wie die Be- und Entwässerungskanäle, die ich von Sklaven ausheben und mit Steinplatten abdecken ließ. Nicht der prachtvolle Portikus, dessen Marmorsäulen von Plünderern gestohlen und zum Bau von Viehställen verwendet wurden, nur die Kloake meines Hauses hat das Auf und Ab der Gezeiten überlebt sowie eine in die Wand geritzte Inschrift, in der sich Bissula über ihren Lehrer beschwert, der ihr mit dem Rohrstock oder mit dem Lineal – je nachdem, welche Übersetzung der Leser vorzieht – Lesen und Schreiben beibrachte: Dieser Lehrer war ich, denn auf einer Strafexpedition gegen die Alemannen habe ich Bissula erbeutet, als sie sich in einem Heuhaufen verbarg, aus dem ich sie an ihren blonden Zöpfen hervorzog. Damals war sie noch ein Kind, bevor ich sie nach dem Motto AMOR VINCIT OMNIA aus dem Sklavenstand befreite, zu meiner Geliebten machte und später zur rechtmäßigen Ehefrau.
6
Auf Dienstreisen in Grenzprovinzen des Römischen Reichs und jenseits des Limes habe ich barbarische Völkerschaften kennengelernt, von deren Existenz mein Vater und Großvater keine Ahnung hatten, während sie heute in spitzen Schuhen und engen Lederhosen, mit ranziger Butter im Haar, über das Forum paradieren und Bärenkrallen, Wolfsdung und andere Monstrositäten feilbieten, denen sie magische Heilkräfte zuschreiben. Nicht nur die hautengen Hosen der Germanen, auch die kahl geschorenen Schädel altägyptischer Priester gelten neuerdings als schick, und beim Besuch der Ewigen Stadt hatte ich das Gefühl, dass es keine Modetorheit gibt, die Rom nicht mitmacht. Als ich Bissula nach ihren Eindrücken befragte – auf einer vorweggenommenen Hochzeitsreise wollte ich ihr die Sehenswürdigkeiten der Metropole zeigen (damals glaubte ich noch, ihr gelegentliche Gunstbeweise schuldig zu sein, wodurch ich zum Sklaven meiner Sklavin wurde), meinte sie, Rom sei hässlich: Der Kaiserpalast, das Forum und das Colosseum lägen in Trümmern, und was den Uringestank betrifft, unterscheide sich der Circus Maximus nicht von der Cloaca Maxima. Sie selbst, sagte Bissula, ziehe die neu erbauten Städte am Limes der Hauptstadt des Imperiums vor; dort seien die Straßen sauber, die Kanalisation nicht durch Exkremente verstopft und die Bürgersteige nicht mit Orangenschalen und Pinienkernen übersät, die Spaziergänge zu Rutschpartien machten. »Ganz recht«, entgegnete ich voller Zorn über das von Bissula begangene Sakrileg, ganz recht, denn in Germanien gibt es weder Orangen noch Pinien, zu schweigen von gepflasterten Straßen oder Kanälen, die Exkremente unter die Erde leiten, damit sie den Geruchssinn nicht beleidigen. Stattdessen verrichtet ihr eure Notdurft wie die Tiere im Gebüsch oder auf freiem Feld!« – »Das ist hygienischer als der mit Unrat besudelte Marmorsitz einer römischen Toilette, die in der Hitze zum Himmel stinkt und Schwärme von Schmeißfliegen anlockt. Überhaupt«, fuhr sie fort, ohne sich durch mein Stirnrunzeln beirren zu lassen, ziehe sie ein germanisches Bauhaus, nein Bauernhaus einer aus Ziegeln errichteten römischen Villa vor. Unter dem mit Schilf oder Stroh gedeckten Dach sei es im Winter gemütlich warm, und wenn die Lehmwände keinen Schutz böten gegen die Unbilden der Witterung, reiße man das Haus ab und errichte ein neues gleich nebenan. »Auf diese Weise haben unsere Handwerker genug zu tun, die in Germanien, wie du weißt, freie Bürger und keine Sklaven sind. Mein Vater war Dachdecker und hat sich mit seiner Hände Arbeit selbst ein Eigenheim erbaut.« – »Aus Holz oder aus Stein?« Die Frage lag mir auf der Zunge, aber ich behielt sie vorsichtshalber für mich, weil Bissula ihre Niederlagen im Rededuell mit Liebesentzug zu bestrafen pflegt.
7
Ein anderes Phänomen, das zusammen mit den Lederhosen der Gallier und den Glatzköpfen der alten Ägypter nicht nur die Hauptstadt, sondern auch die Provinzen des Imperiums überschwemmt, sind Graffiti, in denen nicht, wie ehedem, der Segen der Götter erfleht oder vor bissigen Hunden gewarnt, sondern zum Geschlechtsverkehr aufgefordert wird: Die Urheber dieser Graffiti scheinen Analphabeten zu sein, denn anstelle der Worte TE AMO, die früher jedes Kind schreiben konnte, kritzeln sie von Pfeilen durchbohrte Herzen auf Mauern und Bauzäune oder, als sei das nicht deutlich genug, einen erigierten Penis, der Sperma in eine stilisierte Vagina spritzt, gekennzeichnet durch ein auf dem Kopf stehendes Oval, das an den Fisch erinnert, der den Anhängern der aus Galiläa importierten neuen Religion als Erkennungszeichen dient. Um Bissulas religiöse Gefühle nicht zu verletzen – wie alle Christinnen hat sie keinen Sinn für Ironie und reagiert äußerst empfindlich auf meinen Spott –, will ich die Parallele zwischen Vagina und Fisch an dieser Stelle nicht erweitern oder vertiefen, aber wer Augen, um zu sehen, und Nasenlöcher zum Riechen hat, weiß, wovon die Rede ist. Ähnlich wie das von einem Pfeil durchbohrte Herz gehört der erigierte Penis zu den harmloseren Graffiti, denn es gibt noch andere Formen des Geschlechtsverkehrs, für die auf öffentlichen Toiletten mit kruden Zeichnungen geworben wird. Gelegenheit macht Diebe, und beim Propagieren widernatürlicher Unzucht schrecken die Urheber solcher Schmierereien vor nichts zurück. Es war die verdiente Strafe der Götter, dass der Ausbruch des Vesuv die pornographischen Inschriften in den öffentlichen Bädern, Tavernen und Kaschemmen von Pompeji und Herculaneum durch Bimssteine und Asche den Blicken entzog und so gleichzeitig für die Nachwelt erhielt.
Die obszönen Graffiti, die hautengen Hosen und die kahl geschorenen Schädel sind Ausdruck einer immer weiter um sich greifenden Unkultur, die sich aus den Wäldern Germaniens und den Steppen Asiens zusammen mit ihren Trägern, den Barbaren, über das Römische Reich ergießt und die Pflastersteine und Marmorstufen der Ewigen Stadt mit einem klebrigen Belag überzieht, in dem man beim Gehen mit den Sandalen stecken bleibt. Vielleicht ist das der Grund, warum der Kaiser nicht mehr erhobenen Hauptes zum Capitol schreitet, sondern gebeugt wie ein Bettler, ohne die Füße vom Boden zu heben, durch nach Urin stinkende Gassen zum Colosseum schlurft, eskortiert von seiner Prätorianergarde, die, statt Rom vor dem Einfall der Barbaren zu schützen, selbst aus Barbaren besteht. Zum Dank dafür, dass sie einst die Legionen des Varus in einen Hinterhalt lockten und bis zum letzten Mann massakrierten, hat der Senat die Heerführer der Germanen zu Generälen ernannt und ihnen den Schutz des Römischen Reiches anvertraut – nicht erst heute, sondern schon unter Tiberius. Oder war es Augustus, der damit seinen Ausruf Vare, Vare redde legiones! Lügen strafte? Was waren das doch für Zeiten, als Kultur und Barbarei wie Feuer und Wasser sich nicht miteinander vertrugen? Früher schauten unsere Dichter und Denker voller Verachtung auf die Menge herab, die aus ungebildeten Plebejern bestand, jetzt aber gilt Vulgarität als erstrebenswert, während man altrömische Tugend und strenge Sitten mitleidig belächelt wie eine aus der Mode gekommene Toga oder Tunika. Hässlichkeit ist das allseits akzeptierte Schönheitsideal, und nicht nur Fischweiber, Köchinnen und Marktfrauen, auch die Patrizierinnen schwärmen für tätowierte Gladiatoren, die in der Volksgunst und Volkskunst die Prätorianer verdrängen. Die Bevorzugung der Barbaren ist nicht bloß platonisch: Lieber als mit Jünglingen aus aristokratischen Familien betrügen die Römerinnen ihre Ehemänner mit bezopften Galliern und kahlköpfigen Ägyptern, und diese ziehen blonde Germanen oder kraushaarige Afrikaner hübschen Griechenknaben vor. Warum, weiß ich nicht, oder vielmehr, ich weiß es aus leidvoller Erfahrung nur zu genau: Alles Geistige gilt als dekadent, während von der durch nichts gemilderten, rohen Unkultur eine Faszination ausgeht, der sich keiner zu entziehen wagt. Mit diesen Worten hat Bissula mir die Liebe aufgekündigt, als sie mich für einen Küchensklaven verließ, der, wenn ich mich recht erinnere, Ubier war; nicht seine blauen Augen hatten es ihr angetan, sondern die Tatsache, dass der dumme Junge sich zu der neuen Religion bekannte, von der die Erniedrigten und Beleidigten sich Befreiung aus dem Sklavenjoch erhoffen. Vergeblich wies ich Bissula darauf hin, dass sie sich in eine Abhängigkeit begab, die schlimmer war als die durch römisches Recht gemilderte Sklaverei. Erst als ich ihrem Drängen nachgab und Teuto – so hieß der Typ – in die Freiheit entließ, kam sie wieder zur Vernunft: Wie nicht anders zu erwarten, brannte der Nichtsnutz mit einem Küchenmädchen durch, und Bissula wurde von ihrer christlichen Nächstenliebe geheilt. Ich dankte Amor und Venus, und in einer schwachen Stunde gab ich ihr das Versprechen, mich von den heidnischen Göttern loszusagen und zu ihrem Glauben zu bekennen. Aber das war leichter gesagt als getan, weil Bissula darauf besteht, mich in fließendem Wasser zu taufen.
Kürzlich sah ich auf der Straße – sofern man eine vom Regen aufgeweichte Piste noch so nennen will, die man hüpfend überqueren muss, um den Saum seines Gewands nicht mit Kot zu besudeln –, kürzlich sah ich auf der Straße eine junge Mutter, die ihrem Sohn einen Bissen aus dem Mund nahm, an dem der Kleine gelutscht hatte. Ich weiß nicht, ob es eine Pflaume oder eine Feige war, doch was mich verblüffte, war das, was dann geschah: Die Mutter begutachtete den Bissen und steckte ihn sich selbst in den Mund.
Später beobachtete ich ein junges Paar, das sich ungeniert auf offener Straße küsste. Dagegen ist nichts einzuwenden, ich bin nicht prüde, im Gegenteil, es macht mir Spaß, Paare beim Liebesspiel zu beobachten und mich voyeuristisch in die Lage des Liebhabers zu versetzen. Was mich irritiert hat, war, dass der junge Mann über die Schulter seiner Geliebten hinweg, während er ihren zurückgebogenen Hals liebkoste, nach der an seinem Handgelenk befestigten Uhr schielte, einer Armbanduhr Marke Swatch, als habe er Angst, einen wichtigen Termin zu versäumen. Gleichzeitig fiel mir ein, dass das Verhalten des Mannes nicht zu beanstanden wäre, wenn es darum ginge, seinen kranken Vater gesund zu pflegen oder seinen Sohn von der Schule abzuholen, und ich dachte mir mögliche Konstellationen aus, die eine unmoralische zu einer moralischen Handlung machen: Lob der Dummheit, Lob der Stechmücken, Lob der Cholera heißen solche Aufsatzthemen, die Quintilian in seiner Rhetorik erwähnt. Bissula störte meine Kreise und riss mich aus meinen Betrachtungen mit dem Hinweis, im alten Rom habe man die Uhrzeit am Stand der Sonne oder an rinnendem Sand abgelesen; erst tausend Jahre danach hätten Schweizer Mechaniker das Uhrwerk erfunden und noch später eine Armbanduhr namens Swatch – ein Widerspruch, den ich, selbst wenn ich dies wollte, nicht befriedigend erklären kann.
SO SCHREIBEN WIE HIER UND JETZT (1)
10. Juni 2016. Gestern las Günter Herburger aus seinem Roman Wildnis singend. Ort: Die Wannseevilla des LCB, wo ich ihn, wenn mich nicht alles täuscht, vor fünfzig Jahren kennenlernte, als er bei der Gruppe 47 las. Er sieht aus wie die auf einem Andengletscher tiefgefrorene Mumie eines Inkafürsten, mit langen Haaren und Adlernase, alterslos oder schon lange tot, dabei quicklebendig, ein Literatur-Zombie, der als Ketschuafrau aus dem Altiplano im Roman wiederkehrt und über dem Allgäu niedergeht. Allgäu oder Altiplano, das ist die Frage, und genau das ist der Grund, warum ich sein mir übersandtes Manuskript unlesbar fand, krauser Unsinn, selbstreferenzielle Phantastik, Äther in Äther gemalt wie sein Roman Jesus in Osaka, wo nicht klar wird, ob er in Japan, Baden-Württemberg oder sonstwo spielt. Erlaubt ist, was gefällt, und Wildnis singend gefällt den Kritikern nicht trotz, sondern wegen der Narreteien des Autors, der, als sein Handy zu klingeln beginnt, die Lesung unterbricht und den Inhalt seiner Reisetasche, viel zu groß für die Fahrt zum Wannsee, besser geeignet für eine Reise nach Wladiwostok, auf dem Podium ausbreitet, bis der neben ihm sitzende Redakteur das klingelnde Handy geortet hat und seinem Besitzer reicht: »Hallo, ich bin’s, nein, die Lesung ist noch nicht zu Ende, wir sind mittendrin, keine Sorge, alles in Ordnung, bis später dann!« Ein passendes Bild für den Kritiker als Dienstleister, der dem Autor zuarbeitet anstatt umgekehrt!
Bevor er von Prosa zu Gedichten übergeht, zündet Herburger sich eine Zigarette an, keine E-Zigarette, sondern eine richtige, sonst streng verboten, jetzt aber erlaubt, und verheddert sich in dem Wort Nibelungen, das sich wie eine Lassoschleife um seine Zunge wickelt. Der Sprachverlust verläuft umgekehrt proportional zum Spracherwerb und ähnelt dem Stammeln eines Alkoholikers: Ni - be - lun - gen.
Dass die vom Himmel gefallene Ketschuafrau, im Roman Riesin genannt, auf Herburgers behinderte Tochter verweist, braucht die Kritik nicht zu interessieren, weil Literatur keine Lebensbeichte ist, sondern weniger und mehr zugleich. Das ist nur scheinbar ein Paradox: Auch Rolf Dieter Brinkmann hatte ein behindertes Kind, das in seinen Gedichten nicht vorkommt, aber vielleicht erklärt gerade das seine reizbare Aggressivität!
15. Juni. Fußball-Europameisterschaft. Jedes Mal, wenn ein Tor fällt, stößt das Schwulenpaar in der Wohnung unter mir wilde Lustschreie aus. Fußball-Orgasmen: Torschüsse werden in Zeitlupe wiederholt.
16. Juni. Deutschland Polen 0 : 0. Draußen Grabesstille, weder Hupkonzert noch Flaggenparade zum Brandenburger Tor. Béla Rethy über das Dioskurenpaar Mats Hummels und Jérôme Boateng. »So wächst zusammen, was zusammengehört.« Armer Willy Brandt!
17. Juni. Seit einer Woche krank. Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Husten. Pollenallergie oder Bronchialkatarrh – die Symptome sind die gleichen. Wenn ich das Ohr ans Kissen drücke, höre ich das Kraftwerk in meinem Kopf: Es poltert, zischt und pfeift wie ein unter Überdruck stehender Dampfkessel. Gestern Anruf Michel Maisgeier, der Krebs im fortgeschrittenen Stadium hat, Lungentumor mit Satelliten, wie er sagt. »Jede Todesart ist furchtbar, niemand geht lachend aus dem Leben.« Bei diesem Satz von Lars Brandt, den er am Telefon zitiert, überschwemmt ihn eine Welle von Selbstmitleid.
Schon vor zwanzig, dreißig Jahren, als es ihm noch gut ging, sah Maisgeier aus wie ein Gespenst, Fausts Alter Ego, der Geist, der stets verneint: »Das ist der Buch«, so stellte er mich damals Harry Mulisch vor, »ein Talent, das 1968 vor die Hunde ging …« Sein Freund Valentin Falin, der ihm in Kuba aus der Patsche half, hat Stalin persönlich gekannt und beschreibt den mordlüsternen Tyrannen als bescheiden, liebenswürdig und rührend besorgt um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter. »Glauben Sie nichts von dem, was man im Westen über ihn schreibt – alles Lüge!«
»Die Welt ist, wie sie ist, weil du so bist, wie du bist.« Eine niederschmetternde Erkenntnis – unwiderlegbar wie die Behauptung, die Zahl der Wellen im Atlantik sei eine Primzahl!
Literatur als Kunst der Geisteskranken, von der nicht klar ist, ob sie in die Sammlung Prinzhorn, nach Walhalla oder nach Narrhalla gehört.
26. Juni. Mittagessen mit Michel Maisgeier im Tavola Calda, Leibniz/Ecke Niebuhr – nicht Mommsenstraße, wie ich irrtümlich annahm. Er sieht aus wie der lebende Tod, aber es ist unklar, worauf der Akzent zu legen ist, Leben oder Tod, denn im Lauf des Gesprächs taut er auf – trotz seines Tumors, der einen Zentimeter gewachsen ist, wie er sagt, und kriegt rote Backen, als er von Udo Lindenberg erzählt, der Honeckers Gunst gewann, indem er ihn Honni oder Honey nannte – honi soit qui mal y pense –, während Egon Krenz gegen den DDR-Auftritt des Rockstars gewesen sei: »Nur über meine Leiche!« Der Sozialismus habe keine Gegenwart, will Maisgeier gesagt haben, nur Vergangenheit und Zukunft, aber das war später, als er Helmut Kohl durch eine Ausstellung moderner Kunst in Moskau führte und überrascht war, dass Kohl die Nagelbilder von Uecker mochte. Das Verhältnis der Intellektuellen zur Staatsmacht sei schwierig, es gebe nur zwei ernst zu nehmende Intellektuelle unter deutschen Politikern, Friedrich den Großen und Helmut Kohl. Darauf Kohl wie aus der Pistole geschossen: »Wo steht das geschrieben? Wo haben Sie das her?« Er habe sich nie träumen lassen, habe Kohl mit Blick auf Maisgeier gesagt, von einem Westberliner Kommunisten durch eine Kunstausstellung geführt zu werden, noch dazu in Moskau! Pasta, Salat, Fleisch, Gemüse, Cappuccino – Maisgeier ist ganz der Alte und schwadroniert von Willy Brandt, von Valentin Falin, dem Rudolf Augstein eine Wohnung in Hamburg besorgte, vom beinamputierten Jewtuschenko (Raucherbein!), der in Tucson/Arizona lebt, und von Heiner Müller, der eine Berliner Literaturagentin als IM-Geltungssucht bezeichnete, usf. ad infinitum.
26. August. »Als ich noch Igel hatte«: Mit diesen Worten – einer von Millionen möglicher Sätze, die so noch nie gesagt worden sind – beginnen Irmgard Borns Tiergeschichten, obwohl der infrage kommende Igel kein Haustier war, sondern durch den Garten stromerte und seine Schnauze witternd aus einem Erdloch steckte – oder war es ein Laubhaufen? –, sobald Bratenduft aus der Küche drang. Noch übergriffiger war ihr Truthahn, der mit einem Schnabelhieb ein Stück Torte von meinem Teller stibitzte; einmal stahl er einen Hasenrücken, den er blitzschnell vom Tisch abräumte und floh, von schnatternden Gänsen verfolgt, in einen Holunderbusch, wo die Köchin ihm den Braten entwand. Am Ende packte Irmgard den Puter am Schlafittchen und brachte ihn im Kofferraum ihres Mercedes zum Zoo, dessen Direktor sich weigerte, die Spende anzunehmen, weil er keinen Käfig frei hatte für das aggressive Federvieh. Erst als Irmgard vorschlug, ihn an Löwen zu verfüttern, hatte der Zoodirektor ein Einsehen.