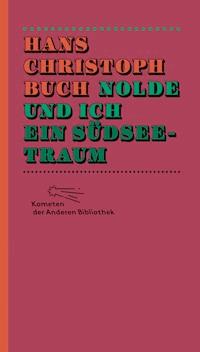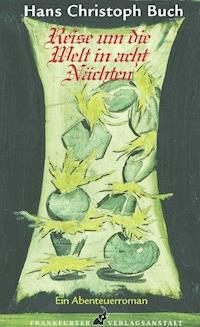Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hans Christoph Buchs Der Flug um die Lampe vereinnahmt Raum und Zeit, überblendet viele miteinander verwobene Erzählungen und berichtet von bizarren Geschichten, die wie eine Fliege um die Lampe, um ein geheimes Zentrum kreisen. Es geht um die Wiederkehr des Gleichen und die Ungleichheit des Ähnlichen. Nacheinander treten auf: Casanova, der Playboy Porfi rio Rubirosa, der Detektiv Nick Knatterton, Elvis Presley, John Reed und Kaiser Maximilian von Mexiko, nicht zu vergessen der weitgereiste Dr. Dingsda und Ötzi, der im Gletschereis gefrorene Steinzeitmann. Buch reist nach China, Afghanistan und last but not least auch Haiti. Entstanden sind unerhörte Geschichten aus dem dichten Erzählfundus HC Buchs. Es sind wilde Alter Egos des Autors, mit deren Hilfe der sich augenzwinkernd und vergnüglich seiner eigenen Identität versichert. Je weiter der Erzählende in seinem neuen Buch voranschreitet, desto ernster werden seine Anmerkungen, münden in Selbstbetrachtung, die Aktualität besitzen: vom Stolperstein für die in Auschwitz ermordete Liane Löw bis hin zur Abrechnung mit dem deutschen Literaturbetrieb. Der Flug um die Lampe ist eine virtuos erzählte und vergnüglich zu lesende Selbstdarstellung, aber auch Selbstreflexion, mit der HC Buch, der große Reisende unter den deutschen Schriftstellern, in vielfältigen Erscheinungen den eigenen Standort anpeilt und sichtbar macht. Buch erstaunt die Leser mit seinen poetischen Schatzkisten, prallgefüllt mit Geschichten aus fernen Ländern und macht sie zu Zeugen seiner ungezähmten Fabulierlust.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Christoph BuchsDer Flug um die Lampe vereinnahmt Raum und Zeit, überblendet viele miteinander verwobene Erzählungen und berichtet von bizarren Geschichten, die wie eine Fliege um die Lampe, um ein geheimes Zentrum kreisen. Es geht um die Wiederkehr des Gleichen und die Ungleichheit des Ähnlichen. Nacheinander treten auf: Casanova, der Playboy Porfirio Rubirosa, der Detektiv Nick Knatterton, Elvis Presley, John Reed und Kaiser Maximilian von Mexiko, nicht zu vergessen der weitgereiste Dr. Dingsda und Ötzi, der im Gletschereis gefrorene Steinzeitmann. Buch reist nach China, Afghanistan und last but not least auch Haiti. Entstanden sind unerhörte Geschichten aus dem dichten Erzählfundus HC Buchs. Es sind wilde Alter Egos des Autors, mit deren Hilfe der sich augenzwinkernd und vergnüglich seiner eigenen Identität versichert. Je weiter der Erzählende in seinem neuen Buch voranschreitet, desto ernster werden seine Anmerkungen, münden in Selbstbetrachtung, die Aktualität besitzen: vom Stolperstein für die in Auschwitz ermordete Liane Löw bis hin zur Abrechnung mit dem deutschen Literaturbetrieb.
Der Flug um die Lampe ist eine virtuos erzählte und vergnüglich zu lesende Selbstdarstellung, aber auch Selbstreflexion, mit der HC Buch, der große Reisende unter den deutschen Schriftstellern, in vielfältigen Erscheinungen den eigenen Standort anpeilt und sichtbar macht. Buch erstaunt die Leser mit seinen poetischen Schatzkisten, prallgefüllt mit Geschichten aus fernen Ländern und macht sie zu Zeugen seiner ungezähmten Fabulierlust.
Inhalt
Ephemera Vulgata – statt eines Prologs
Erstes Buch: ICH IST EIN ANDERER
Mein letzter Seufzer
Bacchus und ich
Afghanisches Zwischenspiel
Dr. Dingsda reist nach China
Ab die Post!
Zweites Buch: ELVIS LEBT ODER DIE STIMME AMERIKAS
Drittes Buch: ABTRETENDE ARTISTEN
Eismann, kehr wieder!
Fiesta mexicana
Erschossen im Morgengrauen
Ein Stolperstein namens Liane
Jeder Greis ist eine Bibliothek
Offener Brief an Volker Schlöndorff
Abspann: Letzte Ausfahrt Haiti
Danksagung
»Es macht nichts, wenn der Leser nicht alles versteht, verstünde er alles, würde er sich langweilen« … (György Konrád)
Ephemera Vulgata – statt eines Prologs
Mein Flug um die Lampe dauert nur eine bis zwei Sekunden, aber das ist eine Ewigkeit für Eintagsfliegen wie mich, von denen es weltweit 3000 Arten mit 42 Familien und 400 Gattungen gibt, davon allein 117 in Deutschland, wovon eine, die am Rhein vorkommende Oligoneurella rhenana nur 40 Minuten lang lebt, denn ich werde nicht bei Sonnenaufgang geboren und sterbe bei Sonnenuntergang, wie Aristoteles annahm: Nein, meine Lebensdauer ist länger und kürzer zugleich, und wenn ich nach einjähriger Inkubationszeit, die ich als Larve im Wasser verbringe, vorzugsweise in Bächen, wo ich mich von Pflanzenresten und Algen ernähre und auf Kieseln wachsenden Biofilm abweide, zur Oberfläche aufsteige, um aus der Haut zu fahren und meine Schutzhülle zu verlassen, sind die Fresswerkzeuge verkümmert ebenso wie der mit Luft gefüllte Darm, der das fragile Gehäuse stabilisiert, und ich habe nur noch eine einzige Aufgabe, der meine Facettenaugen ebenso dienen wie die zu Greifarmen entwickelten Vorderbeine, mit denen ich eine zum Hochzeitsflug ausschwärmende weibliche Fliege umklammere und in der Luft begatte. Habe ich diese Pflicht erfüllt, sterbe ich ebenso wie das Weibchen, das vorher seine Eier im Wasser ablegt und Uferwege und Uferstege durch Anhäufung glitschiger Kadaver in Rutschbahnen verwandelt, ein Phänomen, das Johann Christian Schäffer schon 1757 beschrieb in einem Traktat über Uferaas, nicht zu verwechseln mit Ufos, an der Steinbrücke zu Regensburg, aber ich bin älter als Schäffer und dessen Gewährsmann Aristoteles, denn es gab mich schon zur Zeit der Urinsekten des Perm, deren Abdrücke sich in Kohleflözen des Karbon und Bernsteineinschlüssen erhalten haben –
Erstes Buch: ICH IST EIN ANDERER
Mein letzter Seufzer
Ich werde öfters gefragt, ob ich der älteste Mensch oder Mann hier am Ort bin. Die Antwort lautet nein, denn viele Einwohner von Jacmel sind älter als ich, doch die meisten von ihnen sind tot, und die wenigen, die noch am Leben sind, werden bald sterben und mir vorauseilen ins Jenseits, das auf Kreolisch Guinea heißt, das Land ohne Hut, aus dem kein Weg ins Leben zurückführt.
Jacmel ist eine Hafenstadt an der Südküste Haitis, und in einer schwer vorstellbaren Vergangenheit, als Hapag-Lloyd-Dampfer auf der Fahrt von Kingston nach La Habana hier anlegten, arbeitete mein Onkel Toto als Kaffeeröster in einem aus dem 18. Jahrhundert stammenden Gewölbe, das noch heute nach Kaffeebohnen und zum Trocknen ausgelegten Orangenschalen duftet. Fünfzig Jahre später ließ ich mich in Jacmel nieder, um, angelockt von den damals noch günstigen Preisen, im subtropischen Klima meinen Lebensabend zu verbringen.
Nach dem aus Kaffee und Toast mit Guavengelee bestehenden Frühstück nehme ich Platz auf der Terrasse des Hotels de la Place und betrachte die länger werdenden Schatten, die über den Vorplatz wandern, auf dem außer einem Schuhputzer, der sich mit einem Lappen Luft zuwedelt, und einer Marktfrau, die bittere Orangen verkauft, niemand zu sehen ist; steht die Sonne im Zenit, ist der Platz leergefegt.
Ich spiele Schach gegen den Tod, der unsichtbar mit am Tisch sitzt und jede Partie gewinnt, ganz gleich, ob ich sie mit Indisch Grün oder Preußisch Blau eröffne. Nachdem er meine Dame zu Fall gebracht und den König schachmatt gesetzt hat, sammle ich Bauern, Läufer, Springer und Türme ein, und während ich die schwarzen und weißen Figuren in ihre Fächer einordne, frage ich mich, was ich im Leben falsch gemacht habe. Die Antwort ist: Alles, was man falsch machen kann. Aber statt zu erklären, was diese Selbstanklage bezweckt, muss ich klarstellen, wie ich heiße und wer ich bin, bevor der Text, noch ehe er Fahrt aufnimmt, mir aus dem Ruder läuft. Mein Name ist Dingsda, von Freunden Ötzi genannt wegen meiner Ähnlichkeit mit dem im Gletschereis konservierten Steinzeitmann: Ich war und bin Kriegs- und Krisenreporter, Berichterstatter, aber nicht Bestatter von Beruf, obwohl beides schwer voneinander zu trennen ist.
Ich bin viele Tode gestorben und immer wieder Meister Hein von der Schippe gehüpft: Frauen und Freunde haben mich zum Teufel gewünscht und Feinde haben mir Killerkommandos auf den Hals gehetzt. Aber ich will versuchen, die Ereignisse der Reihe nach zu erzählen – der Einfachheit halber fange ich am Ende an. Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts erhielt ich Schweizverbot, ein Wort, das heutzutage niemand mehr kennt. Von meinen damals noch gut dotierten Honoraren hatte ich mir ein Chalet in der Schweiz gekauft, gekoppelt an die Auflage, nicht länger als drei Monate im Jahr dort zu verbringen. Das hart an der Grenze gelegene Haus diente mir als Sommerfrische und Skihütte, Dichterklause und Liebesnest, vor dem weithin sichtbar mein roter Alfa Romeo parkte.
Bösartige Nachbarn – in der Schweiz sind alle Nachbarn böse – alarmierten die Fremdenpolizei, und ich entzog mich den Nachstellungen, indem ich aus dem Fenster des Schlafzimmers sprang, wo ich es mit meiner Praktikantin trieb, und auf deutschem Boden landete. Der Alfa Romeo wurde von den Kantonsbehörden konfisziert, die Praktikantin ebenfalls, und das Schweizverbot von neun Monaten auf drei Jahre verlängert. Ein Unglück kommt selten allein, und als ich mit einem von Max Frisch entliehenen Jaguar in Schlangenlinien die Grenzkontrolle durchfuhr, wurde ich vom deutschen Zoll gestoppt, der mir wegen Alkohol am Steuer den Führerschein entzog und die im Kofferraum gestapelten Banknotenbündel konfiszierte. Die Praktikantin gab mir den Laufpass zugunsten von Max Frisch, und ich beschloss, mein Leben zu ändern.
Ich verkaufte das Chalet weit unter Preis – der Löwenanteil ging für Maklergebühren, Anwalts- und Notarkosten drauf –, und vom verbleibenden Rest erwarb ich ein baufälliges Bauernhaus, eine Fachwerkruine im Zonenrandgebiet, wo keiner mehr leben wollte, weil man einen Atomschlag mit SS-20-Raketen oder die Lagerung hochradioaktiven Mülls befürchtete. Beides lief auf dasselbe hinaus, und periodisch aufflammende Proteste rabiater Atomgegner gegen die noch rabiatere Polizei trugen wenig zum Wohlbefinden der Bürger bei.
Nach der Devise handelnd, dass die Axt im Haus den Zimmermann erspart, krempelte ich mir die Ärmel hoch, verfugte mit Mörtel das Mauerwerk, wechselte Türschwellen und Fußbodendielen aus, die ich mit Holzschutz lackierte, legte Eichenbalken frei und strich sie mit zum Niesen reizendem Insektengift. Ich isolierte Decken und Wände mit asbesthaltigen Dämmstoffen, verlegte Kupferrohre und Stromkabel, schichtete farbige Flaschen übereinander und verkleisterte die Zwischenräume mit Lehm, um einen an Kirchenfenster erinnernden Lichteffekt zu erzielen. Zu guter Letzt erneuerte ich den in den Torbalken geschnitzten Gesangbuchvers: »Hilf dass des Lebens Hitz und Last / die Du mir auferleget hast / mir nicht zu schwer zu tragen sei. / Bricht meines Leibes Haus entzwei / so führ durch Christi Not und Pein / mich Herr in Deinen Himmel ein.«
Ich rollte Teppiche aus, baute Bücherregale, die ich mit alphabetisch aufgereihten Büchern füllte, lagerte Weinflaschen im Keller, dazu ein Fass mit Salzgurken und eins mit Sauerkraut, kochte Marmelade und goss Eingemachtes in Einmachgläser, die ich mit Weckgummi luftdicht verschloss, und als alles getan war, entzündete ich ein Feuer im Kamin, entkorkte eine Flasche Wein, und wie Gott am siebten Schöpfungstag betrachtete ich mein Werk mit Wohlgefallen.
Es kam, wie es kommen musste: Der Nachbar zur Linken walzte den Grenzzaun nieder und schüttete Gift auf meine frisch gepflanzten Stachelbeersträucher; der Nachbar rechts eröffnete einen Schweinemastbetrieb, der die Luft verpestete, meine Freundin, die Max Frisch verlassen hatte und reumütig zu mir zurückgekehrt war, verliebte sich in eine Bäuerin und zog mit ihr in das Schweizer Chalet. Meine Ex-Frau focht den Verkauf des Hauses an, wegen eines Formfehlers gab das Gericht ihr recht, und auf einem Berg von Schulden sitzend, ohne Frau und Freundin, ohne Auto und Führerschein, blieb ich allein in der Fachwerkruine zurück.
Vergeblich goss ich Tee auf, buk Kuchen und schob Braten in die Bratröhre, den ich, um Besucherinnen anzulocken, mit Rotwein ablöschte, aber keine Künstlerin oder Dichterin, keine freie Mitarbeiterin oder Redakteurin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erbarmte sich meiner, ich geriet in Vergessenheit und verschwand schneller in der Versenkung, als das Hervortreten aus der Anonymität und mein kometenhafter Aufstieg gedauert hatten.
Ein Unglück kommt selten allein, und als ich Platz nahm am selbst gezimmerten Schreibtisch, dessen Eichenbretter ich mühsam glatt gehobelt hatte, fiel mir nichts mehr ein. Wie Jack Nicholson als an Schreibblockade leidender Schriftsteller im Film Shining tippte ich von morgens bis abends ein und denselben Satz in meine gute alte Remington. Oder war es ein IBM-Klon?
Nach getanem Tagwerk verlasse ich die in die Dachschräge eingebaute Schreibklausur – Arbeitszimmer klingt zu pompös – und steige über die viel zu steile Treppe, auf der ich mir eines Nachts den Oberschenkelhals brechen werde, in den Keller hinab. Der mit Spitzenweinen aus Bordeaux und Burgund, aber auch mit Mosel- und Ahrwein bestückte Keller ist mein bevorzugter Aufenthaltsort. Doch statt eine Flasche Riesling aus Kloster Eberbach zu entkorken, nehme ich mein Altsaxophon aus dem Koffer, speichle das Bambusblatt ein und blase mir den aufgestauten Frust von der Seele, indem ich Night in Tunisia, Ornithology und Scrapple from the Apple intoniere, drei schwer zu spielende Stücke meines Vorbilds Charlie Parker, die im Regal abgestellte Gläser und Flaschen klirren und scheppern lassen, bis das Telefon klingelt und genervte Nachbarn sich über das kakophone Gedudel beschweren.
Stunden später – es war eine sternklare, frostige Winternacht – öffnet sich wie von Geisterhand die Tür des Weinkellers, und eine dunkle Gestalt tappt schwankend über den Hof, um sich im milchigen Mondlicht an einem kahlen Baum zu erleichtern. Der Hausbewohner, ein Hagestolz und Sonderling, über den abwegige Gerüchte kursieren, scheint betrunken zu sein, denn er stolpert über einen Haufen gefrorener Äpfel – oder sind es Kartoffeln? –, auf dem er hilferufend liegen bleibt. Seine Rufe werden schwächer und gehen in Flüche und lautloses Murmeln über, während er sich wie im Wasserbett auf der beweglichen Unterlage hin- und herwälzt und vergeblich aufzustehen versucht. Dies scheint das Jenseits zu sein, nicht die Hölle, eine Vorhölle vielleicht, ein von Dante geschilderter Limbus, in dem es nach Apfelmus und Kartoffelbrei riecht, eine rheinische Spezialität, die Himmel und Erde heißt, und das letzte Bild, das er, als ihm die Augen zufallen, vor sich sieht, ist der Große Bär, Ursa Major, auch Großer Wagen genannt. Dabei fällt ihm ein, dass er keinen Führerschein und auch kein Auto mehr besitzt, die Kälte kriecht in die Hosenbeine und weiter hoch bis zur Brust, und er gleitet hinüber in traumlosen Schlaf –
Bacchus und ich
Im Schlaf beschenkt Gott mich mit Geschichten, von denen ich nicht weiß, woher sie kommen und wohin sie mich führen werden. Unklar bleibt, wer von uns beiden schläft und wer was träumt – träume ich Gott oder träumt Gott mich? Oder findet der Traum ohne sein und mein Zutun statt – wenn ja, in wessen Kopf?
Im Traum bin ich Casanova, der sich von hinten an die Marquise d’Urfé drängt, eingekeilt in eine Zuschauermenge, die von einem erhöhten Blickpunkt aus, einem Dachfenster oder einem Balkon, der Hinrichtung des Attentäters Damiens beiwohnt, eines geistig verwirrten Mönchs, der mit Messerstichen Ludwig XV. zu töten versuchte – oder war es Ludwig XVI.? Während der Henker, Maître Sanson, ihm die Knochen bricht und flüssiges Blei in die Wunden des Delinquenten gießt, der mit unartikulierten Schreien den Tod herbeiwünscht, dränge ich mich an den Hintern der Marquise, zeitgleich mit dem Moment, in dem sechs Pferde den Attentäter in Stücke reißen, was nicht ganz gelingt, der blutige Stumpf zuckt noch, Haupthaare und Bart werden schlohweiß, und während Madame Pompadour, die Maîtresse des Königs, in eine Porzellanschüssel kotzt, beschließt dieser, die aus dem Mittelalter stammende Form der Hinrichtung abzuschaffen und in Zukunft eine humanere Methode anzuwenden, die sein Leibarzt Doktor Guillotin empfiehlt, ohne vorauszuahnen, dass er selbst auf der Guillotine zu Tode kommen wird.
Das ist nur das Vorspiel zu meinem Traum: Um sich erkenntlich zu zeigen, lädt die Marquise mich zu einer Kutschfahrt ein und bekommt, als sie sich aus dem Fenster beugt, um einen vorbeireitenden Kavalier zu grüßen, eine Ohrfeige verpasst, die ein Wundmal auf ihrer Wange hinterlässt, das ich mit Zinksalbe bestreiche, wobei unklar bleibt, ob ihr der Hieb mit der flachen Hand, mit einer Säbelklinge oder von einem zurückschnellenden Zweig versetzt worden ist. Letzteres scheint mir am wahrscheinlichsten, und ich rate der Marquise, Anzeige zu erstatten, der das Gericht in zweiter Instanz stattgibt: Obwohl oder weil der Kavalier sich außerhalb der Reichweite der Marquise befand, folgen die Geschworenen meiner Argumentation, dessen Hund, ein Dobermann, sei bellend am Kutschbock hochgesprungen und habe das Vor- und Zurückschnellen eines Asts ausgelöst, der die Wange der Marquise traf – vielleicht war es auch ein eifersüchtiger Ehemann oder Liebhaber, der ihr die Ohrfeige verpasste. Der Marquise wird ein üppiges Schmerzensgeld zugesprochen, das sie aus Dank für die Rechtsberatung auf das Doppelte erhöht und mir zur Verfügung stellt. Hier endet mein Traum, dessen Fortsetzung im Jardin du Luxembourg spielt.
***
Die Figurengruppe, die ich beschreiben will, widerspricht der von Lessing aufgestellten Regel, wonach die Bildhauerkunst Körper im Raum und keine Handlungsabläufe darstellen soll, die auf der Bühne oder heutzutage im Film besser zur Geltung kommen. Der olivgrün verfärbte Bronzeabguss steht auf einem mit Krokussen bepflanzten Rondell in der Südostecke des Jardin du Luxembourg und stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. Das Chaos der Bewegungen, der Wirrwarr ineinander verschlungener Körperteile von Mensch und Tier nimmt die Krise traditioneller Sehweisen vorweg und weist voraus auf die Explosion oder Implosion traditioneller Werte in der modernen Malerei, obwohl von Neubeginn nicht die Rede sein kann, eher von rückwärtsgewandtem Klassizismus: Sogar die Laokoon-Gruppe wirkt übersichtlich im Vergleich zu dem Menschenknäuel, das selbst ein Spezialist für Schifferknoten nicht aufdröseln könnte, und das Patentrezept Alexanders des Großen, den gordischen Knoten mit dem Schwert zu durchschlagen, hilft hier nicht weiter.
Am höchsten Punkt der Pyramide – wie Géricaults Floß der Medusa und Picassos Guernica hat die Bronzegruppe die Form einer sich verjüngenden Spirale aus Menschen- und Tierleibern –, am höchsten Punkt also schwebt, wie das Auge des Heiligen Geistes, der in den Nacken gelegte Kopf eines Silens, laut Hinweistafel ein Ziehvater des Bacchus, wobei ich das Wort nourricier irrtümlich auf Ammen bezog, ein männlicher Ziehvater also, der dem ihm anvertrauten Knaben statt Muttermilch Wein einflößt. Dazu passt der Ausdruck seliger Trunkenheit im Gesicht des Silens, umrahmt von einem flaumigen Backenbart, wie Nero ihn in Hollywoodfilmen trug, als er zu den Klängen seiner Lyra Rom in Flammen aufgehen ließ. Doch der Silen ist nackt und bedeckt seine Blöße mit einem Leopardenfell, das die Speckfalten seines Bauchs hervortreten lässt. Gleichzeitig hieven drei Männer und eine Frau, dem verzückten Gesichtsausdruck nach eine Mänade, den trunkenen Gott auf den Rücken eines Esels, was ihnen nur halb gelingt, der Silen macht sich schwer oder stellt sich tot wie ein Ertrinkender, der sich seinem Retter widersetzt: Der Esel macht einen Bocksprung, um den übergewichtigen Reiter abzuwerfen, seine Hinterbeine rudern durch die Luft, darüber der wedelnde Schwanz, der sonst zur Abwehr von Fliegen dient, und schnappt mit geblecktem Gebiss nach den Weintrauben, die ein fetter Knabe, Bacchus vielleicht, ängstlich an die Brust drückt, während eine von dem Esel überrannte Mänade, vermutlich die Mutter des Jungen, dem tobenden Tier in die Nüstern greift, um es daran zu hindern, den Jungen zu beißen, dessen älterer Bruder erfolglos den Esel zu bändigen versucht. Auf der Rückseite der Bronzegruppe reckt sich ein mit Lendenschurz bekleideter Greis und stützt mit seinen Schultern den Silen, um dessen Abgleiten vom Eselsrücken zu verhindern. Im Vordergrund, vom Betrachter aus rechts, greift ein bärtiger Mann dem Grautier in die Zügel, die unter Überdruck zerreißen, während der Esel den Freund oder Bruder des Mannes niederwirft, nur strampelnde Beine ragen aus dem Durcheinander hervor, das an eine Sexorgie erinnert oder an eine Kampfszene aus Homers Ilias – bei Licht betrachtet zwei Seiten derselben Sache. Noch rätselhafter ist ein umgekippter Korb, aus dem wie Hoden geformte Weintrauben quellen, die der Knabe zwischen den Schenkeln hervorpresst, so dass das Ganze auch eine Weinlese oder Kelter darstellen könnte, bei der Männer, Frauen und Kinder barfuß auf Bergen von Trauben herumtanzen. Was in der Beschreibung fehlt, ist der Lorbeerkranz des Silens und ein mit Weinlaub umkränzter Thyrsos, eine Art Zepter, das dem Gott aus der Hand geglitten ist.
***
Im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte nicht mehr gewusst als das, was ich die Figurengruppe umschreitend mit eigenen Augen sah. Aber ich hatte den Fehler gemacht, den Namen des Bildhauers ins Suchprogramm meines Computers einzugeben, und dadurch nicht nur meine Auslegung, sondern auch die Aura des Kunstwerks unwiderruflich zerstört.
Aimé-Jules Dalou kam 1838 in Paris zur Welt; seine Eltern waren Calvinisten und Republikaner und stammten aus Gent. Das künstlerische Talent des Jungen trat früh zutage, und er schloss Freundschaft mit Auguste Rodin, der nach seinem Tod Dalous Porträt modellierte. Die Académie des Beaux-Arts verweigerte ihm den Prix de Rome; Dalou blieb ein Außenseiter und nahm aktiv am Aufstand der Pariser Kommune teil. Von Gustave Courbet zum Direktor der staatlichen Kunstsammlung ernannt, bezog er mit Frau und Kindern im Louvre Quartier, um das Museum vor Plünderern zu schützen. Nach der Niederschlagung des Aufstands floh Dalou nach London und wurde in absentia zu Zwangsarbeit und Verbannung verurteilt. 1889, auf der Weltausstellung in Philadelphia, lehnte er es ab, seine Arbeiten im französischen Pavillon zu zeigen, und verlangte eine vollständige Rehabilitierung durch die Regierung, die mehrere seiner Arbeiten erwarb. Nach Paris zurückgekehrt, schuf er monumentale Figurengruppen wie den Triumph der Republik, Mirabeaus Antwort an den Abgesandten des Königs und die Apotheose des Arbeiters, in Stil und Komposition an Rodins Bürger von Calais erinnernd, aber auch Büsten von Delacroix, Courbet und anderen ihm persönlich nahestehenden Künstlern.
Das Werk von Aimé-Jules Dalou, der eine debile Tochter hatte und ein Heim für geistig behinderte Kinder gründete, war auch ästhetisch progressiv. Bei oberflächlicher Betrachtung wirkt seine Bildsprache rückwärtsgewandt mit Blick auf die historischen, allegorischen und mythologischen Sujets seiner Kunst – in Wahrheit war sie unkonventionell, vorwärtsdrängend und zukunftsorientiert: Dalou löst die glatte Oberfläche der Skulptur auf in ein Meer wild bewegter Details, die wie Wrackteile in sturmgepeitschter See durcheinanderwogen, und nimmt so die Formzertrümmerung der Kubisten und Futuristen vorweg.
Afghanisches Zwischenspiel
»Schreibst noch ein, zwei schöne Bücher«, sagte F., als er schwer atmend von ihr abließ – seit er mit Rhythmusstörungen in die Notaufnahme eingeliefert worden war: Vorhofflimmern war der Fachausdruck dafür – war nichts mehr so wie zuvor: »Schreibst noch ein, zwei schöne Bücher – dann hat sich das!« Der Satz traf ins Schwarze, und damit ist nicht der Mutterschoß gemeint, aus dem er einst ans Licht gekrochen war, sondern ein Materie in Antimaterie verwandelndes Loch im All, auf das er zuraste in sich beschleunigender Abwärtsspirale: Down the drain, wie man auf Englisch sagt. Wie stets hatte F. hatte recht, und ihr hessischer Akzent verstärkte das Niederschmetternde der Mitteilung, wonach seine Bücher – fünfzig Titel, Sammelbände nicht mitgezählt – alles Mögliche gewesen waren, aber nicht schön: klug oder klugscheißerisch vielleicht, aber nicht schön!
Auch der vorliegende Text, sagte er sich, während er ihren Büstenhalter zuhakte, sei nicht schön, und falls je ein Buch daraus würde, würde es ihren Schönheitssinn nicht befriedigen. Jeder liefert jedem Qualität lautete ein Propagandaslogan der untergegangenen DDR: Wenn alle ziehn am gleichen Tau / erreichen wir das Weltniveau: Die ostdeutsche Variante von: I can’t get no satisfaction. Und er dachte daran, dass und wie Essen, Trinken und Fernsehen früher als Vorspiel gedient hatten für Sex, während es heute umgekehrt war, aber auch das stimmte so nicht.
***
Im Vorbeigehen hörte er das Wort Taliban, eine Frauenhand, an der ein Ring aufblitzte, zog ihn in den Schatten eines Torbogens, und nach oben blickend sah er, dass der Schlussstein, der das Gemäuer aufrecht hielt oder einstürzen ließ, sich genau über seinem Scheitel befand. Dabei fiel ihm ein, dass Talib auf Arabisch Schüler bedeutet, und Taliban kein Plural, sondern die Dualform ist: zwei Schüler also. Vielleicht war das der Grund, warum die Taliban stets zu zweit auftraten: Einer bedrohte den Fahrer mit entsicherter Kalaschnikow, während sein Kompagnon oder Komplize den Kofferraum durchsuchte und der Beifahrerin den Schleier vom Gesicht schob – eine Geste, die wortlos signalisierte, wer hier das Sagen hatte. Mit ihren dunkelblauen Turbanen und hennaroten Vollbärten wirkten die Talibankämpfer wie Folkloredarsteller aus einem Technicolorfilm: Der Tiger von Eschnapur vielleicht. Kein Wunder, dass die als aufmüpfig geltenden Bewohner von Kabul, die immer neue Eroberungswellen hatten kommen und gehen sehen, sich beklagten, der Unterschied zwischen Ordnungshütern und Banditen sei zur quantité négligeable geworden. Anders als bei Polizei und Armee des alten Regimes, die kampflos kapitulierten und mit Lastwagen und Jeeps Hals über Kopf flohen unter Zurücklassung ihrer Uniformen und schweren Geräts, war es nicht möglich, Vorgesetzte von Untergebenen zu unterscheiden, weil die Taliban weder Rangabzeichen noch Namensschilder trugen. Die militärisch korrekte Ansprache aber war unerlässlich für Reporter und Journalisten, sagte er sich, während er, an der Hand vorwärtsgezogen, ins Labyrinth der Kasbah eintauchte.
Aber gab es überhaupt noch eine Altstadt in Kabul? Was nicht den Bomben der Sowjets und später der US Air Force, dem Raketenbeschuss der Mudschahedin oder dem Vormarsch, Rückzug und erneuten Vormarsch der Taliban zum Opfer fiel, waren nur kümmerliche Reste der ringförmigen Bebauung rund um den Königspalast, wo einst Teppichweber, Barbiere, Bäcker und Metzger, nach Quartieren getrennt, ihre Gewerbe ausübten: Nicht erst der Krieg, schon eine 1949 erbaute Autostraße durch die Kasbah hatte den Lebensfaden der Altstadt zerschnitten. Inzwischen war Kabul zu achtzig Prozent zerstört, während die Einwohnerzahl von 700.000 auf drei Millionen hochschnellte. Wo einst Brunnen plätscherten, schattige Innenhöfe, Teestuben und Basare zum Verweilen einluden, wirbelten Windböen Sand auf, der das Atmen erschwerte, und Flüchtlinge aus dem Landesinnern nahmen leer stehende Häuser und Ruinen in Besitz.
Er durchschritt den engen Durchgang zwischen zwei Lehmhütten und trat auf einen mit Glasscherben gesprenkelten Platz, über den der Wind Plastikbeutel trieb, die sich in einer Stacheldrahtrolle verhakten; vielleicht war es auch ein Dornbusch, der, ohne Wurzeln zu schlagen, nach der Schneeschmelze aufblüht. Sich umwendend, sah er, dass er allein war. Die Frau oder das Kind, das ihn vorwärtsgezogen hatte, waren, als hätte es sie nie gegeben, vom Erdboden verschluckt. Nichts war zu sehen außer einem streunenden Hund, der mit eingekniffenem Schwanz um eine Hausecke schlich. Seine Überlebenschancen waren gering, und wie zur Bestätigung prasselte ein Steinhagel auf das Tier, das jaulend davonsprang.
Es war nicht sein erster Aufenthalt in Kabul – er hatte aufgehört zu zählen, wie oft er Afghanistan besucht hatte. Besucht war das falsche Wort, denn er war kein Orientreisender und auch kein Rucksacktourist, eher ein Rucksackreporter, unterwegs in Weltgegenden, die für Starjournalisten zu ungemütlich oder zu gefährlich waren. Das Ganze war weniger eine Frage des Muts als ein Versicherungsproblem, und weil er keine Ansprüche stellte, übernahm er riskante Jobs, für die hochdotierte Redakteure sich zu schade waren. In letzter Zeit aber war es still geworden um ihn, da er auf die Rente zusteuerte und Sätze mit Subjekt, Prädikat und Objekt schrieb, die mehr als bloße Bildunterschriften waren: Schreiberlinge gab es wie Sand am Meer, Fotografen hingegen waren Mangelware und wurden besser bezahlt.
Der Pool freier Mitarbeiter, aus dem überregionale Zeitungen sich bei Bedarf bedienten, ähnelte einem Haifischbecken, und weil er der Dienstälteste war, wurde er von seinen Kollegen Ötzi genannt. Trotzdem überraschte es ihn, als eine Wochenzeitung anfragte, ob er bereit sei, mit einer Transportmaschine der Bundeswehr nach Kabul zu fliegen, um für deutsche Medien von dort zu berichten. Es war der letzte Transportflug, zusammen mit Diplomaten und Militärs wurden Mitarbeiter von Hilfsdiensten und Ortskräfte von dort abgezogen, und seine Antwort stand von vornherein fest: Die chaotische Übergangsphase von der Präsenz der Internationalen Gemeinschaft zur Herrschaft der Gotteskrieger interessierte ihn, und nach dem Weggang der Weltpresse würde er problemlos Abnehmer finden für seine Berichte.
Er wusste nicht, wessen Hand es war, die ihn durch einen Türvorhang in den Hausflur zog. Nein, Vorhang war zu hoch gegriffen, es war ein versiffter Teppich zur Abwehr von Sand und Staub, und dabei fiel ihm eine Redensart ein, die er seit Jahren nicht mehr gehört hatte: Habt ihr Säcke vor den Türen? Hier stimmte der dumme Spruch, und er folgte der verschleierten Gestalt, die auf leisen Sohlen, Gummilatschen vielleicht, die Treppe hochstieg und ihn in eine Art Empfangsraum führte. Zu seiner Überraschung war er nicht allein, ein GI in gescheckter Tarnuniform saß auf einem Kissen am Boden und rückte beiseite, um ihm Platz zu machen, während eine mit Burka verschleierte Frau Tee servierte.
Ötzi hatte keine Ahnung, was er hier suchte und wo er sich befand. Am Vortag hatte er sich im Informationsministerium akkreditiert und auf Befragen erklärt, einen hochrangigen Talibanführer sprechen zu wollen, Dschihadi John oder Mullah Omar vielleicht, und der Pressesprecher Zabihullah Mudschahid konnte sich das Lächeln nicht verkneifen unter seinem sorgsam getrimmten Bart, denn beide waren schon lange tot. Vielleicht handelte es sich um eine Geiselnahme, und er war sehenden Auges in die Falle getappt: Wie ein Gefechtsstand sah das Haus in der Kasbah nicht aus, eher wie ein Drogendepot oder eine Opiumhöhle; auch der GI in Tarnuniform wirkte nicht gerade vertrauenerweckend.
***
Mein Name ist Jack, ich bin als erster GI im Oktober 2011 hier gelandet und werde der letzte sein, der Kabul verlässt: Schauen Sie genau hin, wenn ich in einem mit Nachtsichtkamera aufgenommenen, grünstichigen und verwackelten Film hinter einem Transportflugzeug herlaufe, von helfenden Händen emporgezogen, ehe die Heckklappe sich hinter mir schließt und die Maschine von der Rollbahn abhebt, an deren Fahrwerk sich Flüchtlinge klammern, die kurz darauf wie Steine vom Himmel fallen. Und denken Sie daran, dass Bilder lügen können, dass ich möglicherweise am Boden zurückgeblieben bin, um einer anderen Aufgabe nachzugehen an einem anderen Ort, im Pandschir-Tal vielleicht, wo ich ein Widerstandsnest aufbaue als rechte Hand von Massud junior, dem Sohn des legendären Mudschahedin-Führers, denn wir Special Forces und Navy Seals sind vielseitig verwendbar und werden immer, überall und zu allen Zeiten gebraucht.