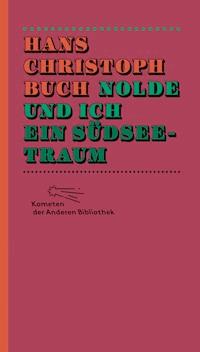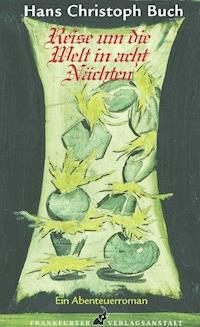Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
H. C. Buch ist der große Reisende unter den deutschen Schriftstellern. Seine Bücher sind Schatzkisten, prallgefüllt mit Geschichten aus fernen Ländern, Zeugen seiner ungezähmten Fabulierlust. Mit seinem neuen Roman betritt er jedoch unbekanntes Terrain. Zum ersten Mal im literarischen Kosmos von H. C. Buch steht die Familie des Autors im Mittelpunkt: sein Vater, der Diplomat, der Shakespeare und die Bibel im Original las, seine Mutter Rut, die nach einer Kopfoperation zu malen begann und im Frühjahr 1960 Picasso besuchte, sein Großvater, der Ende des 19. Jahrhunderts nach Haiti auswanderte, die Pharmacie Buch gründete und eine Haitianerin heiratete. Doch damit nicht genug, denn "jede Familie birgt ein dunkles Geheimnis, das nicht besprochen, sondern beschwiegen werden soll." Und so beginnt der Roman nicht ohne Grund an einem der stillsten und kältesten Orte der Welt, mitten in der Antarktis, auf dem Eisbrecher Almirante Irizar. Für Hans Christoph Buch gibt es nur eine, vielleicht die nachhaltigste, mit Sicherheit aber die schönste Art, das Eis des Schweigens zu brechen: mithilfe der Literatur, der Axt für das gefrorene Meer in uns.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. C. Buch ist der große Reisende unter den deutschen Schriftstellern. Seine Bücher sind Schatzkisten, prall gefüllt mit Geschichten aus fernen Ländern, Zeugen seiner ungezähmten Fabulierlust. Mit seinem neuen Roman betritt er unbekanntes Terrain. Zum ersten Mal steht die Familie des Autors im Mittelpunkt: sein Vater, der Diplomat, der Shakespeare und das Neue Testament im Original las, seine Mutter Rut, die nach einer Kopfoperation zu malen begann und im Jahr 1958 Picasso besuchte, sein Großvater, der Ende des 19. Jahrhunderts nach Haiti auswanderte, die Pharmacie Buch gründete und eine Haitianerin heiratete. Damit nicht genug, denn »jede Familie birgt ein dunkles Geheimnis, das nicht besprochen, sondern beschwiegen werden soll«.
Und so beginnt der Roman nicht ohne Grund an einem der stillsten und kältesten Orte der Welt, mitten in der Antarktis, auf dem Eisbrecher Almirante Irizar. Für Hans Christoph Buch gibt es nur eine, vielleicht die nachhaltigste, mit Sicherheit aber die schönste Art, das Eis des Schweigens zu brechen: mithilfe der Literatur, der Axt für das gefrorene Meer in uns.
»Mit jeder Drehung der Schraube drang ich tiefer ins fahle Innere des Eisbergs vor. Mit jeder Schicht veränderte sich meine Sicht. Der Eisberg wurde für mich zu einer Person, und je lichter er wurde, desto stärker fühlte ich so etwas wie Verlust, ja Vergänglichkeit.«
Jules Verne: Die Eissphinx
INHALT
VORSPANN
Erstes Buch: WER BIN ICH?
Russland nackt
Kaukasische Nemesis
Sok Sinn oder die Rast am Nudelberg
Die Verlobung in Port-au-Prince
Zweites Buch: WOHER KOMME ICH?
Sätze über meinen Vater
Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß
Der Freund meines Vaters
Erziehung durch Tanten
Drittes Buch: WOHIN GEHE ICH?
Reise zum Pol der relativen Unzugänglichkeit
Birds of Central America
Ultima Thule
VORSPANN
1
Es gibt viele Arten, das Eis zu brechen: Durch Aufhacken und Zerkleinern des Eises mit dem Schiffsrumpf zum Beispiel, indem man Wasser von Backbord nach Steuerbord pumpt und so das Schiff in schlingernde Bewegung versetzt. Wenn das nichts nutzt, nimmt der Eisbrecher Almirante Irizar, 1978 auf der Wärtsila-Werft in Helsinki gebaut und getauft auf den Namen eines argentinischen Seeoffiziers, der 1903 der im Packeis eingeschlossenen Nordenskjöld-Expedition zu Hilfe kam, Anlauf und schiebt sich mit seinen 4.600 Bruttoregistertonnen auf die drei Meter dicke Eisdecke, wobei der Kapitän darauf achten muss, dass das Schiff nicht ausschert und wie ein gestrandeter Wal zur Seite rollt. Krachend zerbirst das Eis und gleitet polternd am Schiffsrumpf entlang, dessen stählerne Bordwand die Besatzung von minus zwei Grad kaltem Meerwasser trennt, das aufwallt wie siedendes Teewasser, bevor es von flüssigem in festen Zustand übergeht. Dafür ein Beispiel: Das Eismeer oder die gescheiterte Hoffnung hat Caspar David Friedrich sein 1824 entstandenes, berühmtes Gemälde genannt, das keinen Schiffsuntergang, sondern das Scheitern seines Lebenstraums zeigt: Nur das Heck des Schiffes mit dem Maststumpf sowie Teile der Takelage ragen aus ineinander verkeilten Eisschollen hervor, die je nach Blickwinkel die politische Restauration oder die Kälte und Gleichgültigkeit der sozialen Umwelt symbolisieren. Aber auch eine persönliche Lesart des Bildes ist möglich, weil der Maler in jungen Jahren beim Schlittschuhlaufen ins Eis einbrach und von seinem kleinen Bruder gerettet wurde, der dabei ums Leben kam: Ein Kindheitstrauma, das Caspar David Friedrichs Welt- und Kunstanschauung prägte. Dazu passt, dass Franz Kafka das Buch als Axt für das gefrorene Meer in uns bezeichnete und dass der Dichter Wladislaw Chodasewitsch im Knirschen russischer Konsonanten den Zusammenprall aufeinander geschobener Eisblöcke zu hören glaubte: Ein Vorbote des Tauwetters, das einer Literaturepoche den Namen gab und den Kalten Krieg beenden half.
2
»Es gibt elf Arten von Eis in der Antarktis«, sagte Korvette hoch zwei, so genannt, weil er Corbetta hieß, Korvettenkapitän war und in seiner Freizeit Korvetten malte: »Eissuppe, Eisbrei, Plätzcheneis, Pfannkucheneis, Torteneis, Tafeleisberge, Eisburgen, Eisschlösser, Eispaläste, Eispyramiden und Eiskathedralen, aus deren Rissen und Spalten violettes Licht strahlt, als würden im Inneren bengalische Feuer abgebrannt. Das Eis schmilzt von unten ab, und wenn ein Eisberg seinen Schwerpunkt verlagert, löst er eine Flutwelle aus, die Schlauchboote kentern lässt, bevor er seine mit Rotalgen bewachsene oder wie Roquefort marmorierte Unterseite nach oben kehrt.«
»Salzwasser gefriert bei minus 2,2 Grad«, fuhr er fort und klirrte mit den Eiswürfeln in seinem Whiskyglas: »Es gibt elf Eissorten, wie gesagt, und ebenso viele Arten, das Eis zu brechen, außer man ist mit einem atomgetriebenen Eisbrecher unterwegs, der durch Verwirbelung Blasen erzeugt, die das Eis porös machen, oder kochend heißes Wasser ausstößt, das die Eisdecke schmilzen lässt – Methode zwölf und dreizehn. Ich spreche von Meereis, wohlgemerkt, nicht vom Inlandeis der Antarktis. Wissen Sie, was ein Nunatak oder ein Trockental ist? Und kennen Sie den katabatischen Wind, der die Eisdrift in Bewegung setzt und im antarktischen Sommer die Fahrrinne durch das Weddellmeer offenhält?«
»Als ich am Südpol überwinterte«, seufzte General Leal, der Nestor der argentinischen Antarktisforschung, »gab es keine atomgetriebenen Eisbrecher, nur amerikanische und sowjetische Atom-U-Boote, die um ein Haar kollidiert wären, als sie sich im Weddellmeer begegneten, unter dem Eis natürlich. Übrigens war es am Südpol mollig warm. Unsere Wohncontainer in Scott Base waren dermaßen überheizt, dass wir nackt herumtollten und einander mit Schneebällen bewarfen. In Scott Base gab es einen Psychotherapeuten, genannt Shrink, zur Betreuung der Huskys, die unruly waren, weil sie keinen Auslauf hatten.« Später habe man die Schlittenhunde durch Motorschlitten ersetzt, die in Gletscherspalten fielen, weil Motorschlitten, anders als Huskys, Risse im Eis nicht riechen können. Daran sei Greenpeace schuld, fügte General Leal hinter vorgehaltener Hand hinzu, eine internationale Organisation, die von Kommunisten und Homosexuellen unterwandert sei. Leider seien der Armada Argentina seit dem Malwinen-Krieg die Hände gebunden, aber unter der Militärjunta habe man gelernt, scharf durchzugreifen und subversive Elemente nicht mit Samthandschuhen anzufassen.
»Das Problem im Zivilleben ist der Mangel an Disziplin«, warf ich ein, General Kühlmann-Stumm zitierend, den Erforscher des Zivilverstands in Robert Musils Mann ohne Eigenschaften, ohne zu bemerken, dass ich mich in vorauseilendem Gehorsam dem Militärregime unterwarf. »Aber ich wüsste trotzdem gern, warum die Almirante Irizar seit einer Woche im Zickzack durch eine immer enger werdende Fahrrinne fährt, während die Sonne wie eine Flipperkugel, die niemals Tilt macht, um den Horizont rotiert. Wohin geht die Reise?«
Der Kurs des Schiffes unterliege der Geheimhaltung, antwortete Korvette hoch zwei in scharfem Ton, Debatten darüber seien verboten an Bord. Er sei menschlich enttäuscht von mir, setzte er vertraulich hinzu und blickte versonnen in sein Whiskyglas, als sei dort, zwischen Eiswürfeln, die Antwort auf meine Frage zu finden. »Gerade Sie als Reiseschriftsteller sollten wissen, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten keine gerade Linie, sondern eine Ellipse ist. Haben Sie schon mal was von der Krümmung des Universums gehört?«
Erstes Buch: WER BIN ICH?
RUSSLAND NACKT
1
»Sie werden Gelegenheit haben, Schaschlik zu essen«, rief Wladimir Slonimski, von Freunden Wolodja genannt, und beugte sich so weit vor, dass seine Hornbrille auf die von Alkohol gerötete Nase rutschte und ich in seine von geplatzten Äderchen marmorierten Augen sah. Um beim Thema Alkohol zu bleiben: Vor uns, auf einem mit Plastikblumen dekorierten Couchtisch, standen eine Karaffe Kognak, eine mit Weinbrandbohnen gefüllte Kristallschale und ein von Kippen überquellender Aschenbecher, und Wolodja zündete sich eine Zigarette an, keine Papirossa mit dem Emblem des von Puschkin besungenen ehernen Reiters, sondern eine Peter Stuyvesant, der Duft der großen weiten Welt, den Peter der Große als Zar und Zimmermann in Holland geatmet und per Ukas in Russland eingeführt hatte.
Wladimir Slonimski war Hauptmann des KGB, aber das wusste ich damals noch nicht, ich wusste nur, dass er bei Lew Kopelew Germanistik studiert hatte, und ahnte instinktiv, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zuging, denn angeblich arbeitete Wolodja – er bestand darauf, dass wir ihn beim Vornamen nannten – an einer Geschichte der Westberliner Literatur und hatte uns, den Hörspielautor Martin K., die Malerpoetin Sarah H. und mich, den Kritiker H. C. Buch, nach Moskau eingeladen, um Gespräche zu führen über Westberliner Literatur. Bekanntlich war Deutschland nicht nur zwei-, sondern dreigeteilt, und die Literatur der selbstständigen Einheit Westberlin, kurz WB genannt, war ein unbeackertes Feld, dessen Erforschung von aktuellem Interesse war, seitdem sich dort junge Autoren zu Wort gemeldet hatten, die lautstark die Anerkennung der realen Gegebenheiten forderten: Damit war der antifaschistische Schutzwall gemeint, den nicht die UdSSR, sondern die DDR errichtet hatte – auf diesen kleinen Unterschied legten unsere Gesprächspartner in Moskau großen Wert. Das Wort »seitdem« bezog sich auf das Jahr 1968, dessen Bedeutung die Kremlherren sträflich ignoriert hatten, ebenso wie die Anziehungskraft eines Desperados namens Che Guevara auf die politisch noch ungefestigte Jugend der Welt, eine Fehleinschätzung, die der Chefideologe Suslow freimütig eingeräumt und nachträglich korrigiert hatte.
Hätte ich gewusst, dass Wladimir Slonimskis Karriere beim KGB mit dem Diebstahl eines handgeschriebenen Briefs von Bertolt Brecht an Boris Pasternak begonnen hatte, den er nach der Wende meistbietend auf einer Auktion versteigerte, hätte ich das Büro des Schriftstellerverbands empört verlassen, dessen Wand kein Breschnew-Bild, sondern ein Porträt von Tolstoi schmückte: eine Bleistiftskizze genauer gesagt, angefertigt von Pasternaks Vater, dem Maler Leonid Pasternak, die den alten Tolstoi im Bauernhemd zeigt, wie er mit der Sense Heu mäht: »Er dachte an nichts anderes und war nur von dem einen Wunsch beseelt, nicht hinter den Bauern zurückzustehen und seine Arbeit so gut wie möglich zu verrichten. Er hörte nichts als das Sausen der im Halbkreis geschwungenen Sensen und sah vor sich die sich langsam und wellenförmig über die Schneide neigenden Gräser und Blumenköpfchen und ganz vorn das Ende der Reihe, wo Erholung winkte.«
Daran musste ich denken, während Wladimir Slonimski sich und uns Wassergläser vollschenkte mit Kognak, keinen Hennessy oder Courvoisier, sondern armenischen Kognak Marke Ararat, und dazu Karamellbonbons und Zigaretten anbot, Peter Stuyvesant Made in FRG, so hieß die Bundesrepublik auf Russisch, und lächelnd die Goldkronen entblößte, die er sich statt der in Russland üblichen Goldzähne von einem kommunistischen Zahnarzt in Westberlin zum Vorzugspreis, vielleicht sogar gratis, hatte anpassen lassen. Und während der KGB-Mann Rauchkringel blies, denen er sinnend nachblickte in Gedanken an den Duft der großen weiten Welt, der jetzt sein Büro erfüllte, starrte ich durch nikotinhaltigen Nebel auf das Bild des Sensenmannes in Bastschuhen und Bauernkittel, den mein Lehrmeister Wiktor Borisowitsch Schklowski als Schüler in Jasnaja Poljana besucht und über den er gesagt hatte: »Als Tolstoi starb, schrieb seine Hand noch.« Beim Blick auf den adligen Bauernbefreier, der gebückt die Sense schliff, dachte ich an eine von Lewin, dem Gutsbesitzer in Anna Karenina, inspirierte Szene in einem anderen kanonischen Text, dessen Autor Persona non grata war in der Sowjetunion: Alexander Solschenizyns Erzählung über den Gulag-Häftling Iwan Denissowitsch, der den Auftrag, eine Mauer zu bauen, die bei Tauwetter nicht wieder einstürzt, nur erfüllen kann, indem er die Kommandantur hintergeht und einen Sack mit Mörtel unter der Bettdecke wärmt: »Schwupp, den Mörtel! Schwupp, den Mauerstein! Angedrückt. Geprüft. Mörtel. Blockstein. Mörtel. Blockstein … Der Brigadier hat zwar befohlen, mit dem Mörtel nicht zu sparen. Über die Mauer und weg damit. Aber Schuchow tut jede nicht gut gemachte Arbeit leid, und er fürchtet, er könne etwas verderben. Selbst nach acht Jahren Lager kann man ihm das nicht abgewöhnen. Schuchow – mag ihn das Begleitkommando jetzt mit Hunden hetzen – tritt noch einmal zurück und schaut sich um. Von rechts, von links. Die Augen dienen als Wasserwaage – gerade!«
Nikita Chruschtschow soll nach der Lektüre des Texts geweint und Suslow, der die Druckerlaubnis nur widerwillig erteilte, anvertraut haben, er habe nicht gewusst, wie fleißig und aufopferungsvoll die Lagerhäftlinge arbeiteten, während er im Politbüro von Drückebergern und Bummelanten umgeben sei.
2
»Die Zeitschrift des Komsomol ist ein Forum für junge Talente«, erklärte der stellvertretende Chefredakteur, der uns mit Kaffee und Konfekt in seinem Moskauer Büro empfing. »Greift zu, Genossen!« – Wir sind keine Genossen, hörte ich mich sagen, sondern parteilose Mitglieder des Schriftstellerverbands, die sich vor Ort, aus erster Hand, über das literarische Leben in der UdSSR informieren möchten. Und Sarah, die mich begleitende Malerpoetin aus Westberlin, wollte wissen, ob die Zeitschrift des Komsomol nur Texte von Komsomolzen veröffentliche. »Die Zeitschrift des Komsomol ist ein Forum für junge Talente«, wiederholte der Redakteur. »Sie steht allen Autoren offen, unabhängig von Nationalität, Rasse, Religion oder Parteizugehörigkeit.« Über Annahme oder Ablehnung eines Texts entscheide einzig und allein dessen Qualität. Der Hauptteil der Zeitschrift sei der Lyrik und Prosa gewidmet, ein anderer der Diskussion: Dort würden Bücher und Texte junger Talente von alten Meistern kritisiert.
Sarah fragte, wie aus der Pistole geschossen, ob es auch eine Rubrik gebe, in der junge Autoren die alten Meister kritisieren, und wie Büroklammern gefurchte Sorgenfalten erschienen auf der Stirn des Redakteurs. Er dachte, er habe sich verhört, und erst nachdem er sich Sarahs Frage umständlich hatte erläutern lassen, setzte er zu einer gewundenen Antwort an, der außer der Bereitschaft, die Sache zu überdenken, nichts zu entnehmen war. »Sie haben eine sehr gute Frage gestellt«, sagte er schließlich, »eine scharfsinnige Frage!« Statt eine Antwort zu geben, schenkte er Wodka ein und schlug vor, auf die ihm gestellte Frage zu trinken. »Na zdorowje! Es lebe die Freundschaft zwischen den Völkern der UdSSR und dem Volk von Westberlin!« Der Rest des Gesprächs ging in Gläserklirren und Gelächter unter.
Es war elf Uhr morgens, Ende August, nein Anfang September nach der neuen Zeitrechnung: Lenin – oder war es Kerenski? – hatte den julianischen durch den gregorianischen Kalender ersetzt, und wir waren volltrunken, als wir vor einem Plattenbau hinter dem Arbat aus dem Auto stiegen, einer schwarzen Tschaika-Limousine. Der Dichter und Romancier, Sänger und Liedermacher Bulat Okudschawa erwartete uns zum Tee, und diesmal gab es wirklich Tee, den Okudschawas Frau Olga aus einem Samowar aufgoss. Über dem Schreibtisch hing ein signiertes Foto von John F. Kennedy, und alles in der bescheidenen Zwei-Zimmer-Wohnung atmete Geist, im Gegensatz zum Ungeist sowjetischer Amtsstuben mit dem obligatorischen Porträt von Breschnew, der mit seinen buschigen Augenbrauen und spitz zulaufenden Ohren einem nordischen Vielfraß ähnlich sah. Der neue Generalsekretär hatte sich den seit Stalins Tod verwaisten Titel selbst zugelegt und war beim Erscheinen seiner Kindheitserinnerungen als genialer Schriftsteller gepriesen worden: Anders als vom Ausland ferngesteuerte Dissidenten, schrieb die Parteizeitung Prawda, sei er fest im Volk verwurzelt und kenne dessen Nöte und Sorgen von unten auf.
»Ich werde als Verräter beschimpft«, murmelt Bulat Okudschawa und bläst vorsichtig in den aus seiner Teetasse wallenden, gekräuselten Dampf. Die Literaturnaja Gazeta frage allen Ernstes, wie er es habe wagen können, einen historischen Roman über die Narodnaja Wolja zu schreiben, obwohl sein Vater Georgier und seine Mutter Armenierin war – so als sei es Nichtrussen verboten, sich mit russischer Geschichte zu befassen. »Das ist schlimmer als Chauvinismus – es ist Rassismus pur!« Okudschawa stimmt seine Gitarre und summt das Lied vom Pappkameraden, das ihm die Feindschaft der nachstalinistischen Bürokratie eintrug:
Es lebte einmal ein Soldat,
Ein tapfrer, wunderbarer!
Jedoch ein Spielzeug, bunt und platt,
Ein Pappkam’rad nur war er.
Er flehte ohne Unterlass
Ihm ja nichts zu ersparen.
Rief: Feuer! Feuer! und vergaß,
Ein Pappkam’rad nur war er.
Ins Feuer! Vorwärts! Oder nicht?
Los stürmte wunderbar er.
Verbrannt für nichts und wieder nichts –
Ein Pappkam’rad nur war er.
3
Nach dem von weiteren Alkoholexzessen begleiteten Mittagessen – unser Führungsoffizier gab keine Ruhe, bis wir auf den Weltfrieden, die Völkerfreundschaft und die deutsch-sowjetische Freundschaft angestoßen hatten – zogen wir uns in das an der Gorkistraße gelegene Hotel Peking zurück, wo ich in einem mit Drachen und Tigern verzierten Doppelbett den versäumten Schlaf nachholte. Um fünf brachte uns der Chauffeur des Schriftstellerverbands – vielleicht handelte es sich auch um den Staatsverlag oder das Kulturministerium, drei Filialen ein und derselben Zentrale – zur Witwe des kürzlich verstorbenen Dichters Lukonin. Die mit Plüschsesseln und Orientteppichen ausstaffierte Wohnung mit Blick auf das Kinderkaufhaus Djetskij Gum und die Lubjanka, in deren Arrestzellen die Tscheka alias GPU alias NKWD Zehntausende Unschuldige zu Tode gequält hatte, deutete darauf hin, dass der Verstorbene ein Parteibarde gewesen war, dessen Orden in Vitrinen im Flur verstaubten, neben gerahmten Fotos, auf denen der Dickbauch Arm in Arm mit Nikita Chruschtschow, Michail Scholochow und Marschall Budjonny zu sehen war.
Der Status des unbegabten, aber hochbezahlten Staatsdichters ließ sich ablesen an der Garderobe seiner Frau, einer Ex-Tänzerin des Bolschoi-Balletts, die einen Zobelpelz um die Schultern und ein Perlencollier um den Hals gewunden hatte, das perfekt kontrastierte mit ihrem weißblonden Haar. Noch exquisiter war ihr Duft, eine Mischung aus Chanel Nr. 5 und Achselschweiß, der in meine Nase stieg, während sie mir, unter vielversprechendem Klirren der Ohrringe, ihre Wange zum Kuss entgegenhielt. In den intimen Körperduft mischte sich ein süßlicher Blutgeruch, der mir den Verstand raubte.
Die Hausherrin servierte Tee, und wir begutachteten die kalligraphisch beschrifteten Ehrenurkunden und auf Samtkissen gebetteten Medaillen ihres Mannes, der nicht nur den Frieden, sondern auch den Großen Vaterländischen Krieg besungen hatte, die Wolga, die Lena und den Ob, nicht zu vergessen die Heldentaten des Kosmonauten Gagarin, dessen in den Plastikeinband gestanztes Profil die Umschläge seiner Bücher zierte. Lukonin war ein Staatsdichter erster Güte, der bei der Maiparade als Leiter der Schriftstellerdelegation an den auf dem Lenin-Mausoleum postierten Kremlherren vorbeidefilierte, wobei ihm trotz seines Übergewichts keine Kurzatmigkeit anzumerken war. Drei Tage danach wurde er, erschöpft von den Feiern, bei denen Ströme von Krimsekt flossen, ins Regierungskrankenhaus eingeliefert und erlag einem durch Bewegungsarmut, Alkohol und Nikotin herbeigeführten Herzversagen. Lukonins sterbliche Hülle wurde auf dem Nowodewitschi-Friedhof beigesetzt, in Anwesenheit von Vertretern der bewaffneten Organe, die im Gleichschritt hinter dem von Funktionären des Schriftstellerverbands geschulterten Sarg marschierten. Das war erst wenige Monate her, und die Witwe hatte den Verlust noch kaum verkraftet; doch die Tatsache, dass sie ihre private Telefonnummer in ein mir überreichtes Buch mit Gedichten ihres Mannes kritzelte, ließ andere Rückschlüsse zu.
Ich wälzte mich ruhelos auf meinem Doppelbett im Hotel Peking, und erst zwei Stunden später, nachdem ich gründlich die Zähne geputzt, heiß und kalt geduscht und mich rasiert hatte, wählte ich die Telefonnummer. Die Witwe des Parteibarden schien meinen Anruf erwartet zu haben, und die deutsche Redensart, der zufolge bei Nacht die Bürgersteige hochgeklappt sind, galt auch für das ausgestorben wirkende Moskau, durch dessen menschenleere Straßen ein Taxi mich zu der angegebenen Adresse fuhr. Der schnauzbärtige Chauffeur, ein Kalmücke oder Tatar, zwinkerte anzüglich und verlangte einen überhöhten Preis, den er auch erhielt, und eine behandschuhte Damenhand bugsierte mich durch die spaltoffene Tür ins dunkle Treppenhaus. Schon im Aufzug nestelte die Dichterwitwe am Gürtel meiner Hose und befingerte den darunterliegenden Reißverschluss, während sie mich, meinen Hals mit Küssen bedeckend, durch den Hausflur zu ihrer Wohnung geleitete, deren in den Scharnieren quietschende Tür sich geräuschvoll hinter uns schloss. Wir schafften es nicht mehr bis ins Schlafzimmer, denn wie eine sibirische Tigerin fiel die Dichterwitwe schon im Korridor über mich her, um ihren seit Monaten, vielleicht seit Jahren aufgestauten Hunger nach Männerfleisch zu stillen. Im Umgang mit Frauen bin ich eher gehemmt und habe vergessen, ob sie es mir auf Russisch besorgte oder ob wir es hinterindisch miteinander trieben – auf diesem Gebiet kenne ich mich nicht aus. Kein Wunder, denn die Szene spielte sich im stockfinsteren Korridor ab – ich weiß nur noch, dass ich unabsichtlich gegen Schränke und Kommoden stieß, von denen Nippes- und Porzellanfiguren kollerten, während ich mich mit der liebestollen Witwe auf dem frisch gebohnerten Parkett wälzte – vielleicht war es auch ein Kelim oder ein Bärenfell. Im Nachhinein frage ich mich, ob die liebeskundige Ballerina eine Balletttänzerin oder eine Luxusprostituierte gewesen ist – oder aber eine zur Kurtisane ausgebildete Kundschafterin des KGB? In meiner Erinnerung lebt sie fort als die von Sacher-Masoch beschriebene Venus im Pelz, in deren Zobelfell wie Quecksilberkugeln geformtes Sperma glitzerte, als ich mich im Schein der aufgehenden Sonne aus ihrer Wohnung stahl.
4
Bei der Rückkehr ins Hotel fehlte mir mein Pass, ein für Bürger der Bundesrepublik leicht zu verkraftender Verlust, aus sowjetischer Sicht aber eine Todsünde, die nie wiedergutzumachen war. Vergeblich rief ich die geheime Telefonnummer an: Niemand nahm den Hörer ab, die Leitung war tot, und die Witwe hatte sich in Luft aufgelöst – so als sei die Luxuswohnung des verstorbenen Dichters ein konspiratives Objekt, das man, um meinen Pass zu konfiszieren, zum Liebesnest umfunktioniert hatte. Also doch KGB? Drei Wochen später, beim Abflug von Scheremetjewo nach Berlin-Schönefeld, überreichte mir ein Pilot der Aeroflot, der eine amerikanische Bomberjacke trug, braunes Büffelleder mit Pelzkragen, mit schwungvoller Geste meinen abhandengekommenen Pass – ohne ein Wort der Erklärung oder Entschuldigung. Vorausgegangen waren mehrere Versuch, mir ein Ersatzdokument zu beschaffen: In Tbilisi posierte ich im Studio eines Fotografen, der mit seinem Oberkörper unter einem schwarzen Tuch verschwand, während ich auf dem mit Fransen verzierten Sofa saß unter einem Hirschgeweih, das später durch eine Zimmerpalme ersetzt wurde. Ich fand mich gut getroffen, aber die zuständige Behörde lehnte das Passfoto ab, nicht wegen der Palme, die als Symbol des Kolonialismus hätte missdeutet werden können, sondern wegen meiner langen Haare: Bekanntlich muss auf Passbildern das rechte oder linke Ohr zu sehen sein. Ich ging zum Friseur, der auf Russisch nicht Panikmacher, sondern Parikmacher heißt, und bekam eine Kurzhaarfrisur verpasst, wie sie die Matrosen des Panzerkreuzers Aurora bei der Erstürmung des Winterpalasts trugen. Wegen eines Feiertags war das Fotostudio geschlossen, und die Prozedur wiederholte sich im Polizeipräsidium von Baku, in dessen Vorgarten Bittsteller im Freien kampierten, ohne vorgelassen zu werden. Auch das Treppenhaus war von Antragstellern blockiert, die mir flehentlich die Arme entgegenstreckten, als man mich an der Warteschlange vorbei ins Büro des Polizeichefs führte, der mich in Privataudienz empfing. Azeris, Armenier und Georgier seien wie Finger einer Hand, behauptete der Polizeichef und reckte seine rechte Hand, der zwei Finger fehlten, zum Schwur. Die Völker des Kaukasus bildeten eine glückliche Familie unter Führung der Sowjetunion – den Konflikt um Bergkarabach, die Umsiedlung der Tschetschenen und die Ausmerzung der Tscherkessen erwähnte er nicht. »Die Behörden in Tbilissi haben Sie irrtümlich oder absichtlich falsch informiert, denn ich habe nicht das Recht, einem deutschen Staatsbürger einen Sowjetpass auszustellen – es sei denn, er hat in der Roten Armee gedient.« Bei diesen Worten blickte er bewundernd auf meinen militärischen Kurzhaarschnitt. »In Ihrem Fall könnten wir eine Ausnahme machen und die Dienstzeit verkürzen auf, sagen wir, achtzehn Monate. Allerdings müssten wir Ihren Namen leicht verändern, damit er nicht zu fremdartig klingt. Wie wäre es mit Hassan Buchara zum Beispiel?« Er spannte einen Bogen mit drei oder vier Durchschlägen Kohlepapier in die Schreibmaschine. »Sind Sie Bürger der Bundesrepublik oder der Deutschen Demokratischen Republik?« – Weder das eine noch das andere, hörte ich mich sagen: »Ich komme aus der selbstständigen Einheit Westberlin.« Der Polizeichef von Baku legte seine Stirn in Falten: Das war eine unerwartete Komplikation – von einem dritten deutschen Staat hatte er noch nie gehört.
Zwei Wochen später stellte die Botschaft der Bundesrepublik in Moskau mir einen Ersatzpass oder Passersatz aus – nicht auf den Namen Hassan Buchara, sondern auf meinen richtigen Namen, aber von dem Dokument habe ich nie Gebrauch gemacht. Erst Wochen nach meiner Rückkehr fand ich heraus, dass das mir überreichte Buch des Parteiliteraten eine Schallplatte enthielt, auf der Lukonin Gedichte deklamierte, Verse zum Thema Heimaterde und Erntedank, unterbrochen von Zahlenreihen, bei denen es sich, wie ein Experte des Bundesnachrichtendiensts meinte, um Geheimcodes handelte. Also doch KGB?
5
Der Hörspielschreiber war abgereist, und an seiner Stelle stieß ein Westberliner Pfarrer zu unserer Delegation, der nach eigener Aussage von Marx und Lenin mehr gelernt hatte als aus dem Markus- und Lukas-Evangelium. Der Entspannungspfarrer, so nannte ich ihn, hielt seine Moskauer Geliebte mit Strumpfhosen bei der Stange – hier passt die Redensart – und rügte mich, als ich »Ihr seid das Salz der Erde« ins Gästebuch des Nowodewitschi-Klosters schrieb, in seinen Augen eine antisowjetische Provokation. Erste Station unserer Reise war Erewan, im Westen bekannt geworden durch die Schmunzelwitze von Radio Erewan: »Im Prinzip ja, aber …« Die in einem Hochtal gelegene Stadt, umgeben von Gärten, in denen aromatisch duftende Pfirsiche, Maulbeeren und Aprikosen wuchsen, überragt vom Gletscher des Ararat, der für Besucher off limits war wegen seiner strategischen Lage an der Südgrenze des Warschauer Pakts, die armenische Metropole also entsprach in keiner Weise dem Klischee eines provinziellen Hinterlands: Auf von Platanen beschatteten Boulevards glitten Oldsmobiles und Chevrolets dahin, die auf abenteuerlichen Umwegen aus Las Vegas und Reno, den Hauptstädten der armenischen Diaspora, hierher gelangt waren. Die Schaufenster der Buchläden, Modeboutiquen und Discos waren mit Fotos von Charles Aznavour, William Saroyan und Chatschaturian geschmückt, nur Mikojan, der Ex-Außenminister fehlte, und Metaxa, eine armenische Poetin, begrüßte uns mit dem emphatischen Ruf: »Wir heißen die Dichter aus dem Land Franz Werfels willkommen!«
Damit war weder die k.u.k.-Monarchie gemeint noch die Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit, sondern die deutsche Literatur, die durch unzerreißbare Bande mit dem Schicksal Armeniens verknüpft ist: Von Forschungsreisenden und Missionaren des 19. Jahrhunderts bis zu Armin T. Wegener und Pastor Lepsius, der als erster den Genozid des osmanischen Reichs an den Armeniern publik machte. Aus dieser Sicht war die Türkei noch immer der Hauptfeind, Russland und Deutschland aber, das im Ersten Weltkrieg nichts unternahm, um den Genozid zu beenden, galten als Freunde des armenischen Volkes. Trotzdem oder gerade deshalb wurde das Standardwerk über den Völkermord, Franz Werfels Roman Die vierzig Tage des Musa Dagh, unter dem Ladentisch gehandelt – mit Rücksicht auf die friedliche Koexistenz.
Metaxa sah so aus wie der gleichnamige Weinbrand – honiggelb und zuckersüß. Als junge Pionierin hatte sie Stalin, der ihr in seiner Marschalluniform wie ein Erzengel erschien – nur die Pockennarben passten nicht dazu –, knicksend einen Blumenstrauß überreicht, und nach dem Tod des Generalissimus hatte sie sich von Stalinoden auf erotische Gedichte verlegt, in denen sie mit den Zähnen dem Geliebten die Knöpfe vom Hemd riss: Ob sie die Perlmuttknöpfe ausspuckte oder herunterschluckte, behielt sie für sich.
Zum Glück ging von Metaxa keine Gefahr mehr aus. Sie hatte die Produktion eingestellt, wie sie sagte, im Unklaren lassend, ob es sich um die Produktion von Gedichten oder von Sexualhormonen handelte – ihr Schnurrbart deutete auf letzteres hin. Den Entspannungspfarrer schreckte das nicht – im Gegenteil: Statt sich für versteinerte Bibeln zu interessieren, die armenische Mönche in Tropfsteinhöhlen vor muslimischen Eroberern versteckten; statt zum religiösen Zentrum der Armenier in Edschmiadsin zu pilgern oder vor evangelischen Glaubensbrüdern zu predigen, bat er Metaxa, den Trick mit den Hemdknöpfen vorzuführen – und ward nicht mehr gesehen. Erst am nächsten Morgen tauchte er hohlwangig, blass, mit Ringen unter den Augen, aus der Versenkung auf und sah aus, als habe Metaxa ihm die Sexsucht ausgetrieben, doch der Schein trog. Denn kaum hatte der Entspannungspfarrer sich von der nächtlichen Eskapade erholt, wankte er mit hängender Zunge durch den Hotelkorridor und klopfte, nein kratzte, hündisch ergeben an ihrer Zimmertür, die fortan verschlossen blieb: Entweder war Metaxa nicht auf ihre Kosten gekommen, und der Kirchenmann – mit Betonung auf Mann – hatte das in diesem Wort enthaltene Versprechen nicht eingelöst, oder sein Vorrat an Hemdknöpfen war aufgebraucht.
6
»Sie werden Gelegenheit haben, Schaschlik zu essen«, hatte Slonimski gesagt, und der KGB-Mann hatte nicht übertrieben, denn fortan gab es nur noch Schaschlik zu essen und nichts als Schaschlik, Schaschlik zum Frühstück, zum Mittag- und Abendessen, Schaschlik aus Hammelfleisch, Rind, Schwein, Huhn und Gemüse, nicht zu vergessen auf Krummsäbel, Schwerter, Lanzen, Dolche, Stacheldraht oder Bajonette gespickte Würste und Innereien. Als wir die Faxen dicke hatten, weil das oder der Schaschlik uns aus Nasen und Ohren troff, hielt unser Dienstwagen, eine Moskwitsch-Limousine mit Spitzenvorhängen und Plüschsitzen, die uns auf holprigen Straßen durchs Hochland von Armenien kutschierte, vor einem Ausflugslokal am Ufer des Vansees, in dem es Fisch zu essen gab, Forellen, wie es hieß, und während unser Leibwächter und Chauffeur die Gäste des Lokals mit wedelnden Armen von den Tischen vertrieb, wurden uns in Stücke gehackte, am Spieß gebratene Forellen serviert, die trotz oder wegen der gerösteten Zwiebel- und Speckscheiben vorzüglich schmeckten, Fischschaschlik, eine kulinarische Spezialität mit dreifachem SCH, wie ich sie außer am Ufer des Vansees, nicht zu verwechseln mit dem Berliner Wannsee, nie wieder vorgesetzt bekam.
7
»Gegel, Gegel«, wiederholte der Direktor des staatlichen Ölkombinats Neftprom oder Kaspoil