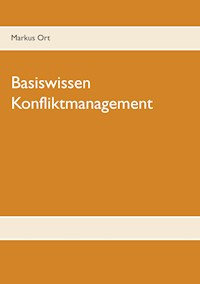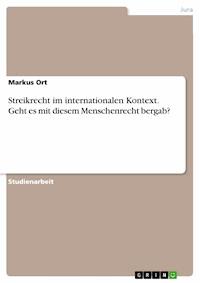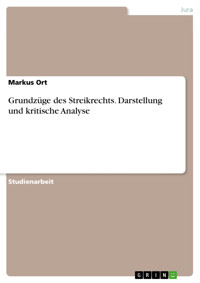4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch bietet einen kompakten Einstieg in das deutsche Zivilrecht. Es führt in die relevanten Regelungen des BGB AT, Schuldrecht und Sachenrecht ein. Aufbau des Buches: Kapitel 1: Einleitung Kapitel 2: Grundlagen und Gesetzessystematik Kapitel 3: Rechtsgeschäfte und Vertragsschluss Kapitel 4: Nichtigkeitsgründe für Rechtsgeschäfte Kapitel 5: Stellvertretung Kapitel 6: Verpflichtungsgeschäfte Kapitel 7: Sachenrecht Kapitel 8: Mangelrecht beim Kaufvertrag Kapitel 9: Recht der Leistungsstörungen Kapitel 10: Gesetzliche Herausgabeansprüche Kapitel 11: Deliktischer Schadensersatz Kapitel 12: Fristen und Verjährung Kapitel 13: Schlusswort
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Vorwort
Seit 2018 bin ich nunmehr als Dozent für Bürgerliches Recht, allgemeine Rechtskunde und Verwaltungsbetriebswirtschaft in der Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, Verwaltungsbeamten und Verwaltungsfachkräften sowie der Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt tätig.
In dieser Funktion stelle ich regelmäßig fest, wie wichtig es für die Teilnehmer ist, ein kompaktes Skript zum schnellen Nachschlagen der wesentlichen Inhalte zu haben.
Entsprechend war es mein Ziel, mit dem vorliegenden Buch all jenen, die sich ohne größere Vorkenntnisse mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) vertraut machen wollen, ein entsprechendes Handbuch für den schnellen Einstieg an die Hand zu geben.
Bei der Lektüre wünsche ich einen guten Lernerfolg und viel Spaß.
Markus Ort
06.12.2020
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
GRUNDLAGENWISSEN
2.1 Aufbau des BGB in fünf Bücher
2.2 Rechtssubjekte und Rechtsfähigkeit
2.3 Sachen, Bestandteile, Tiere und Zubehör
2.4 Absolute und relative Rechte (Ansprüche, Gestaltungsrechte)
WILLENSERKLÄRUNG, RECHTSGESCHÄFT, VERTRAG
3.1 Begriff Abgabe der Willenserklärung
3.2 Begriff des Rechtsgeschäfts
3.3 Wirksamkeit der Willenserklärung
3.4 Widerrufsrecht des Verbrauchers (zum Beispiel beim Fernabsatzvertrag)
3.5 Auslegung von Willenserklärungen
3.6 Vertragsschluss (Antrag und Annahme, Annahmefrist, verspätete und abändernde Annahme, Einigungsmängel, Auslegung)
3.7 Vertragsfreiheit: Freiheit „ob“, „mit wem“ und „zu welchen Konditionen“
WIRKSAMKEIT VON RECHTSGESCHÄFTEN
4.1 Geschäftsunfähigkeit
4.2 Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger
4.3 Nichtigkeit von Scheingeschäften
4.4 Formmangel (Grundsatz der Formfreiheit, Sinn und Zweck von Formvorschriften, Ausnahmen, Nichtigkeit und Heilung)
4.5 Verbots- und sittenwidrige Rechtsgeschäfte
4.6 Anfechtung bei Irrtum, arglistiger Täuschung und widerrechtlicher Drohung
STELLVERTRETUNG
5.1 Offenkundigkeit
5.2 Abgrenzung von Stellvertreter und Bote
5.3 Vertretungsmacht
5.4 Wirkung der Vertretung
5.5 Vertreter ohne Vertretungsmacht
VERPFLICHTUNGSGESCHÄFTE
6.1 Haupt- und Nebenleistungspflichten, Rücksichtspflichten
6.2 Kaufvertrag (sonstige Anwendbarkeit von Kaufrecht)
6.3 Sonstige Verpflichtungsgeschäfte: Darlehen, Schenkung, Miete, Leihe, Dienstvertrag, Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, Verwahrung
6.4 Vertragliche Nebenabreden
6.5 Stückschuld und Gattungsschuld (mit Konkretisierung)
6.6 Leistungsort, Leistungszeit
6.7 Einrede des nicht erfüllten Vertrages
SACHENRECHT
7.1 Aufgabe und Funktion des Sachenrechts (Erfüllung der Verpflichtung)
7.2 Abgrenzung Verpflichtungsgeschäft/Erfüllungsgeschäft
7.3 Trennungsgrundsatz und Abstraktionsprinzip
7.4 Besitz (Bedeutung für den Eigentumserwerb, Erwerb und Beendigung unmittelbarer/mittelbarer Besitz, Besitzdiener)
7.5 Begriff des Eigentums und Befugnisse des Eigentümers
7.6 Rechtsgeschäftlicher Eigentumserwerb an beweglichen Sachen
7.7 Eigentumsvorbehalt und Anwartschaftsrecht
7.8 Eigentumserwerb an unbeweglichen Sachen (mit Auflassungsvormerkung)
7.9 Verbindung beweglicher Sachen mit einem Grundstück, Zubehör eines Grundstücks
BESONDERE RECHTE DES KÄUFERS BEI MÄNGELN
8.1 Nacherfüllung
8.2 Verbrauchsgüterkauf und seine Besonderheiten
8.3 Vorrang der Nacherfüllung und Ausnahme
8.4 Abgrenzung zum Umtauschrecht aus Kulanz und Garantieanspruch
8.5 Minderung (Begriff, Bedeutung und Rechtsfolgen)
8.6 Verweis in das allgemeine Leistungsstörungsrecht
ALLGEMEINES RECHT DER LEISTUNGSSTÖRUNGEN
9.1 Arten von Pflichtverletzungen
9.2 Vertraglicher Schadensersatz („neben“ und „statt“ der Leistung)
9.3 Verantwortlichkeit beim Schadensersatz
9.4 Art und Umfang des Schadensersatzes
9.5 Weitere Rechte des Gläubigers bei Unmöglichkeit
9.6 Rücktritt
GESETZLICHE HERAUSGABEANSPRÜCHE UND EIGENTUMSRECHTLICHE ANSPRÜCHE
10.1 Ungerechtfertigte Bereicherung
10.2 Ansprüche aus Eigentum
SCHADENSERSATZ AUS UNERLAUBTER HANDLUNG
11.1 Grundtatbestand
11.2 Haftung des Geschäftsherrn (Verrichtungsgehilfe)
11.3 Deliktsfähigkeit und Haftung der Eltern
11.4 Art und Umfang des Schadensersatzes ohne Sonderregelungen bei unerlaubter Handlung
FRISTEN UND VERJÄHRUNG
12.1 Grundsatz und Rechtsidee der Verjährung
12.2 Regelmäßige Verjährung ohne Höchstfristen
12.3 Sonderregelungen
12.4 Wirkung der Verjährung
12.5 Fristberechnung
12.6 Lösung bei Gestaltungsrechten (Rücktritt und Minderung)
12.7 Hinweis auf Hemmung und Neubeginn
SCHLUSSBETRACHTUNG
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
In Deutschland findet sich wohl kaum ein Gesetz im Privatrecht, mit welchem wir so oft in Berührung kommen, wie mit dem BGB.
Nicht umsonst wird in den meisten Berufsbildern zumindest ein kleiner Einstieg in dieses dort geregelte Rechtsgebiet vermittelt.
Dieses Buch setzt sich zum Ziel, einen kompakten ersten Einstieg oder eine kleine Wiederholung der relevanten Kenntnisse und Grundlagen des bürgerlichen Rechts zu vermitteln. Es richtet sich dabei insbesondere an diejenigen, die im Rahmen ihrer Aus- und Fortbildung mit dem BGB zu tun haben oder die in einem nicht-juristischen Studium Kenntnisse des BGB erlangen wollen.
Hierzu werden in den einzelnen Kapiteln dieses Buches1 die folgenden Themen untersucht und dargestellt:
Kapitel 2 stellt wesentliche Grundlagen des bürgerlichen Rechts dar.
Kapitel 3 zeigt, wie Rechtsgeschäfte geschlossen werden. Kapitel 4 stellt die Nichtigkeitsgründe für Rechtsgeschäfte vor.
Kapitel 5 erläutert, wie jemand für einen anderen rechtswirksam Verträge schließen und andere Rechtsgeschäfte eingehen kann.
Kapitel 6 gibt eine Einführung in das Schuldrecht und stellt die wesentlichen Vertragstypen vor.
Kapitel 7 gibt eine Einführung in das Sachenrecht und stellt die wesentlichen dinglichen Rechte sowie deren Erwerb und deren Übertragung vor.
Kapitel 8 zeigt anhand des Kaufvertrags, welche Rechte Käufern bei einem Mangel an der Kaufsache zustehen.
Kapitel 9 erörtert die weiteren möglichen Leistungsstörungen sowie die sich aus ihnen ergebenden Rechte.
Kapitel 10 stellt die gesetzlichen Herausgabeansprüche vor.
Kapitel 11 erklärt die deliktischen Schadensersatzansprüche.
Kapitel 12 zeigt auf, welche Fristen es gibt und wie diese berechnet werden. Daneben wird das Rechtsinstrument der Verjährung dargestellt.
Kapitel 13 beinhaltet das Schlusswort.
Die einzelnen Kapitel dieser Arbeit sind in sich geschlossen. Sie müssen daher nicht zwingend der Reihe nach gelesen werden. Soweit nötig, werden im Text selbst Verweisungen auf andere Kapitel vorgenommen.
Die zur Erstellung der Arbeit verwendete Literatur findet sich im Literatur- und Quellenverzeichnis. Für ein vertiefendes Studium des bürgerlichen Rechts wird auf die dort aufgeführten Werke verwiesen und ihre Lektüre empfohlen.
Hinweis: Diese Arbeit ist der besseren Lesbarkeit ausschließlich in der maskulinen Form geschrieben worden. Selbstredend beziehen sich die Formulierungen und Aussagen stets auf alle Geschlechter.
1 Nach dieser Einleitung in Kapitel 1.
2 Grundlagenwissen
Bevor es ab Kapitel 3 mit den ersten Inhalten losgeht, soll an dieser Stelle das Grundlagenwissen vermittelt werden. Hierzu gehört es einerseits, den systematischen Aufbau des BGB vorzustellen, andererseits werden die Begriffe der Rechtspersonen (Rechtssubjekte) und der absoluten und relativen Rechte eingeführt. Daneben finden sich die grundlegenden Definitionen von Sachen, Tieren, Bestandteilen und Zubehör.
2.1 Aufbau des BGB in fünf Bücher
Das BGB ist wie folgt aufgebaut:
Buch
Paragra- fen
Wesentlicher Regelungsinhalt
1. Buch: All- gemeiner Teil
§§ 1 – 240
Stellt Grundlagen auf, die für die Bücher 2 – 5 gelten
2. Buch: Schuldrecht
§§ 241 –853
Verpflichtungsgeschäfte (Rechtsgeschäfte, die eine
Leistungsverpflichtung begründen)
3. Buch: Sa- chenrecht
§§ 854 – 1296
Verfügungsgeschäfte (Rechtsgeschäfte, die der Erfüllung der Leistungsverpflichtung dienen) sowie dingliche Rechte
4. Buch: Fami- lienrecht
§§ 1297 – 1921
Regelt die rechtliche Stellung der Familienmitglieder zueinander
5. Buch: Erb- recht
§§ 1922 – 2385
Rechtsnachfolge von Todes wegen
2.2 Rechtssubjekte und Rechtsfähigkeit
Um am Rechtsverkehr (als Berechtigter oder Verpflichteter) teilnehmen zu können muss man rechtsfähig sein. Die Rechtsfähigkeit ist dabei definiert als die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten sein zu können. Diejenigen, die rechtsfähig sind, werden auch als Rechtssubjekte bezeichnet.
Bei den Rechtssubjekten ist zu unterscheiden zwischen den natürlichen Personen (das sind alle Menschen) und den juristischen Personen.
Juristische Personen werden differenziert nach ihrer jeweiligen Rechtsgrundlage. So gibt es einerseits die juristischen Personen des Privatrechts. Diese sind zum Beispiel der Verein (§ 21 ff. BGB), die Stiftung (§ 80 ff. BGB) oder auch Kapitalgesellschaften wie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) oder die Aktiengesellschaft (AktG).
Andererseits gibt es auch die juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Diese lassen sich unterteilen in die Körperschaften (die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie Mitglieder haben), die Anstalten (die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie Benutzer haben) und die Stiftungen (die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie Nutznießer haben).
Den Rechtssubjekten stehen die Rechtsobjekte gegenüber. Generell kann festgehalten werden, dass alles was im Rechtsverkehr auftaucht ohne Rechtssubjekt zu sein, ein Rechtsobjekt (also ein Rechtsgegenstand ist). An einem Rechtsobjekt bestehen also Rechte und Pflichten der Rechtssubjekte.
2.3 Sachen, Bestandteile, Tiere und Zubehör
Als wesentliche Rechtsobjekte (Rechtsgegenstände) können Sachen und Tiere benannt werden. Sie werden daher an dieser Stelle definiert.
Sachen sind alle körperlichen Gegenstände (§ 90 BGB). Als körperliche Gegenstände können sie angefasst werden. Daher sind beispielsweise Rechte oder Lizenzen, Forderungen und Luft keine Gegenstände im Sinne des BGB. Sachen können unterschieden werden nach ihrer:
Beweglichkeit
in Immobilien (Grundstücke) und Mobilien (alle sonstigen Gegenstände)
Vertretbarkeit
in vertretbare Sachen nach § 91 BGB (zum Beispiel Geld, weil es davon vieles gibt) und nicht vertretbaren Sachen (zum Beispiel dem Originalgemälde der Mona Lisa, welches es nur einmal gibt)
Verbrauchbarkeit
in verbrauchbare Sachen nach § 92 BGB (zum Beispiel Lebensmittel, welche durch Nutzung aufgebraucht werden) und Gebrauchssachen (zum Beispiel Kleidung, welche immer wieder be und genutzt werden können)
Wesentliche Bestandteile sind Sachen, die mit einer anderen Sache untrennbar verbunden sind. Bei beweglichen Sachen definiert dies § 93 BGB (zum Beispiel Farbe eines Gemäldes auf der Leinwand).
Wesentliche Bestandteile an einem Grundstück finden sich geregelt in § 94 BGB (zum Beispiel Gebäude oder Baum auf einem Grundstück).
Gerade die Frage nach einem wesentlichen Bestandteil an einem Grundstück ist eigentumsrechtlich relevant. So ergibt sich aus § 946 BGB, dass derjenige der das Eigentum an einem Grundstück erwirbt, auch immer das Eigentum an dessen wesentlichen Bestandteilen erwirbt.
Zubehör nennt man nach § 97 BGB solche Sachen, die dem wirtschaftlichen Hauptzweck einer anderen Sache dienen. Dies wäre zum Beispiel die Einrichtung einer Gaststätte.
Tiere sind selbst zwar keine Sachen, werden allerdings im Rechtsverkehr wie solche behandelt (§ 90a BGB). Es findet hierbei allerdings die zum Schutz der Tiere erlassenen Gesetze Anwendung.
2.4 Absolute und relative Rechte (Ansprüche, Gestaltungsrechte)
Im Zivilrecht ist zu unterscheiden zwischen den absoluten und den relativen Rechten.
Die absoluten Rechte