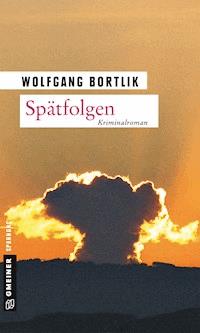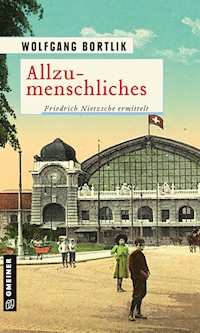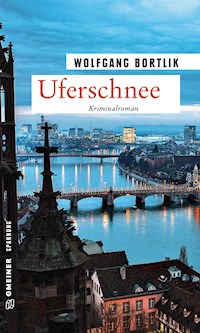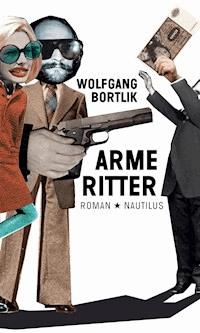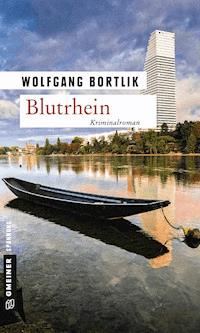Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hobbydetektiv Melchior Fischer
- Sprache: Deutsch
Zwei Ermordete an einem Wochenende - so eine Häufung hat Kommissär Gsöllpointner noch nie erlebt. Auch sein Spezi Melchior Fischer ist unglücklich: Sein Sohn scheint in eine Aktion der rebellischen Klimajugend verwickelt zu sein, die außer Kontrolle gerät. Es kommt zu Gewalttaten an Repräsentanten des öffentlichen Lebens in Basel. Und in der ganzen Stadt tauchen rätselhafte Sprayereien auf: 1:1 - Gleichstand! Sind sie ein Hinweis auf die Mordopfer, von denen einer ein hartköpfiger Bankier, der andere ein Grüner und Unterstützer der Klimajugend war?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Bortlik
Basler Gleichstand
Kriminalroman
Zum Buch
Unentschieden Zwei gewaltsam zu Tode Gebrachte in Basel – und das am Wochenende des Schweizer Nationalfeiertags: ein grüner Politiker und ein Bankier. Quasi unentschieden, Gleichstand! Zumindest deuten das die rätselhaften Sprayereien an, die in der ganzen Stadt auftauchen. Hobbydetektiv Melchior Fischer wird durch seinen Sohn Tim in die Geschehnisse hineingezogen. Denn Tim scheint in eine zweifelhafte Aktion der rebellischen Klimajugend verwickelt zu sein, die gänzlich aus dem Ruder gelaufen ist. Daneben kommt es zu Gewalttaten an Repräsentanten des öffentlichen Lebens in Basel. Die Ermittlungsbehörden sind im Stress, und Kommissär Gsöllpointner, der die beiden Todesfälle aufklären muss, hat unterdessen apokalyptische Visionen. Denn nicht nur das Verbrechen bedroht das Gemeinwesen …
Wolfgang Bortlik, 1952 in München geboren, lebt seit Langem in der Schweiz, in den letzten Jahren in Riehen bei Basel. Er studierte ohne Abschluss Geschichte und Publizistik in München und Zürich, war Rockmusiker und arbeitete lange im Buchhandel. Seit 1998 hat er neun Romane und einige Bücher über Fußball veröffentlicht. Er ist Ehrenkapitän des »Schweizerischen Schriftsteller-Fussballnationalteams« und unter anderem im Vorstand der Literaturinitiative Arena in Riehen. Sein historischer Krimi »Allzumenschliches« mit Friedrich Nietzsche als Ermittler wurde für den Schweizer Krimipreis 2021 nominiert.
Impressum
Gefördert vom Basler Literaturkredit
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Katja Ernst
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © HappyAlex / AdobeStock
ISBN 978-3-8392-7352-4
Widmung
Für Frida Antonia Elise
Zitate
Nach und nach kam ich zu der Überzeugung, dass selbst die Redlichsten, könnten sie Macht ausüben, den Schurken ähnlich würden, die sie einst bekämpften.
Louise Michel (1830–1905)
*
Ich begriff unsere Beziehung erst wirklich, als ich fühlte, dass alles darin besteht, aufzunehmen, was aufzunehmen ist, und zu geben, was zu geben ist, und damit unser Leben reich zu machen.
Itō Noe (1895–1923)
Vorspiel
»Bist du irre, du kannst dem Typen doch nicht einfach eins über den Schädel ziehen!«
»Sorry, aber der Blödmann hat mich wahnsinnig gemacht mit seinem Gejammer. Voll!«
»Vielleicht hat er wirklich keine Luft mehr bekommen.«
»Quatsch, das ist ein Jutesack, der kratzt ein bisschen, wenn man ihn über dem Kopf hat, aber der ist luftdurchlässig wie sonst was.«
»Trotzdem musst du ihm nicht gleich eins überbraten.«
»Jetzt hör aber auf! Hast du vielleicht Mitleid mit diesem Kapitalistenknecht?«
»Ich will einfach nicht wegen deiner Unbeherrschtheit in der Kiste landen.«
»Zu spät, wir haben das Mitglied der Geschäftsleitung einer alteingesessenen Basler Privatbank entführt, wenn das rauskommt und die uns schnappen, dann landen wir auf jeden Fall im Knast.«
»Deswegen sollten wir es ja auch nicht noch schlimmer machen, also du weißt schon, nicht noch mehr Strafbestände oder so anhäufen …«
»Strafbestände anhäufen – sag mal, was ist denn los mit dir? Wir statuieren ein Exempel, wir befinden uns im Kampf, wir müssen die Umwelt für die Umwelt aufrütteln, wir brauchen ein Forum für unsere Anliegen. Und wenn sie es uns nicht freiwillig geben, müssen wir zu solchen Mitteln greifen, damit sie uns hören. Dann nehmen wir uns dieses Recht mit der uns zustehenden Gewalt.«
»Spinnst du?«
»Warum haben wir dann diesen alten Sack überhaupt entführt? Kannst du mir das sagen? Wir werden ein Communiqué schreiben …«
»Du mit deiner Deutschnote?«
»Ich hab da schon jemand aufgetan, der das für uns erledigt. Die richtigen Beziehungen muss man haben.«
»Bist du irre? Das heißt doch, dass du alles verrätst und dass noch jemand Bescheid weiß und uns an die Bullen ausliefert.«
»Keine Angst, ist schon geregelt. Der Mann ist absolut vertrauenswürdig, ein Genosse, außerdem kennt er die Zusammenhänge nicht. Verstehst du? Was wir jetzt veröffentlichen, das muss doch ein bisschen was darstellen, das muss Biss haben, Schärfe und Energie. Kein Bitti und Bätti.«
»Genosse, Genosse, so ein Seich! Scheiße, worauf hab ich mich da eingelassen? Das hat am Anfang ganz anders getönt, Alter, wir haben das doch lange diskutiert. Da hat keiner was von einer längeren Entführung und von Forderungen gesagt. Zeigen, dass es uns ernst ist, darum geht es doch, eine aufsehenerregende Aktion, so wie eine Besetzung oder was auch immer.«
»Ganz ruhig, ich weiß, aber das Schicksal hat uns diesen Bankier in die Hände gespielt. Spontane Aktion, verstehst du. Wie er da betrunken auf uns zugetorkelt ist. Ich hab ja gewusst, dass der ›Goldene Kopf‹ eine Studentenverbindungskneipe ist, aber mir war nie klar, wer sich da alles rumtreibt. Und dann stellt sich heraus, dass der Bankier Martin Rübsamen höchstpersönlich Mitglied dieser Verbindung ist. Der Vater von deiner Verflossenen, erinnere dich, Celli.«
»Dieser Drecksack hat das ständig hintertrieben, dass ich die Melli getroffen habe. Ich sei ein Früchtchen und ein linkes Gemüse, hat er immer gesagt, nur weil ich bei der Klimajugend bin.«
»Celli und Melli, voll romantisch.«
»Pass auf, was du sagst.«
»Krieg dich wieder ein, Celli. Es ist alles im grünen Bereich. Die Politiker und die Medien bekommen ein aufsehenerregendes Schreiben, das sie vom Hocker haut. Und hier haben wir die totale Kontrolle. Wir lassen den alten Rübsamen wieder frei, und er wird nie erfahren, wer ihn gekidnappt hat. – Da, der Typ stöhnt und schnauft, der kommt zu sich, dem ist nichts passiert, also kein Wort mehr. Bist du sicher, dass er nichts sieht durch diesen Jutesack?«
Erste Akte
Es ist das Lachen, das man verteilt. Die Schmerzen bewahrt man in der Unendlichkeit des eigenen Herzens.
Amparo Poch y Gascón (1902–1968)
Eins
Der November war so gewesen, wie der Windmond, Nebelung oder Nebelmond eben sein musste. Das war der Monat der Heiligen und der Toten, die Vorbereitung aufs Ende, zumindest das Ende des Jahres, der Beginn der langen Nächte. Die Sonne hatte sich längst verabschiedet und das feuchte Grau nahm überhand, vielleicht auch ein schmutziges Weiß, falls schon erste Schneeflocken gefallen waren. Zähe Zeit, Depressionen schlichen heran auf gedämpften Pfoten, wer jetzt keine Vollspektrum-Lampe als Lichtersatz hatte, der kaufte sich keine mehr.
In dieser trostlosen, unguten Zeit hatte es den alten Faller erwischt. Am Abend eingeschlafen und am Morgen nicht mehr aufgewacht. O schöner Tod.
Viele hatten den Emeritus für Alte Geschichte, der jahrzehntelang an der Universität Basel tätig gewesen war, um Studentinnen und Studenten dieses Faches nicht gänzlich verzweifeln zu lassen, für unsterblich gehalten.
Auch Melchior Fischer hatte erst letzthin noch eine Eloge über den nun doch nur scheinbar Unzerstörbaren geschrieben: »Es kann nur den Einen geben«.
Der Text war anlässlich Fallers 90. Geburtstag in der Lokalzeitung erschienen.
Jetzt gab es ihn nicht mehr, Cosimo Faller. Abkomme reicher Basler Familien, die um 1750 ihr erstes Vermögen gemacht hatten und es weiterreichten, vom Weben der Seidenbändel über die Färberei bis hin zu Chemie und Finanzwirtschaft, und bei jedem wirtschaftlichen Übergang, bei jeder Diversifizierung wurde das familiäre Vermögen exponentiell vermehrt.
Der alte Faller jedoch hatte mit derlei Familientradition nichts zu tun haben wollen. Er war Historiker gewesen, vielleicht auch Hysteriker, und hatte stets auf der Seite der Entrechteten und Schwachen gestanden. Das Rebellische hatte gut zu seinem asketischen Äußeren gepasst.
»Friede den Hütten, Krieg den Palästen«, hatte der Greis gerne deklamiert, obwohl er in einem durchaus komfortabel umgebauten Haus in der Grossbasler Altstadt gewohnt hatte.
Fischer hatte Tränen vergossen, als er durch eine schmucklose Todesanzeige in der Zeitung erfahren hatte, dass sein Mentor und zeitweiliger Financier nicht mehr war. Ein paar Tage vorher hatte er seinen Wohltäter noch gesehen, der über eine Unpässlichkeit geklagt hatte. Ihm sei der Teufel des Alters in den Kopf und in die Glieder geschossen, hatte Faller gestöhnt und Fischer eine Flasche Unikum Zwack gereicht. Er könne nicht mal mehr den vermaledeiten Verschluss einer Bitterlikörflasche aufdrehen, hatte der Alte gejammert, aber zum Glück gehe es mit dem Trinken noch ganz passabel.
Nun würde es keine ausufernden Diskussionen mehr geben, die immer mehr zu beseelten Monologen des Alten geworden waren, der mit knarzenden Budapestern seine Bibliothek durchmessen hatte, während sich Fischer mit dem Genuss ausgesuchter Weine aus dem Familienkeller oder besonders würziger Amarissimi ins richtige Feuer gebracht hatte, um Faller etwas entgegenhalten zu können, wenn der beispielsweise die Suche nach dem legendären Schatz des Gotenkönigs Alarich in Süditalien hatte andeichseln wollen.
Nun würde es auch keine Bücher mehr geben, die von Faller gekauft, aber nie gelesen wurden und deshalb bald darauf bei Fischer landeten. Und es würde vor allem keine finanziellen Zuschüsse mehr geben für die Verwirklichung linksradikaler Pläne wie Parteigründungen, Initiativen, Veröffentlichungen und direkte Aktionen, die Fischer im Auftrag des Alten hatte durchführen sollen und die alle meist schon im Anfangsstadium als Rohrkrepierer geendet hatten.
Wer waren eigentlich die Erben? Das fragte sich Fischer trotz aller Trauer. Welche gierige Bande holte sich das Haus in der Altstadt? Fischer wusste von einem Großneffen, der sowieso schon eine Menge Kohle hatte. Geerbt. Das Sahnehäubchen dazuverdient als Wirtschaftsanwalt.
Doch dann wurde Fallers Testament verlesen. Der Alte hatte sich unter anderem die Einrichtung einer Stiftung erbeten, in deren Stiftungsrat Melchior Fischer, eher erfolgloser Literat und nebulöser Anarchist, einsitzen sollte. Und selbiger Fischer sollte auch die Abdankungsrede bei seiner Grablegung halten.
Einen größeren Affront hätte der alte Faller seiner Sippe und der gesamten mehrbesseren Gesellschaft Basels nicht zumuten können.
So blieben offenbar auch diverse Eingeladene der Trauerfeier in der Kapelle 2 des Friedhofs am Hörnli zwischen der Stadt Basel und der Landgemeinde Riehen fern. Fischer hatte es nicht weit von seiner Behausung bis zum Gräberfeld. Drei Minuten mit dem Fahrrad. Er kam durch den Seiteneingang aufs Gelände und betrachtete den schmalen Trauerzug, der sich von den Parkplätzen her zur Abdankungshalle schob. Sofort sah er den kurzbeinigen Verkehrsminister, der sich so gerne als bekennender Nicht-Velofahrer bezeichnete. Der Mann wusste wohl nicht, dass es auch Kinderfahrräder gab, die für seine Größe bestens passen mochten. Wenigstens ein Mitglied der baselstädtischen Regierung war also bei Fallers Begräbnis anwesend.
Fischer schüttelte ein paar Hände, nachdem er sich dem Pfarrer vorgestellt hatte. Der Geistliche war vom Großneffen engagiert worden, obwohl der Tote bekennender Agnostiker gewesen war. Die Orgel bröselte den Trauermarsch von Frédéric Chopin unter die Anwesenden. Nach dem Priester mit seiner etwas lauen Predigt über den Stolz der Menschen, den diese nicht ins Grab mitnehmen konnten oder so ähnlich, ertönte Musik von Johann Sebastian Bach und dann war Fischer an der Reihe. Er war froh, dass er zu Hause ein paar Schlucke aus dem wohltuenden Krug genommen hatte. Während er nach vorne ans Rednerpult ging, bemerkte er, wie der kurzbeinige Regierungsrat zum Ausgang schlich und verschwand.
Nun gut, Fischer erzählte vom alten Faller, der sein Professor an der Universität gewesen war. Er würdigte den Witz und die ausgeleierten Pullover des Alten, erzählte von dessen unorthodoxer Art der Lehre und seiner Kritik an einer Wissenschaft ohne Leidenschaft und Liebe für das Abseitige.
Zur Beunruhigung eines eh bereits nervös auf den Stühlen herumrutschenden Teils des Publikums fügte Fischer hinzu, dass der Verstorbene diese Wissenschaft immer im Dienste des Volkes gesehen, also edles Engagement für die Entrechteten und Armen in dieser Gesellschaft gezeigt habe. Dabei dachte Fischer kurz an sich selbst als Empfänger solcher Wohltaten. Ja doch, er hatte sie sich verdient gehabt.
Es gab noch mehrere schöne Sachen über die fallersche Herzensgüte, die Fischer in Richtung Publikum sprach. Aber er sah, wie sich seine Worte ballten, nicht weiterkamen, es nicht in die Ohren und auch nicht in die Herzen der Menschen schafften, die da saßen und offiziell um jemanden trauern mussten. Es entstand eine dunkle Wolke von Worten, die über dem Publikum dräute, mehr geschah nicht.
Einen Moment lang war Fischer versucht, eine Brandrede zu halten und loszudonnern gegen das herzlose Geld und die grausliche Arroganz der Menschen, gegen die kriecherische Bourgeoisie und ihre politischen Zuträger von links nach rechts, gegen die Sturheit und Dummheit. Aber wer war er schon, dies den Leuten um die Ohren zu hauen? Man würde ihn entsetzt ansehen oder auslachen und seine Worte sogleich vergessen. Er beendete seine kleine Rede mit einem verbindlichen Memento mori an die Zuhörenden. Der zaghafte Applaus belohnte ihn nicht.
Alle Anwesenden waren froh, dass sie wieder nach draußen durften, in die Novemberluft, wo nicht Worte über ihnen hingen, sondern nur der Nebel.
Eine alte Dame bedankte sich jedoch bei Fischer für die schöne Rede. Sie sei eine ehemalige Haushälterin Fallers und der Herr Professor sei der beste Arbeitgeber der Welt gewesen, so ein liebenswürdiger und großzügiger Grandseigneur, eine Seele von Mensch, ach ja, ach je.
Fischer nickte zur späten Liebeserklärung und dankte der Frau seinerseits. Zum Leichenschmaus, wenn es denn überhaupt einen gab, war er nicht eingeladen worden.
Die Sache mit der Stiftung Cosimo Faller stellte sich als kompliziert heraus. Der restliche Stiftungsrat war von eher vorsichtiger, wenn nicht gar konservativer Natur. Als Präsident wurde der Großneffe gewählt.
Der machte sich gleich wichtig. Es existiere ein schriftliches Werk des alten Professors, das es zu sichten und später vielleicht zu publizieren gebe, das sei vordringlichste Aufgabe der Stiftung, aber das dauere. Man müsse namhafte Herausgeber und prominente Verleger finden, sich an Experten wenden. Und so weiter.
Fischers Einwände, dass der Stiftungszweck ebenso die Förderung sozialer Experimente sei, wurden weggewedelt oder protokolliert und bald vergessen. Selbstverständlich war er stets in der Minderheit, wenn es um die Bereitstellung von Geldern für gewisse Projekte ging. So entwickelte Fischer rasch eine schwere Abneigung gegen die anderen Stiftungsräte, hingegen durchaus eine Zuneigung für die einzige Rätin. Sie war eine gepflegte Dame, etwas jünger als er, eine Bekannte des alten Faller, die Fischer zweimal bei ihm angetroffen hatte. Eine Seelenverwandtschaft verbinde ihn und Juliane Habichtkraut, hatte der Alte ihm damals mit strahlenden Augen erklärt. Fischer vermutete, dass sie dessen illegitime Tochter war. Bei der Abdankungsfeier hatte er sie nicht gesehen.
Ebenjene Dame korrigierte jeweils die Räterunde mit »eine Herausgeberin« und »eine Verlegerin« sowie »eine Expertin«, was Fischer entzückte. Sie war die Einzige im Stiftungsrat, die mit ihm nicht wie nicht vorhanden umging.
Nach den regelmäßigen Sitzungen duschte Fischer stets lange und ausgiebig, bis er wieder sein Blut unter der Haut fließen spürte.
Rastlos hatte sich die Welt unterdessen weitergedreht. Niemand dachte etwas Schlimmes bis auf die üblichen Ausnahmen. Ein Wort huschte seit geraumer Zeit – neben einigen anderen – durch viele Gehirne: Klimakatastrophe.
Seit der Finanzkrise von 2008 eierte der Globalkapitalismus. Er schien doch nicht das Patentrezept zu sein. Ausbeutung, Zerstörung, Diskriminierung statt Friede, Freude, Eierkuchen – dem Wunschtraum der westlichen Welt. Da standen noch sehr viele Menschen vor den Türen der schon überfüllten Traumbahn Richtung Glück und wollten auch hinein.
Eine junge Frau aus Schweden war zum Sprachrohr der Jugend geworden und haute der Welt allerhand um die Ohren. Fischer hatte einen der ersten Artikel ausgeschnitten, der im Dezember 2018 in den Schweizer Medien über Greta Thunberg erschienen war, und mit Magneten an seiner Kühlschranktür befestigt. Die Rede der jungen Schwedin am Klimagipfel in Kattowitz: »Wenn Lösungen in diesem System so schwer zu finden sind, dann müssen wir vielleicht das System ändern.«
Weiterhin brannten am Amazonas die Wälder, die den Wandel des Klimas ein Stück weit korrigieren oder es vielleicht auch ein bisschen erträglicher hätten machen können, und auch der gesamtgesellschaftliche Wille, etwas zu ändern, dümpelte so dahin, statt dass er an Fahrt aufnahm.
Ein paar Siebengescheite stellten einmal mehr fest, dass es gar keine Probleme mit dem Klima geben konnte, weil jede Expertin und jeder Experte etwas anderes erzählten, wissenschaftlich nichts erhärtet sei und für jede nur mögliche Meinung handfeste Beweise bereitstünden.
Die Populisten und Nationalisten waren sowieso der festen Überzeugung, dass die Klimakatastrophe an den Grenzen ihres Heimatlandes anhielt, weil sie ganz einfach keine Einreisegenehmigung erhielt oder sofort nach Übertretung der Grenzen gnadenlos wieder ausgeschafft wurde.
Die politischen Parteien sprangen nach wie vor auf jeden Zug auf, der Stimmen bei Wahlen und Abstimmungen versprach. Das nannten sie dann Demokratie.
Immerhin ging ein Teil der Jugend nun jeden Freitag auf die Straße und hoffte, dass die verknöcherten Alten ebenfalls ein bisschen Angst bekamen.
Tim, der 18-jährige Sohn von Fischer, engagierte sich stark als Klimaaktivist. Fischers Tochter Rebecca studierte an der Universität, sie wollte seit Neuestem Juristin werden wie ihre Mutter.
Und plötzlich kam da dieses spezielle Virus über die Welt und veränderte sie ein bisschen. Auf einmal ging es auch ohne Billigflüge und pausenlose Beschallung und Bespaßung, der Konsumwahn schien zumindest kurzzeitig gestoppt.
Fischer nutzte diese Zeit, um in die Innenstadt Basels zu radeln und sich auf leere Plätze zu setzen, wo sich sonst die Menschen drängten. Er trank mitgebrachtes Bier auf der Münsterpfalz oder am verlassenen Rheinufer, er beschimpfte auf seiner Rundfahrt Angehörige von diversen Risikogruppen, die sich draußen herumtrieben, und forderte sie auf, sich sofort wieder in ihre eigenen vier Wände zu flüchten.
Er stand zur sonst ärgsten Stoßzeit im menschenleeren Hauptbahnhof Zürich, ein Erlebnis, das ihn geradezu erschütterte. Als er aus reiner Neugier in den ebenso völlig leeren Flughafen Mulhouse trat, kamen ihm fast die Tränen. Sollte sich da tatsächlich etwas ändern?
Selbstverständlich beteiligte er sich auch an den Hilfsmaßnahmen und ging für die Kilchmanns, das betagte Ehepaar, das unter ihm wohnte, einkaufen.
Doch seine Panik hielt sich in Grenzen. Fischer hatte bis anhin dem Staat und seiner Repräsentanz nie ein Wort geglaubt, warum sollte er es jetzt auf einmal anders halten? Regierungen, Ämter und Krisenstäbe waren per se hoffnungslos ineffizient, überfordert und flaschenhaft. Warum sollte ein kleines soziales Würstchen wie Melchior Fischer das große Zittern bekommen und alle diese noch dazu widersprüchlichen Maßnahmen befolgen, dachte er sich. Aber da dieses Virus offensichtlich doch gefährlich war, war es wohl besser, für einmal gehorsam zu sein.
Jedenfalls hatte er in der ersten Zeit des gesellschaftlichen Stillstands das Gefühl, dass er freier atmen konnte. Der April war schon fast zum Sommer geworden, der Rhein glänzte zufrieden in der Morgensonne, am Himmel zogen interessante Wolkenformationen vorbei, die Vögel pfiffen vielfältiger und lauter, die drei Bäume rund um seine Bleibe säuselten intensiver.
Fischer wurde bald klar, dass die Aufhebung des sogenannten Lockdowns und die Wiederaufnahme des gesellschaftlichen Lebens all diese Pracht und Herrlichkeit bald wieder in Grund und Boden stampfen würden. Dabei würde es neue Verluste geben. Komplizierte Geschichte, das alles.
Nun war der Vorabend des 1. Augusts, des Schweizer Nationalfeiertags, gekommen, und Fischer mochte das nicht mehr alles so genau durchdenken. Die ersten Böller explodierten schon. Bald würde es nur noch fiepen, pfeifen, krawettern, krachen, knallen und satanen, als ob tausend tolle Teufel Tango im Treibsand tanzten.
Wegen des Virus war das offizielle öffentliche Feuerwerk am Rhein abgesagt worden. Jetzt sprangen die Privaten in die Bresche und jagten alles, was an Raketen und Böllern vorhanden war, in die Luft, unter dem Vorwand, sich dabei bestens zu amüsieren.
Zwei
Sie hatten sich wie immer in letzter Zeit im Bandkeller ausgetobt und ausgekotzt. Noah und Raphi waren dann so um elf am Abend gegangen, sie wollten noch an den Rhein, Kollegen treffen.
»Böller abjagen und die Luft verschmutzen!« Célestin Geigys päpstlicher Vorwurf war ungehört verhallt bei den beiden Jüngeren. Luca hatte Celli spöttisch angesehen und abgewinkt.
»Hör auf zu predigen, das nützt nichts. Die werden’s schon noch schnallen.«
Luca Gygli und Célestin Geigy. Zwei tapfere Kämpfer pro bonum, contra malum. Zwei, die sich einsetzten für Mutter Erde und ihre gemeinsame Zukunft. Man musste sie einfach mögen.
Luca stammte aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Feinbäcker in einer bekannten Basler Konditorei, seine Mutter verdiente etwas als Kioskfrau dazu. Luca war das einzige Kind der Gyglis, so reichte eine Dreieinhalbzimmerwohnung mit Mansarde im Hirzbrunnenquartier. Unter dem Dach hatte sich Luca sein Utopia eingerichtet. Er kam jetzt in die letzte Klasse am Gymnasium. Danach wollte er so schnell wie möglich aus Basel fliehen. In die weite Welt hinein. Irgendwo musste doch die Revolution kurz vor dem Ausbruch stehen, irgendwo würden sich die Massen auflehnen gegen Kapital und Herrschaft.
Luca war groß und kräftig, versuchte sich an einem stechenden Blick, trug die Haare kurz und kleidete sich dunkel. Weibliche Zuneigung, auch in der abgeschwächtesten, platonischsten Form, verwirrte ihn in kürzester Zeit total und endgültig.
Célestin Geigy war sein Freund, seit sie zusammen auf die höhere Schule gekommen waren. Der junge Geigy wohnte bedeutend feudaler. Sein Vater war Arzt, seine Mutter war Mutter, man stammte aus einem weniger begüterten, aber immer noch vermögenden Zweig des alten Basler Geldadels. Celli, wie er von allen genannt werden wollte, hatte eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. Die Geigys wohnten in einem sehr geräumigen Einfamilienhaus im Wettsteinquartier.
Dass Luca und Celli zusammen ins Gymnasium gingen, war dem Vater Célestins zu verdanken, der seinen Ältesten extra nicht aufs Humanistische Gymnasium am Basler Münsterplatz geschickt hatte, wohin der mehrbessere Nachwuchs normalerweise zur Erlangung der schulischen Reife verfrachtet wurde, sondern ins eher liberale, wenn nicht gar linke Bäumlihofgymnasium im Grünen zwischen Basel und Riehen.
Während Luca diese ein bisschen zu mechanistische Geschichte mit dem Proletariat und der unausweichlichen Revolution für sich als gültig und passend entdeckt hatte, war Celli in einem liberalen, offenen Haushalt aufgewachsen und kannte ein bisschen mehr von der Welt.
Beide engagierten sich bald bei der Klimabewegung, nachdem sie schon Häuser besetzt, nächtelang diskutiert und an vielen verschwitzten Punkabenden im anarchistischen Lokal in der Nähe des Wettsteinplatzes ihren Schweiß vergossen hatten. Jedenfalls: Sie wollten Musik machen. Celli hatte schon vieles probiert: Geige, was zum Glück wegen des Familienfriedens nicht lange gedauert hatte, Flöte und Piccolo, was Celli absurd gefunden hatte, da er sicher nicht an der Basler Fasnacht mitmachen würde, schließlich Gitarre, was für alle okay war, solange das Instrument nicht elektrisch verstärkt losheulte.
Luca hatte immer davon geträumt, dass er ein Schlagzeug zu Weihnachten geschenkt bekäme. Er träumte und träumte so manches Jahr. Schließlich füllte er in den Ferien in einem Supermarkt Gestelle auf und kaufte sich ein etwas wackliges, gebrauchtes Drumset. Hauptsache, es war laut.
An der Utengasse in der Nähe des Kleinbasler Claraplatzes hatten sie dank der Vermittlung von Vater Geigy einen Bandkeller gefunden. Er war das geistige Hauptquartier der Musiker- und Politkommune Geigy/Gygli. Zeitweise hatte auch die clevere und etwas vorlaute Melinda Rübsamen, 17, genannt Melli, dazugehört, aber nach einem Verbot ihres Vaters, des Bankiers Martin Ernest Rübsamen, hatte sie nicht mehr in dieses »versiffte Anarcho-Nest« gehen dürfen, und auch die Beziehung von Melli und Celli hatte durch diese Zwangsmaßnahme geendet, worauf der junge Geigy in einer schweren Liebeskummerseuche versunken war, die nur durch verschärften Aktionismus gemildert werden konnte.
Hellsichtig hatte Célestin Geigy erkannt, dass die Liebe so nicht möglich war, sie konnte nur scheitern, denn die Verhältnisse waren gegen sie, Eltern, Lehrer, Umwelt, der Kapitalismus erst recht, alles war gegen die Liebe. Also musste da zuerst Remedur betrieben werden. Zur Not auch mit Gewalt, gegen das Gesetz, gegen die Betonköpfe …
Darüber hatten Luca und Celli gerade noch geredet, als ihre beiden Mitmusikanten der Punkband »Verdorbene Jugend« schon ans dicht besuchte Rheinufer gegangen waren, um ein paar Böller abzubrennen. Einfach so, nicht etwa, weil morgen Schweizer Nationalfeiertag war.
Celli raufte sich die verstrubbelten blonden Haare, die sich leicht kräuselten wie sein Geist und in alle Richtungen standen wie Antennen ins Weltall. »Dieses verdammte Scheißvirus macht die Leute krank im Kopf. Jetzt sitzen alle an der Mittleren Brücke, obwohl es gar kein großes Feuerwerk dieses Jahr gibt wegen Corona, und stecken sich gegenseitig an. Oder sie hocken im Garten daheim und verjubeln ihre paar Kröten mit diesem umweltschädigenden Krachermist. Das ist doch krank.«
»Letztes Jahr waren über 110.000 Charaktermasken beim offiziellen Feuerwerk. Stell dir das vor. Das ist die Gesellschaft des Spektakels.« Luca Gygli erinnerte sich nicht daran, wo er diesen Ausdruck aufgeschnappt hatte, aber schon lange hatte ihn eine kurze Sentenz nicht mehr so beeindruckt. »Wir müssen voll ein Zeichen gegen die Gesellschaft des Spektakels setzen. Radikal sein. Das weißt du schon, Celli?«
Was sie noch stärker umtrieb, war die Geschichte mit der Bankblockade. Aktivisten der Klimajugend hatten vor einer Woche, wie letztes Jahr schon, die Eingänge von Banken in Basel und Zürich besetzt und blockiert, weil diese Geldinstitute nach wie vor umweltschädliche Unternehmen finanzierten. Ein klares und nötiges Zeichen des Kampfes gegen den Klimawandel. In Basel waren auch ältere Leute dabei gewesen, die sich mit der Jugend solidarisiert hatten.
Die Polizei hatte auf Veranlassung der Privatbank Clavel et Cie. dort rabiat zugegriffen und die Blockierer und Besetzer verhaftet. Fünf von ihnen saßen immer noch in Untersuchungshaft wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Hausfriedensbruchs. Völlig ungerechtfertigt und total übertrieben. Reine Willkür der Justiz. Luca und Célestin waren auch dabei gewesen, aber ohne Verhaftung davongekommen. Sie machte sie krank, diese staatliche Machtentfaltung. Es war doch ihr Recht zu demonstrieren. Gegen diese Willkür musste man einfach etwas unternehmen. Nur was? An dieser Frage mochten die beiden schier verzweifeln.
Schließlich stiegen sie aus dem Übungskeller ins Freie und schauten sich unschlüssig an. Ein spätes Bier in der Anarchokneipe? Am Rheinufer? Oder nach Hause? Nein, das niemals!
Ein paar Häuser weiter weg vom Bandkeller, in Richtung des Claraplatzes, lag das Restaurant Zum Goldenen Kopf. Aus diesem Etablissement stolperte, kurz bevor der heiße, dumpfe Freitag zum Samstag und Nationalfeiertag wurde, ein Mann heraus, offensichtlich schwer alkoholisiert. Gerade waren Luca und Celli auf der anderen Seite der Utengasse auf Höhe des Restauranteingangs angelangt. Sie hatten sich entschlossen, doch noch schnell nachzuschauen, was da bei der Mittleren Brücke so abging.
Der Betrunkene stand jetzt mitten auf der Gasse und schüttelte hilflos, ratlos oder auch nur über seine Ohnmacht verwundert den Kopf.
»Fuck, das ist der Alte von Melli«, flüsterte Celli und versteckte sich hinter seinem Kumpel. Rübsamen, ein eher kleiner, schmaler Typ, blickte in ihre Richtung, sah aber wohl nichts. Er drehte sich einmal um die eigene Achse und wäre fast dabei gestürzt.
»Der Bankier?«
»Voll!«, hauchte Célestin Geigy.
»Der ist zu bis obenhin, der steht kurz vor dem Säufernirwana«, flüsterte Luca und setzte sich in Bewegung. Mit drei, vier schnellen Schritten erreichte er den Mann, der schwankte und Unverständliches vor sich hin brabbelte.
»Komm, Rübsamen, wir gehen nach Hause«, flötete Luca, und tatsächlich ließ sich der Bankier ohne Widerstand mitziehen. Bis zum Eingang des Hauses, wo der Übungskeller der hoffnungslosen Punkband »Verdorbene Jugend« war.
Weder Celli noch Luca konnten sich später erklären, wie es dazu kam, aber plötzlich lag dieser Rübsamen im lärmgedämmten Keller auf einer der etwas angegrabbelten Matratzen hinten im Raum, die Hände zusammengebunden, mit einem Sack über den Augen, einer Jutetasche, in der Luca sonst seine Drumsticks transportierte. Es war verblüffend, wie einfach das gegangen war. Dann schnarchte Rübsamen auch schon seinen Rausch aus.
»Geh nach Hause, Celli«, flüsterte Luca. Beide zitterten sie, vor Erregung, vor Angst, vielleicht auch im Rausche des Erfolgs.
»Ich bleibe hier, komm du morgen früh wieder. Wir haben einen Gefangenen. Einen von denen, die uns kaputtmachen wollen. Praktisch eine Geisel. Wir müssen sofort überlegen, wie es weitergeht. Wir stellen Forderungen. Die müssen jetzt die Hosen runterlassen, diese Kapitalistenschweine. Wir haben ein Mittel in der Hand. Wir müssen uns melden, zeigen, dass es keine Versöhnung gibt ohne Zugeständnisse. Gleich morgen früh.«
Celli sah Luca ganz verstört an. Auf dessen erneute Aufforderung hin stolperte er nach draußen in die Gasse, wo es von allen Seiten knallte, knatterte und pfiff.
Bei ihm zu Hause war alles ruhig, niemand war mehr wach. Er schlich die Treppe hoch zu seinem Zimmer. In seinem Kopf drehte es sich. Er schaute sich im Spiegel seines Kleiderschranks an und sah den kleinen, hübschen Celli mit den blonden Strubbelhaaren, aber er erkannte ihn nicht.
Ratlos saß er danach vor dem Computer und klickte wahllos im Internet herum. Er entdeckte, dass der »Goldene Kopf« die Stammkneipe der Studentenverbindung Vanitatis und der alte Rübsamen in dieser Organisation ein höheres Tier war.
Nun lag der Mann gefesselt im Bandkeller. War Luca wahnsinnig geworden? Waren sie beide wahnsinnig geworden? Was machte man denn mit einem Entführten?
Panisch gab er das Wort »Entführung« ein und las eine verdammt lange Liste von Entführungen in Deutschland, von politisch motivierten Freiheitsberaubungen und solchen, die nur Geld zum Zweck hatten. Célestin Geigy schlug die Hände vors Gesicht, sprang auf und eilte aufs Etagenklo. Er kniete sich vor die Kloschüssel und kotzte. Das musste alles raus.
Seine Mutter stand plötzlich in der Tür und sah ihn strafend an. Er lächelte seine Mam schief an und hob entschuldigend die Hände. Sie schüttelte den Kopf und ging wieder.
Celli hockte da und versuchte, die wilde Jagd in seinem Kopf etwas zu bändigen. Warum hatte er sich nicht gewehrt gegen Lucas Wahnsinnsidee? Er musste sofort in den Bandkeller. Wenn sie zur selben Stunde noch den alten Rübsamen mit seinem Restalkohol auf die Straße stellten, würde der sich an nichts mehr erinnern und irgendwie nach Hause kommen. Und er und Luca wären gerettet.
Das wäre wohl eine der kürzesten Entführungen der Geschichte, schoss es Célestin Geigy durch den Kopf, als er über den Wettsteinplatz zum Bandkeller hetzte. Eine Petarde explodierte nur ein paar Meter entfernt von ihm. Er erschrak fürchterlich. Dann lachte er. Wenn das alles war …
Rübsamen schnarchte fürchterlich.
Luca war auf dem Sofa eingeschlafen. Dort hatten Celli und Melli zum ersten und einzigen Mal Liebe gemacht. Danach hatte der alte Rübsamen, diese Drecksau, sie auseinandergebracht, auseinandergerissen. Vielleicht war es doch keine so schlechte Idee, an diesem Kapitalistensack ein Exempel zu statuieren?
Was aber würde passieren, wenn der Mann nüchtern wurde und merkte, dass er gefesselt und offensichtlich entführt worden war? Gar nicht nüchtern werden lassen. Oder sonst wie betäuben. Bewusstlos halten. Celli wusste im Prinzip, wie. Sein Vater hatte als praktizierender Arzt ein ordentliches Arsenal von chemischen Waffen in seinem Giftschrank auf dem Estrich. Dort hatte Celli schon öfters heimlich Inventur gemacht. Dort kam er an alles Mögliche heran.
Hier im Übungskeller wären er und Luca tagsüber sicher, spätestens gegen Abend würden Raphi und Noah wieder auftauchen. Oder sonstige Freunde vorbeischauen. Also was tun mit dem entführten Banker?
Luca setzte sich plötzlich auf und rieb sich die Augen. Dann schaute er sich um, als ob er sich erst wieder erinnern müsste. Bevor der junge Geigy etwas sagen konnte, legte Luca einen Finger auf seine Lippen und flüsterte: »Okay, Celli, wir machen das so.«
Drei
Fischer lag bäuchlings auf seinem Futon und atmete flach. Der Juli war sehr groß gewesen und auf sein Ende hin brutal sommerlich geworden. Zu heiß, zu flirrend, zu schweißtreibend für Fischers Geschmack. Sein rechter Unterarm klebte an Seite 134 und 135 eines an und für sich sehr spannenden, aber irgendwie auch sehr schlecht übersetzten amerikanischen Krimis.