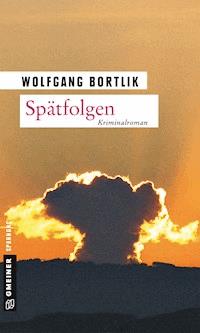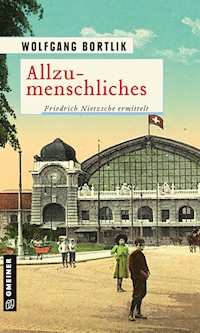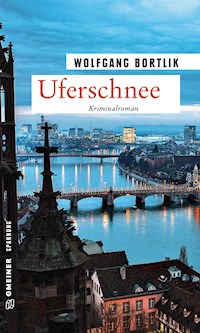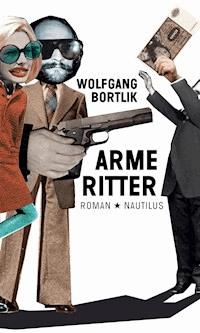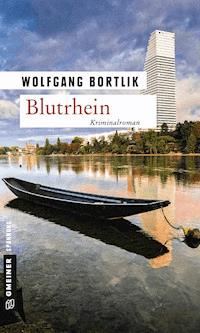
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hobbydetektiv Melchior Fischer
- Sprache: Deutsch
Der beliebte Basler Regierungsrat Burckhardt wird erstochen vor dem Theater aufgefunden. Kurz darauf erwischt es einen weiteren Basler Bürger beim Joggen. Auch er wird erstochen. Über seinen Fußballkumpel, Kriminalkommissär Gsöllpointner, gerät Melchior Fischer als Hobbydetektiv mitten ins mörderische Geschehen. Bald wird ihm klar, dass die beiden Mordopfer sich von früher kannten. Sind Jugendsünden das Mordmotiv? Und welche Rolle spielt die entzückende Witwe des Regierungsrats?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Bortlik
Blutrhein
Kriminalroman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Katja Ernst
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Christian Bieri / fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5288-8
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Gedicht
Der ist ein Narr, wer sammelt Gut
Und hat nicht Freud noch frohen Mut
Und weiß nicht, wem er solches spart
Wenn er zum finstern Keller fahrt.
Sebastian Brant
Einstens lebt ich süßes Leben
Denn mir war, als sei ich plötzlich
Nur ein duftiges Gewölke.
Karoline von Günderode
O so ist’s immer! So zündet das Schicksal das Theater unserer kleinen Lustspiele an und den schön gemalten Vorhang der Zukunft!
Jean Paul
Prolog
Was roch denn da so unangenehm? Das war ja geradezu unerträglich! Regierungsrat Carl Felix Burckhardt, Mitglied der Exekutive und Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements der Stadt Basel, rümpfte die Nase.
Ausgerechnet hier stank es. Burckhardt, von seinen sozialdemokratischen Parteifreunden nur »Karli« genannt, hob den Kopf, schloss die Augen und schnupperte zurückhaltend. Ganz genau, es stank nach menschlicher, allzu menschlicher Ausscheidung. Unglaublich, an diesem Ort, mitten in der schönen Stadt, auf dem Vorplatz zum Schauspielhaus, an Basels bevorzugter und hehrster Lage, roch es extrem nach Pisse.
Der Geruch kam vom Kunstwerk her. Genau von dort. Der Regierungsrat schnüffelte noch ein bisschen. Er hoffte, dass man ihn nicht beobachtete bei dieser unschönen Aktivität. Von diesem Eisengebilde kam er her, der Gestank. Von Richard Serras Plastik »Intersection«, einem Kunstwerk, das aus insgesamt vier knapp vier Meter hohen geschwungenen Stahlplatten bestand und vor dem Theater seinen Platz gefunden hatte. Ein mächtiger Eingriff in den Raum, die ästhetisch ordnende Hand des Metalls, der Schwung ins Unendliche, irritierend und irisierend, das Gewaltige in der Kunst. Das sagten die einen. Andere meinten, es sei eher ein Haufen Altmetall, der hoffnungslos und unschön vor sich hin roste.
Karli stöhnte auf. Den Schutz der Stahlplatten nutzten gewisse verantwortungslose Elemente als Toilette. Klar, er hatte schon gerüchtehalber davon gehört, aber dass das so schlimm war, das hätte er nicht gedacht.
Eigentlich hatte Burckhardt mit seiner Gattin Evangeline die neueste Produktion im Schauspielhaus anschauen wollen. Nicht, dass Karli ein großer Theatergänger gewesen wäre, aber man erwartete von ihm doch eine gewisse Präsenz in der kulturellen Öffentlichkeit. Dafür war das Theater immer gut. Da trafen sich das Bildungsbürgertum und die Mächtigen der Stadt. Dort wurde Burckhardts Anwesenheit auch von Kreisen, die der Sozialdemokratie fern standen, wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Aber dann hatte ihn eine SMS erreicht, in der seine Angetraute eine gewisse Nervosität, Magengrimmen und den Zitteri, kurzum also Krankheit angemeldet und den Theaterbesuch abgemeldet hatte. Karli war gerade frisch gescheitelt und mit Krawatte flott auf dem Weg vom Regierungsratssitz zum Theater gewesen, als ihn die Absage seiner Ehefrau erreichte. Sein Schritt hatte sich sofort merklich verlangsamt. Wie sah das aus, wenn ein Regierungsrat ohne Begleitung ins Theater trat? Gar nicht gut! Peinlich war das, peinlich sondergleichen, aber zurück konnte und wollte er auch nicht.
Typisch Evangeline, hatte Carl Felix Burckhardt noch gedacht. Das machte sie doch extra, ihn so bloßzustellen. Also würde er erst nach Beginn des Stückes ins Schauspielhaus huschen. Die anderen Besucher sollten ihn als den Schaffer und Workaholic bewundern, der stets im Einsatz für die Bevölkerung Basels war – sodass er sogar den Beginn des Theaterstücks, diese Sensation zur Saisoneröffnung, verpassen musste.
Deshalb stand Burckhardt also kurz nach Vorstellungsbeginn etwas abseits vom Theatereingang bei dieser eisernen Skulptur und ging dieser erschnüffelten Schweinerei nach. Es konnte nicht sein, dass Kunst als Urinal missbraucht wurde. Er schüttelte sich in seinem Maßanzug und trat, die Nase gerümpft, nahe ans Kunstwerk heran. Es war schon ziemlich dunkel, bald kam der Herbst, und die Nacht nahm zu. Die Metallwände des Kunstwerks stiegen vor Karli steil in die Höhe. Zwar leuchtete hell ein Scheinwerfer und illuminierte den Theatervorplatz, aber desto mehr gab es auch Schatten und Dunkelheit, gerade bei der Eisenplastik.
Und da war noch etwas. Gesang. Keine verständlichen Worte, kein Sinn. Skurrile Laute zu einer kleinen Melodie. Und dann plätscherte es. Da schiffte so ein Kerl einfach vor sich hin. Karli spähte in die Zwischenräume des Kunstwerks, sah aber nichts.
»Hallo, wer ist denn da?« Mehr fiel dem Regierungsrat nicht ein. Ein paar jugendliche Nachtschwärmer saßen wenige Meter entfernt auf einer Steintreppe und schauten kurz auf, als Karli ausrief. Dann beschäftigten sie sich wieder mit sich selbst. Burckhardt seinerseits ging vorsichtig ein, zwei Schritte in die Skulptur hinein. Er zögerte keine Sekunde, immerhin trainierte er dreimal in der Woche. Er war in Form. Da gab es nichts, wenn ihm so ein Wasserlasser blöd kommen würde. Außerdem war das seine Pflicht als öffentliche Person und Politiker, es ging darum, hier und jetzt Präsenz zu zeigen. Dieser gewissenlose Brunzer musste gestellt werden, im Dienste der Öffentlichkeit und des Gemeinwohls. Dieser Vandale sollte dran glauben.
Das Singen und Summen verstummte jäh. Carl Felix Burckhardt sah immer noch nichts außer rostigen Stahl. Sollte man eine öffentliche Skulptur des Nachts nicht besser ausleuchten?, schoss es ihm durch den Kopf. War der Typ, der seine Blase entleert hatte, vielleicht auf der anderen Seite der Metallwand? Ratlos drehte er sich um, lauschte, hörte ein kurzes Schaben, zwei, drei gedämpfte Schritte. Plötzlich traf ihn der Schlag.
Etwas fuhr zwischen seine Schulterblätter, stach dort hinein, versetzte seinen Körper in einen Schockzustand, verletzte ihn schwer, raubte ihm alle Kräfte. Seine Füße gaben nach, er sank auf die Knie. Sein schöner Anzug, um Himmels willen. Und was war das für ein unglaublicher Schmerz? Und wieder hörte er leise, unverständliche Worte zu dieser dummen kleinen Melodie. Dann nahm der Schmerz überhand, überwältigte ihn, und er lag da, das Gesicht auf dem Boden. Er spürte, wie es ihm warm den Rücken herunterlief. Er roch etwas, was den Geruch nach Urin überdeckte. Etwas Süßliches, Aufdringliches. War das Blut?
Eins
Über 50 Jahre war Fischer nun schon gestanden. So eine ewig lange Zeit übte er jetzt den aufrechten Gang. Langsam wurde das immer beschwerlicher und peinvoller. Der Rücken krümmte sich, die Knie knackten und die Plattfüße brannten. Der Mensch war nicht geboren, um zu stehen. Eigentlich, so war sich Fischer mittlerweile mehr als sicher, müsste des Menschen Aufenthalt auf dieser Erde im wahrsten und vernünftigsten Sinne ein liegender sein, parallel zum Grund und Boden dieser manchmal so entsetzlich schönen Welt. Mehr oder weniger waagerecht sollte der Mensch seine Tage verbringen, ohne aufrechtes Pathos. Keine pfeilgrade Pose der Unerschütterlichkeit musste er einnehmen oder gar den Last Man Standing nachstellen. Im Liegen sollte der Homo sapiens sinnieren, spintisieren, vielleicht auch räsonieren, nicht aber in der Vertikalen den Helden markieren.
Liegen, richtig liegen, den Körper geschmiegt an die Unterlage, die nicht zu hart und nicht zu weich, die nicht zu abweisend und nicht zu nachgiebig sein durfte. Was war das für eine Wohltat, so zu liegen. Die Beine, die Gelenke entlastet vom allzu schwer gewordenen Körper. Und der gedankenschwangere Kopf auf einem bequemen Kissen, wo er harmlos vor sich hin brodeln konnte.
Fischer wälzte sein leichtes Übergewicht auf die andere Seite, dort, wo ihn die Hüfte nicht schmerzte. Das tat gut. Diese Unbill mit seinem Gelenk kam vom Fußballspielen. Er hatte es einfach übertrieben. Seit dem letzten Frühjahr ging er mit alten und neuen Bekannten einmal in der Woche aufs Feld der Ehre. Nun, Mitte September, war er wieder einigermaßen mit dem Ball vertraut und in Form gekommen. Seine bescheidene jugendliche Karriere als Torjäger fand so auf den Nebenplätzen des St.-Jakob-Stadions zu Basel eine würdige Fortsetzung. Aber nach der mittäglichen und mittwöchentlichen Anderthalbstunde auf dem unwirtlichen Kunstrasen tat Fischer so ziemlich alles weh, was er an Muskeln, Sehnen, Bändern und Knochen hatte.
Deswegen lag er dann, kaum zu Hause, so flach als möglich. Gänzlich hingestreckt. Was für ein Genuss, sich an den alten Futon zu schmiegen. Ja, das Liegen. Früher aß man im Liegen, in der Antike pflegte man das Gespräch in der Horizontale. Auch der Liebesakt gelang an und für sich besser im Dahingestrecktsein als im Aufrechten. Wobei, aufrecht musste dabei schon etwas sein und …
In Fischers schöne Gedanken schrillte der Festanschluss im Nebenzimmer. Wer wagte es? Maria, die Geliebte? Kaum. Eines seiner beiden Kinder, das der väterlichen Hilfe bedurfte? Rebecca, die in einem Chor sang und ihn bei einer Veranstaltung als Publikum wünschte? Tim, der Juniorenfußballer, der die kräftige Stimme seines Vaters zur Unterstützung am Spielfeldrand hören wollte? Oder rief gar ein vorwitziger Fremder an, der sich sein Geld mit Telefonwerbung verdienen musste? Oder war vielleicht das Unsichtbare Komitee an der Strippe? Fischer drehte sich mit einem wütenden Fluch um und schrie auf, als er die schmerzende Hüfte belastete. Das Läuten verstummte vor Schreck.
Er lauschte noch nach, blieb liegen und küsste sein Kopfkissen. Ein Viertelstündchen noch, höchstens 20 Minuten.
In einem wirren Traum sollte Fischer für die intergalaktische Meisterschaft im Team seines Heimatplaneten auflaufen. Allerdings hatte er seine Fußballschuhe zu Hause vergessen, und es gab kein Raumschiff, das ihn mit Überlichtgeschwindigkeit von Beteigeuze auf die Erde bringen konnte. Vielleicht konnte er barfuß spielen, doch wie es aussah, war das Gras auf dem Schulterstern des Orion hart wie Glas. Es war auch gar kein Gras und schon gar kein Rasen, das sah Fischer ganz genau, es waren Myriaden von wogenden, grünen Tierchen, aus deren Mäulchen spitze, elfenbeinweiße Zähnchen blitzten.
In seine grandiose Traumverzweiflung platzte wieder das Telefon. Fischer riss sich zusammen, stemmte seinen kleinen Bauch hoch und hinkte zum Festanschluss. Maria war am Apparat. Ganz außergewöhnlich um diese Zeit. Fischer stand jetzt doppelt.
Die Stimme seiner Geliebten jedoch war hart und gnadenlos. Noch traumverloren begriff Fischer nicht gleich den Inhalt ihres Anrufs und kratzte sich am Hinterkopf. Endlich ging ihm ein Licht auf, und er stammelte, dass er es selbstverständlich nicht vergessen habe, dass sie heute Abend ins Theater gingen. Diese furiose Regiearbeit von Giovanni Setesangre, seine neueste Interpretation einer griechischen Tragödie, eines Klassikers, ja, selbstredend, das musste man einfach gesehen haben.
Fischers Männlichkeit ließ sich unterdessen hängen. Tatsächlich hatte er es gründlich verdrängt, dass er versprochen hatte, Maria Casaramone, die Dame seines Herzens, in die Gefilde von Thalia zu begleiten. Fischer mochte das Theater nicht, und wenn es etwas gab, was er aus vollem Herzen hasste, dann war es der Betrieb um das Theater. Deswegen hatte er ja auch in seinen Jahren als Literat in dieser Stadt keinen Fuß auf den Boden gebracht, weil hier im zutiefst bourgeoisen Basel wegen des Schauspiels allen der heilige Brand die Medulla oblongata hinunterrieselte, während das geschriebene Wort nur eine verschrobene Existenz am Rande führte. Anerkennung und Geld gab es nur für das Spektakel.
In Fischers Kopf war immer Theater und stets die Hölle los. Zum Denken und zum Amüsement brauchte er keine brüllende Bühne. Wenn man wenigstens hätte liegen können im Zuschauerraum. Ein paar bequeme Matratzen, von denen aus man diese extrovertierten Darbietungen ohne Stress betrachten und wo man im Falle des Nichtgefallens oder der kompletten Anödung einfach abschalten und ein bisschen dösen hätte können.
Dies exemplifizierte Fischer aber nicht gegenüber seiner Freundin – damit würde er bei ihr auf völliges Unverständnis stoßen, und das musste ja nicht sein. Er log von ganzem Herzen, als er Maria versicherte, dass er sich auf die Vorstellung freue. Ihre Stimme verlor ein wenig vom harten Klang und Befehlston. Fischer nickte zufrieden, brummte eine Liebeserklärung, schickte drei Küsse durch die Leitung und legte auf.
Trotz der quälenden Hüfte fühlte er sich großartig. Immerhin hatte er heute Mittag drei Tore geschossen. Obwohl Bulle Roth, sonst sein kongenialer Vorbereiter, in der gegnerischen Mannschaft gespielt hatte. Fischer ließ sich noch mal aufs Lotterbett sinken und dachte daran, wie er aus spitzem Winkel den Ball an Benno, dem Goalie, vorbeigehämmert hatte. Er drehte sich auf die schmerzende Seite. Das tat schon nicht mehr so weh. Noch ein Viertelstündchen, allerhöchstens 20 Minuten. Aber bald würde er sich bereit machen müssen für den Theaterbesuch. Das Leben war hart und ungerecht. Und Maria kannte keine Gnade.
Schon am Eingang zum Theater Basel erblickte Fischer einen Bekannten, ausgerechnet den massigen Bulle Roth, der die Drehtür aus Glas blockierte. Mehrere bepelzte Damen brandeten als teuer gekleidete Sturmflut an ihn an und rollten, empört mit den Tickets wedelnd, wieder zurück, um erneut zu versuchen, an dem breitschultrigen Mann vorbeizuschwappen.
Bulle Roth hieß eigentlich gar nicht so, sein auf der Geburtsurkunde eingetragener Name lautete Franz Gsöllpointner. Aber er war ein Bulle und, ursprünglich aus dem oberbayrischen Isartal stammend, ein unverbesserlicher Fan des FC Bayern München. Der Held seiner fußballerischen Jugend war Franz Roth, genannt Bulle. Der spielte von 1966 bis 1978 bei den Bayern, also noch bevor das ein Club für die Gewappelten und Hochgestochenen wurde und als der Steuerbetrüger Hoeneß selbst noch am Ball aktiv war.
Bulle Roth beziehungsweise Kommissär Franz Gsöllpointner von der Basler Kriminalpolizei sah auch nicht unbedingt glücklich aus, wie er da vor dem Theatereingang stand. Seine Gattin, eine echte Baslerin und daher dem Theater verfallen, zupfte da und dort an seinem Anzug oder an der Krawatte herum. Bulle Roth wirkte, als habe er sich für einen Undercover-Einsatz verkleidet.
Fischer wollte schon, die Hand zum Gruß erhoben, nach ihm rufen, als der Kommissär und seine Frau zügig im Theater verschwanden, im Gefolge die Pelzschabracken vom Bruderholz.
Auch Maria schob ihn zärtlich vorwärts: »Weißt du, ich freue mich total auf das Stück. Setesangre ist einer der letzten großen Regisseure Italiens, die sich ihr kritisches Potenzial behalten haben. Er ist ein wahrer Kommunist des Herzens.«
Fischer dachte, er habe sich verhört, aber Maria wiederholte: »Ein wahrer Kommunist des Herzens, verstehst du?«
Was es nicht alles gab. Fischer hätte gerne verstanden, aber es wollte ihm nicht gelingen, die menschliche Blutpumpe und Marx und Lenin in einen Zusammenhang zu bringen.
Nach dem ersten Akt war Fischer enttäuscht von diesem Herzenskommunismus. Er hatte zumindest Schauspieler in blutbesudelten Naziuniformen erwartet oder Nackte, die sich angestrengt an der Defäkation als grandioser Gesellschaftskritik abarbeiteten. Stalinistische Surrealisten, die mit Wasserpistolen voll Salzsäure auf die ersten drei Reihen im Theater schossen. Nichts dergleichen. Es war eine unspektakuläre Inszenierung, Schauspielerinnen und Schauspieler in strengen Herrenanzügen, wobei die Männer eher hemdsärmelig waren. Antigone sah aus wie die Pressesprecherin eines der hiesigen Chemiekonzerne, Kreon glich eher einem sozialdemokratischen Regierungsrat.
»Ganz schön raffiniert«, flüsterte Fischer seiner Geliebten ins Ohr. »Das göttliche Recht, vertreten von Antigone, also im Prinzip die Chemie in Basel, gegen die Staatsraison, die politische Exekutive, verkörpert durch einen Sozialdemokraten contre coeur, diesen Kreon. Ist das Herzenskommunismus?«
Dabei versuchte er, Hautkontakt mit Maria zu haben. Die aber wandte sich brüsk ab und starrte wieder gebannt nach vorne. Fischer mühte sich mit dem Gebotenen, aber auf einmal dachte er, dass die Figuren auf der Bühne alle so redeten, als hätte Sophokles das Handy erfunden.
Mitten im schönsten Stimmengewirr erhob sich drei Reihen vor ihm plötzlich ein Mann. Bulle Roth. Er hielt ein iPhone in der Hand und schob sich energisch durch die Sitzreihe nach draußen. Der Franz sah irgendwie glücklich, ja beseelt aus, dachte sich Fischer. Vielleicht sollte er hinter dem Fußballspezi her eilen. Aber wahrscheinlich rief den einfach sein Amt. Irgendwo ein Fall, ein Delikt, möglicherweise sogar ein Toter, der im friedlichen Basel mindestens einen Tag lang das Hauptgesprächsthema sein würde, bevor man sich wieder dem zu frühen Herbst oder den kommenden Attraktionen wie Herbstmesse und Fasnacht widmete.
Fischer sah sich also trotz Schmerzen in der Hüfte und diverser Gähnattacken tapfer die Tragödie des griechischen Dichters an. Kurz bevor der Suizid im Stück überhandnahm, war Pause. Fischer hechtete, nein humpelte so schnell wie möglich zum Ausschank im Erdgeschoss neben dem Haupteingang. Draußen blitzten blaue Lichter aufdringlich durch die Nacht.
»Da ist irgendwas passiert bei der Skulptur, alles voll Polizei!«, grummelte der Barkeeper und schob Fischers Bier über die Theke. Mehr wusste er aber nicht.
Fischer nahm seufzend einen Schluck. Bulle Roth, der Glückliche, der konnte da draußen für sich werkeln an einem Kriminalfall, an einem Meisterwerk des Realismus. Obwohl der Kommissär eigentlich hier auf der Bühne, in einem Anfall von Herzenskommunismus, sofort den Regierungsrat, der so aussah wie der Tyrann Kreon, wegen staatlicher Willkür hätte festnehmen müssen.
Als dann endlich alle tot waren und die Tragödie vorbei, drängte Fischer neugierig aus dem Theater ins Freie. Gleich bei der Metallskulptur von Richard Serra war immer noch Polizei, Absperrung, Tohuwabohu und Auskunftssperre. Da musste einiges passiert sein.
Maria zog Fischer von diesem Tatort weg. Sie wolle jetzt lieber über das im Theater Erlebte diskutieren. Sie schlenderten durch die Konsummeile der Innenstadt bis hin zur Mittleren Brücke und überquerten den ältesten Rheinübergang Basels aus dem 13. Jahrhundert. So gelangten sie in den rechtsrheinischen Teil der Stadt, ins sogenannte Kleinbasel, wo sie beide wohnten und sich noch in einer angesagten Bar im kleinen und durchaus properen Rotlichtviertel über diese Antigone austauschen wollten.
Wie es sich für eine wohlanständige Schweizer Stadt gehört, lag auch in Basel der Campus der käuflichen Liebe im minderen, ehedem proletarischen Teil der Stadt, eben im Kleinbasel. Gleich nach der Mittleren Brücke links, in drei, vier Gassen war der Straßenstrich erlaubt, und es drängten sich dort in eigentlich bester Wohnlage die entsprechenden Etablissements.
Im Rahmen des Spätkapitalismus, der Globalisierung und durch die Zuwanderung aus dem Osten war der Konkurrenzdruck unter den Sexarbeiterinnen enorm gestiegen. So hatten diese immer aggressiver um Kundschaft geworben, oft auch außerhalb der erlaubten Zone der Kleinbasler Gassen. Die Prostituierten hatten Hauseingänge besetzt, auch sexuell Desinteressierte belästigt und sich durch Polizeikontrollen nicht vertreiben lassen. Die Beischlafbeschafferinnen waren so zum Störfaktor geworden, auch in der städtisch vorgeschriebenen Toleranzzone für den Straßenstrich.
Dann hatte dort ein stadtbekanntes Bordell, aus welchen Gründen auch immer, geschlossen, das der Anwohnerschaft sowie den Behörden seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge gewesen war. Das sich in Privatbesitz befindliche Gebäude war in eine sogenannte normale Nutzung überführt worden. Die dortigen Tage der Sexarbeiterinnen und Freier waren gezählt, die oberen Geschosse wurden renoviert und zu Wohnraum umgebaut, im Parterre hatte sich ebenjene angesagte Bar breitgemacht. Das Interieur war schwarz und als Kapital standen viele, viele Flaschen mit äußerst erfreulichem Inhalt hinter der Theke. An manchen Abenden rumpelte dort eine mediokre Band live eine Fusion aus Südstaatenrock und Punk daher. Als Zugabe gab es meist eine Hochgeschwindigkeitsversion von Robert Johnsons »Crossroads«, Muddy Waters »Rollin’ and Tumblin’« oder Hank Williams »I’m so lonesome I could cry«. Egal, die Lärmschutzvorrichtungen waren vom Feinsten. Es wurde gewippt und geschwoft. Alles war recht leicht und locker.
Fischer jedoch hatte sich immer ein bisschen unwohl in dieser angesagten Bar gefühlt. Er hatte sogar das Gefühl, dass er vom spindeldürren Barkeeper besonders nachlässig, wenn nicht sogar verächtlich behandelt und bedient wurde. War es wegen seines doch schon fortgeschrittenen Alters? So viel jünger als er war Maria ja auch wieder nicht, oder? Vielleicht konnte der Barkeeper aber auch das gut lesbar in Fischers Gesicht stehende Erstaunen über die nicht unerheblichen Getränkepreise richtig interpretieren. Dass sich die jungen Leute solche teuren Drinks leisten konnten, darüber wunderte sich Fischer regelmäßig.
Der beträchtliche Lärmpegel in der angesagten Bar war andererseits immer ein Vorteil gewesen. So hatte Fischer, auch wenn er nicht alles verstand, was ihm Maria jeweils erzählte, vieles einfach abnicken können. Und so würde er das jetzt auch bei dem zu erwartenden Hochloben der Sophokles-Inszenierung von Giovanni Setesangre durch seine Freundin machen, mit vielen Jas und Sichers und Sowiesos, die er ins überteuerte Bier hineinmurmeln würde. Er hatte das Antigone-Spektakel schon fast wieder verdrängt, doch den Inhalt der klassischen Tragödie kannte er selbstverständlich noch vom Gymnasium her. Allerdings hätte er viel lieber gewusst, was das für ein Tamtam vor dem Theater mit der Polizei gewesen war.
Noch auf dem Weg zur angesagten Bar und kaum auf Kleinbasler Boden, ratterte Marias Handy; »Enough is enough« von Chumbawamba als Klingelton. Sie hielt das Ding an ihr süßes Ohr und klammerte sich plötzlich an Fischers Jackettärmel. »Um Himmels willen, das gibt’s doch nicht, Karli Burckhardt ist tot. Ziemlich sicher ermordet. Beim Theater!«
»Was? Heiliges Kanonenrohr, dann war der Aufstand bei der Pinkelplastik wegen ihm. Wer zur Hölle bringt denn an so einem Ort einen Regierungsrat um?«
Fischers Freundin war bei der sozialdemokratischen Partei. Da er sich ideologisch bedeutend weiter links außen definierte, kam es durchaus zu politischen Zerwürfnissen zwischen ihnen. Vor allem auch über diesen Regierungsrat und Baudirektor Burckhardt, der nach Fischer nichts anderes als ein willfähriger Lakai der lokalen Tiefbauunternehmen und der in Basel ansässigen internationalen Konzerne war. Die scheußlichen Hochhäuser, vielstöckige Bürogebäude, die der Chemieriese Heuslerpharm gerade baute, hatte der Sozialdemokrat Karli durchgewinkt. Das betreffende Gebiet wurde von der Politik problemlos in eine Bauzone umgewandelt, in der solche Wolkenkratzer hingestellt werden konnten. Gegen diese Verschandelung und Überbauung eines ganzen Quartiers hatte es keine behördlichen Bedenken gegeben. Der normale Steuerzahler hingegen musste sich schon für ein Sonnendach über dem Balkon eine städtische Bewilligung holen, die auch noch eine Menge Geld kostete. Ein harmloser Bewohner dieser Stadt wie Fischer war doch bloß noch Quantité negligeable. Stimmvolk, auf das nur bei den Wahlen alle vier Jahre kurz Rücksicht genommen wurde.
Und dieser Carl Felix Burckhardt in seiner Eigenschaft als oberster Chef des Basler Baudepartements vergällte dem leidenschaftlichen Fahrradfahrer Melchior Fischer auch ganz direkt das Leben. Ständig stieß er in dieser Stadt auf aufgerissene und gesperrte Straßen, an denen ein paar Arbeiter herumwurstelten und so quasi lebenslange Baustellen schufen, während private Bauvorhaben ruckzuck erledigt waren. So kam es Fischer jedenfalls vor. Der einfache Einwohner und Steuerzahler war immer der Letzte, auf den in dieser Stadt Rücksicht genommen wurde.
Um des lieben Friedens willen hielt Fischer aber den Mund, denn mit Maria darüber zu streiten, war sinnlos, ja masochistisch. Schließlich hatte die Sozialdemokratie, früher einmal die Heimat der Unterprivilegierten, in dieser Stadt die politische Oberhand. Jedenfalls auf dem Papier, den Wahlergebnissen nach. Aber davon spürte Fischer als eigentlicher Angehöriger des Prekariats einen elenden Hühnerdreck. Die Verdammten dieser Erde blieben verdammt noch mal verdammt!
Er hätte in dieser wohlhabenden Stadt, aber eigentlich in der ganzen reichen Schweiz, als soziale und auch ökonomische Großtat beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen erwartet. 2.500 Fränkli jeden Monat für jede und jeden, das würde den Leuten mit Barem aushelfen, dabei die Invalidenrente und andere soziale Kassen entlasten, überdies den Konsum anheizen, und das bisschen Schotter für alle täte niemandem weh. Da gab man für das völlig sinnlose Militär bedeutend mehr aus. Die paar Milliarden, die so was kostete, wären noch dazu durch eine stärkere Besteuerung der Ultrareichen und der Firmenprofite jederzeit wieder hereinzuholen. Damit die Ausbeuter wenigstens ein bisschen mit den Ohren schlackerten. Aber denkste, das war mitnichten die Position der Sozialdämmerkratie in Basel. In deren Schatten gab es zwar noch eine wesentlich linkere Organisation, die aber auch nur auf Besitzstandswahrung aus war und deren Ratlosigkeit man unter anderem von ihrer Homepage ablesen konnte. Die war noch weniger aktuell als die von Melchior Fischer, Schriftsteller.
»Man hat den Karli wohl erstochen, bei diesem Schrotthaufen vor dem Theater. Mein Gott, dann war das Polizeiaufgebot dort ja wegen ihm …« Maria schluchzte, hob hilflos die Arme, ließ sie wieder sinken und drängte sich an ihren Freund.
»Geschieht ihm recht, diesem windelweichen sozialdemokratischen Arbeiterverräter!«
Nein, das sagte Fischer selbstverständlich nicht, auch wenn es ihm auf der Zunge lag. Er war durchaus betroffen, wie rasch der Tod ins blühende Leben griff, ein Pflänzchen auszupfte und auf den Misthaufen der Geschichte warf.
Aber er war hartgesotten, und im Laufe seines Lebens hatte er gelernt, dass die Liebe entgegen früherer Überzeugungen keine politischen Positionen kannte. Fürsorglich, aber hektisch schlang er seine Arme um die Freundin und trat ihr dabei auf den Fuß. Ihr hauchzartes »Aua« ließ er mit einem Kuss verstummen. Maria bebte und Fischer hielt sie fest, streichelte ihr über die schwarzen Locken und schaute in den hellen Nachthimmel. Da oben zischte jetzt vielleicht die Seele des ehemaligen Baudirektors der Stadt Basel herum. Obwohl Fischer nach wie vor der Meinung war, dass der Magistrat in die tiefste Hölle gehörte.
Zwei
In den nächsten Tagen hatten die Medien in nah und fern gut zu tun. Der mysteriöse Mord am Basler Baudirektor brachte die Stadt auf den vordersten Radarschirm der öffentlichen Wahrnehmung, nicht nur im helvetischen Vaterland. Auch das Ausland horchte interessiert auf. Was für eine Tragödie. Bei »Basel Tourismus« war man sich nach Tagen noch nicht sicher, ob dieser Fall jetzt gut oder schlecht war für das touristische Label »Basel tickt anders« und den Fremdenverkehr.
Wild wucherten Spekulationen um die Täterschaft und eventuelle Motive. Es war schlicht unvorstellbar, dass eine Respektsperson von irgendeinem Sauhund einfach öffentlich hingeschlachtet worden war.
Die Polizei hielt sich bedeckt und informierte nur spärlich. Es gab laut Medienmitteilungen keine brauchbaren Hinweise aus der Bevölkerung. Obwohl der Theaterplatz abends ziemlich belebt und es noch nicht richtig dunkel gewesen war, hatte niemand etwas von dem schrecklichen Geschehen mitbekommen. Der schon tote Karli war zufälligerweise von einem jungen Mann entdeckt worden, der, nach eigenen Worten, im Schutze der Serraplastik schnell hatte Pipi machen wollen und über die Leiche gestolpert war.
Fischer sah, dass sich Maria wieder beruhigte und ihre nicht unbeträchtliche Tatkraft der Partei zur Verfügung stellte, um einen Nachfolger, oder noch viel besser eine Nachfolgerin für den unglücklichen Regierungsrat zu finden. Das bedeutete allerdings, dass Fischer abends oft allein war. Er hätte nun in die angesagten Bars gehen können und sich dort dem Leben in all seiner unverfälschten Spontaneität und Wirkungsmacht an die Brust werfen können. In Tat und Wahrheit aber saß er lieber zu Hause im bequemen Fernsehsessel und sah sich jedes Fußballspiel an, das er finden konnte. Sehr oft schlief er dabei ein, im Sessel und ganz ohne seinen geliebten Futon zu benützen.
Maria kam erst spätabends von den Parteisitzungen nach Hause. Ihrer Atemluft nach war sie anschließend an die politischen Entscheidungsfindungen noch in die eine oder andere angesagte Bar gegangen. Sie wies den schlaftrunkenen Fischer recht aufgekratzt drauf hin, dass er ruhig einmal im »Charlie«, im »Rostigen Hufnagel«, in der »Nachtbar« oder in sonst einer dieser neuen Bars auf sie warten könnte, wenn sie sich von der aufreibenden politischen Arbeit erholen wollte.
Fischer nahm diesen Tadel ritterlich an und lauschte noch ein Weilchen den Partei-Interna von Maria, bis er sie mit dem üblichen Kuss zum Verstummen brachte. Ab und zu hatte er Erfolg damit. Auch weitergehenden.
Er freute sich sehr, als es schließlich wieder Mittwoch war und er die Sporttasche packte, um mit ihr auf dem Rücken zu den Sportanlagen St. Jakob zu radeln. Es hatte bis kurz vor Mittag geregnet, aber nun rissen die Wolken auf, blaue Himmelsfetzen zeigten sich, Licht kam in die Welt, und seufzend schüttelten die Bäume die Wassertropfen von sich, wenn der Wind in sie fuhr.
»Der Fußballmittwoch ist heilig!« Der gute Bulle Roth stand schon auf dem Platz.