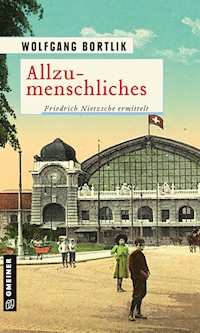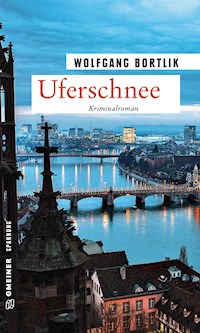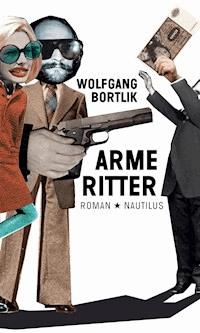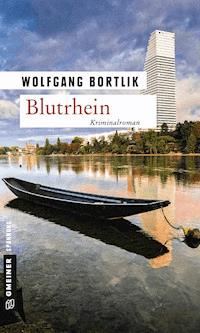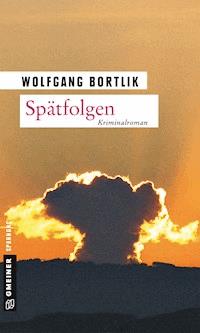
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hobbydetektiv Melchior Fischer
- Sprache: Deutsch
Was tun? Melchior Fischer wollte eigentlich nur einen Artikel schreiben, einen gewöhnlichen Artikel über die Anti-Atomkraftbewegung. Und plötzlich stolpert er bei seiner Recherche über eine Leiche im Keller - eine nicht sprichwörtliche Leiche! Als er dann auch noch das geheimnisvolle Tagebuch seines verstorbenen Bruders entdeckt, das eindeutig in Verbindung mit dem Todesfall steht, muss Melchior - ausgerechnet jetzt fastet er heil und streng - erst mal eine Tasse Beruhigungstee trinken …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Bortlik
Spätfolgen
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Mirjam Hecht
E-Book: Benjamin Arnold
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Virage / Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4604-7
Danksagung
Der Autor bedankt sich für die Förderung durch:
Zitate
Mein verwirrter Zustand ging mit mir durch
und gab mir die wahnsinnigsten Einflüsterungen,
denen ich der Reihe nach gehorchte.
Knut Hamsun
Der Mensch ist erst wirklich tot,
wenn niemand mehr an ihn denkt.
>Bertolt Brecht
My head’s gonna blow brains all over the floor
Pressure like I never felt it before
It’s like a drug I never did before
Joey Ramone
Prolog
Zusammen. Endlich. Sie halten Händchen. Alle drei. Sie ist in der Mitte. Dort, wo sie hingehört. So voller Kraft und Willen, so unglaublich glücklich. Energisch geht sie los, zieht die beiden mit sich. Er ist links von ihr, der andere hält ihre rechte Hand. Endlich sind sie zusammen. Die vielen Gefühle machen sie ein bisschen schwindlig. Sie weint. Aber nicht, weil sie so bewegt ist, sondern wegen des Tränengases. Das ist die Prüfung ihres Glücks. Luft anhalten und durch. Die Augen brennen. Sie bekommt nun doch Angst. Ein Messer aus Gas sticht ihr in die Lunge. Keine Luft, in der engen Brust kein Atem mehr. Husten, würgen. Dabei wollen sie nur etwas für eine lebenswerte Zukunft tun. Sie drei zusammen. Sie werden die Zufahrt zum Baugelände des geplanten Atomkraftwerks besetzen. Zusammen mit vielen anderen Gleichgesinnten. Zehntausenden.
Da vorne jedoch, auf der Straße zur Baustelle, hat die Polizei eine Kette gebildet, eine Absperrung hingebaut. Gesichts- und seelenlose Roboter. Schilde, Helme, Gasmasken. Bedrohliche Außerirdische. Sturmtruppen. Aus Megafonen scheppern Befehle: »Gehen Sie nicht weiter! Sie machen sich strafbar! Dies ist Privatgelände!«
Es knallt wieder. Dumpfes Sausen. Weiße Wolken, die sich plötzlich in der grünblauen Landschaft bilden. Tränengas. Der weiße Nebel wunderbar. Schneidet in die Augen. Panik. Sie sieht, wie vor ihr ein Demonstrant einen Stein aufhebt und in Richtung Polizei wirft. Sie möchte das auch tun, sie hat dieselbe Wut in sich. Die Gasschwaden hindern sie, halten sie auf. Sie spürt dankbar, wie ihre Begleiter ihre Hand drücken. Sie bleiben stehen. Ratlos. Tatenlos.
Aus Megafonen scheppern die Befehle der Anführer: »Zusammenbleiben. Nicht provozieren lassen. Keine Gewalt! Langsam zurückweichen. Unser Widerstand bleibt gewaltfrei. Keine Panik!«
Auf dem Rückzug, auf der Flucht. Nur weg da! Immer wieder laufen sie in die Gaswolken hinein. Über ihren Köpfen zischen die Petarden dahin. Diese verdammten Arschlöcher sollen endlich damit aufhören, denkt sie, wir gehen ja schon. Wir haben es versucht, aber es hat nicht geklappt, und jetzt gehen wir wieder heim. Hört auf! Genug Gas, genug Macht! Glücklich bin ich trotz alledem!
»Achtung, da vorne sind Bahngleise!« Es spricht sich schnell unter den flüchtenden Demonstranten herum. Man sieht so gut wie nichts. Wieder ziehen trübweiße Schwaden heran. Sie stehen vor einem Hügel, nein, keine natürliche Erhebung, das muss der Bahndamm sein. Wo geht es hier weiter?
»Nicht auf die Gleise gehen. Vorsicht!«, scheppert es aus einem Megafon.
Sie bleibt automatisch stehen, dann wird sie hochgezogen, über zertrampeltes Gras. Da ist Stein, ein Betonsockel. Vielleicht der Bahnsteig. Stopp. Schweratmend hält sie an, eine Hand liebkost ihren Hinterkopf. Sie kann nicht sagen, wer von den beiden das tut. Sie bleibt einfach stehen. Von hinten drängen andere. Links und rechts hasten Schemen vorbei. Sie kriegt einen Stoß in den Rücken, stolpert. Stopp! Sie weiß nicht, ob sie das geschrien hat oder einer der beiden. Sie steht wieder fest auf dem Betonboden. Sie sieht nichts. Da ist wieder ein sausendes Geräusch. Diesmal keine Gaspetarde. Das Geräusch wird lauter. Schrecklich laut. Der Schnellzug? Plötzlich bemerkt sie, dass sie die Hände frei hat.
Wo sind die beiden hin? Angst überflutet sie wie eine große Welle. Ein metallisches Kreischen. Der Schnellzug bremst. Sie schlägt die Hände vor das Gesicht. Schreie. Er ist plötzlich da und umarmt sie. Wenigstens er ist da. Sie lässt sich von ihm ein paar Stufen hinunterführen, weg vom Lärm, vom Tränengas, weg, nur weg.
Er hält ihre linke Hand ganz fest. Ihr rechter Arm. Niemand da, diese Hand zu halten. Es kommt ihr so vor, als ob ihr der rechte Arm amputiert worden wäre. Phantomschmerz. Der andere fehlt. Der andere ist verschwunden.
1. Kapitel
Melchior Fischer hat keine besonders gute Laune. Er blättert in den gelbstichigen Seiten einer schlampig gehefteten Broschüre. Die Texte sind mit einer Schreibmaschine getippt, bei der ab und zu ein Buchstabe aus der Reihe tanzt. Das Heft hat Fischer in seiner Bibliothek gefunden. Es ist eine Kampfschrift aus der Mitte der Siebzigerjahre, altes, totes Papier. Der Widerstand gegen die Atomkraftwerke in Deutschland und der Schweiz wird zum letzten Gefecht gegen den Kapitalismus heraufbeschworen.
Der Kampf gegen die AKWs hat in Europa jene breite Öffentlichkeit und Infragestellung der kapitalistischen Wirklichkeit ansatzweise wieder geschaffen. In der Anti-AKW-Bewegung ist wieder ein Forum entstanden, in der sich massenhaft die Verweigerung gegenüber der Selbstverständlichkeit und scheinbaren Unersetzbarkeit des kapitalistischen Systems ausdrücken kann.
Fischer gähnt ausgiebig. Was er da liest, gefällt ihm nicht. Es ödet ihn an. Das ist verdammter Politjargon aus dem letzten Jahrhundert. Theorie. Das sind verlorene Illusionen. Verkokelte Traumreste. So haben die sich das vorgestellt, die Politischen damals, vom Widerstand gegen das Atomkraftwerk direkt hinein in die soziale Revolution. Dass die Bauern, die Häuslebesitzer, die jungen Lehrerehepaare mit kleinen Kindern, die rund um die radioaktiven Drecksschleudern leben mussten, nun sofort in die Revolutionäre Marxistische Liga eintreten und den Kapitalismus zum Teufel schicken würden. Fischer nimmt die Brille ab und kratzt sich hinter dem Ohr. Er hat das ja ebenfalls geglaubt als junger Mensch. Wie alt war er damals? Achtzehn, neunzehn? Er war davon überzeugt, dass ein Umbruch kommen muss, dass sich das Volk vereint gegen die alten Mächte stellt. Dass diese Ungeheuerlichkeit, die Gefahr der Atomkraft, auch noch den Hinterletzten aufrütteln und ihm die Brutalität und die Menschenverachtung des Kapitalismus zeigen würde. Dass dann von einer neuen Aufklärung endlich das Reich der Vernunft installiert und sowieso alles besser würde. Aber wie die Gegenwart zeigt, haben sich nicht nur Fischer, sondern auch andere, wesentlich renommiertere Geistesheroen diesbezüglich geirrt.
Fischer kratzt sich hinter dem anderen Ohr. Damals waren solche totalisierenden Texte wie der aus der Anti-Atombroschüre für ihn eine Offenbarung, jetzt geht ihm dieses Zeug ziemlich zäh hinunter. Keine Leidenschaft, keine Abenteuergeschichten, keine Love-Storys im Schatten des Kühlturms, keine Action, alles bloß blutleeres Räsonieren, ein armseliges Menü aus politischem Trockenfutter.
Einen dieser ellenlangen Artikel gegen die Atomlobby hat Fischers Bruder Balz geschrieben. Der stand damals an führender Position in der Bewegung gegen die Atomkraftwerke in der Schweiz. Jetzt, fast 40 Jahre später, nach dem Schock von Fukushima, soll Melchior Fischer etwas Schriftliches über diesen Widerstand abliefern. Selbstverständlich nicht unverdauliches Zeug über politische Ökologie, sondern richtige Geschichten mit Schmiss, mit Emotionen. Schuld an allem ist Eduard Mendota, ein alter Freund von Fischer, einer aus der grauen Vorzeit, den verwunschenen Tagen, aus der Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. Einer immerhin, der auch heute noch an Fischer denkt. Vor zwei Tagen hatte er hier angerufen.
»Um Himmels willen, Mann, hängst du wieder in diesem verdammten Vorort herum, bei den alten Leuten und den jungen Lehrerfamilien? Schämst du dich nicht? Ich versuche dich schon den ganzen Tag zu erreichen. Hast du dein Handy verloren? Was machst du bloß immer in dieser grünen Hölle?«
Fischer hütet während der Osterferien das Häuschen im nördlichen Vorort von Basel, am Almagellweg, wo seine Exfrau Katharina und die Kinder Rebecca und Tim mittlerweile leben. Er hatte etwas pikiert geantwortet, dass er eben nicht so ein urbaner Teufel sei und gerne Zeit am Stadtrand von Basel im Grünen und in der Ruhe verbringe. Außerdem fahre er dabei mit dem Fahrrad herum, betreibe Sport und baue dabei überschüssige Fettpolster ab. Und tatsächlich habe er sein Mobiltelefon in der Stadtwohnung liegen lassen. Absichtlich!
Mendota hatte nur gekichert. Er nennt sich Kulturmanager, ist stets in Schwarz gekleidet und lebt mehr von einer anständigen Erbschaft als von seiner eigenen Hände Arbeit. Er hat gut lachen. Er neigt nicht zur Korpulenz. Er ist klein und sehnig. Hat möglicherweise einen Knacks wegen seiner fehlenden Körpergröße, schleppt dennoch jede Menge hübscher Frauen ab, zu Wellnesswochenenden nach Baden oder sogar Baden-Baden. Vielleicht fördert aber auch das nicht unbeträchtliche Familienvermögen, von dem Mendota zehrt, seine Attraktivität.
Fischer stellen sich als geistigem Hilfsarbeiter bedeutend größere Probleme mit der Finanzierung seines Lebens. Vor Urzeiten hat er einen Roman veröffentlicht, doch Nachruhm war ihm nicht beschieden. Nun publiziert er höchstens noch in Wartezimmerzeitschriften, schreibt dort schlecht bezahlte Kolumnen über Themen wie Schamhaarrasur und Solariumsucht. Lauter Zeug, das Fischer die Schamhaaresröte ins Gesicht treibt. Ab und zu schanzt ihm der gut in der offiziellen und privaten Kulturförderung vernetzte Mendota einen einigermaßen rentablen Auftrag zu. Der umtriebige und stets adrenalingesättigte Kulturmanager hat einige Verdienste als literarischer Anreißer und Vermittler in Basel, ist der ebenso behäbigen wie ausgabenscheuen Kulturbürokratie dieser Stadt wohl zu nervös und zu unberechenbar. Der Literaturbetrieb wird hier gepflegt wie ein Kranker, der sein Spitalbett möglichst nicht verlassen soll, solange die Krankenkasse noch zahlt. Da sind Aufregung und Umtriebe selbstverständlich nicht so gut.
Mendota hatte angerufen, als Fischer gerade damit fertig war, im Vorortshäuschen die Katze zu füttern und die Zimmerpflanzen zu gießen. Das Telefon hatte ihn aus einer kleinen Meditation mit Blick auf die grüne Hölle gerissen.
»Also, was ist denn so dringlich, dass du mich in meinem Refugium stören musst?« Fischer war völlig klar gewesen, dass der Anruf seines Freundes wie immer Abwechslung, aber auch Unruhe in sein Leben bringen würde.
»Ha, ha, Refugium ist gut. Exil träfe es besser. Du versteckst dich doch bloß vor der abscheulichen Wirklichkeit, Fischer, gib es zu. Egal. Ich rufe wegen eines kleinen Auftrags an, keine große Sache, aber wahrscheinlich ein guter Job. Du weißt ja, Fischer, die Katastrophe in Japan im Atomkraftwerk, Fukuirgendwas, Super-GAU, Kernschmelze, Angst und Schrecken. Endlich mal wieder eine richtige Krise mit der Atomenergie! Das hat auch hierzulande mächtig aufs Gewissen gedrückt und die Erinnerung aufgefrischt. Kurzum, das Kunsthaus in Aarau macht demnächst eine Ausstellung über Kunst und Atomkraft oder vielmehr Kunst gegen das Atomkraftwerk. Oder so ähnlich. Mir ist nicht so ganz klar, wie die das kunsthistorisch verbraten, aber es geht um hehre Dinge: widerständische Kultur, Verantwortung des Künstlers gegenüber seiner Umwelt und so weiter. Jedenfalls ist ein opulenter Katalog für diese Ausstellung im Entstehen, und es gibt Bedarf an ästhetischen wie auch politischen Beiträgen. Und originell muss es sein, vielleicht sogar sehr persönlich. So etwas kannst du schreiben, oder?«
Fischer war zusammengezuckt und hatte aufgestöhnt. Sein Blick hatte sich von der grünen zu seiner inneren Hölle gewandt. Ausgerechnet Aarau, seine Heimatstadt! Dort in der Nähe war vor über 30 Jahren ein solches Atomkraftwerk in Betrieb genommen worden. In Gösge stoht en AKW und wär’s nid glaubt, chas sälber gseh. Die ganze Region hatte damals getobt. Pro und kontra. Es wurde schlussendlich zu Fischers politischer Feuertaufe. Erstmals hatte er sich offen gegen seinen Vater und die anderen Autoritäten gestellt und Seite an Seite mit seinen Brüdern gegen dieses AKW gekämpft. Er hatte es zumindest versucht, damals, bei diesem völlig untauglichen Versuch, die Straße zum Baugelände des Atomkraftwerks zu besetzen. Da hatte er gestanden, bangen Gemüts und doch beschwingt, entschlossen und doch auf dem Sprung, und hatte zugesehen, wie die Staatsmacht mit einem beispiellosen Polizeieinsatz und viel Tränengas auf ihn und seinesgleichen losging. Auf ihn und all die anderen Menschen, die wirklich nur das Beste wollten. Damals war ihm vieles klar geworden.
Gleichzeitig hatte sich Fischer an den tragischen Unfall damals im Bahnhof Däniken erinnert, bei dem ein Demonstrant unter den Schnellzug von Zürich nach Bern geraten und gestorben war. So lange her, das alles schon. Das lag begraben, tief unter den Gesteinsschichten der Zeit. Er hatte noch einmal aufgestöhnt, sodass Mendota es hören musste. Der war ganz locker geblieben und hatte noch ein bisschen über die hiesige Literaturszene gelästert und dann gefragt, ob Fischer denn länger im Vorort verweile, falls es textlich noch etwas zu besprechen gebe.
Er werde sicherlich hier übernachten, hier sei es ruhig und gemütlich, er schlafe eingelullt im Rauschen des ewigen Regens, hatte Fischer geantwortet. Denn seit Tagen waren die Schleusen des Himmels weit offen und es goss in Strömen aufs weite Erdenrund, zumindest auf Basel und Umgebung. Diesmal hatte Mendota aufgestöhnt, sich dann aber anständig verabschiedet und die Verbindung unterbrochen.
Fischer kratzt sich schon wieder hinter dem Ohr. Es ist ganz klar, er braucht das Geld und wird also einen Text für das Kunsthaus Aarau schreiben. Deshalb liest er in diesen alten Schriften, die er in seinem Fundus entdeckt hat. Viel ist es nicht, aber es reicht vorderhand aus, um sich ein bisschen zu orientieren. Doch Fischers Gedanken sind nicht wirklich bei der Sache. Sein Denken umkreist Reisschleim, Möhrenbrühe, stilles Wasser, Trinkmolke, Hefeflocken. Das sind die Sachen, die jetzt gerade seine Nahrung sein dürfen. Melchior Fischer fastet und dieses Zeug darf er sich einverleiben, ohne dabei sein leichthin gegebenes Gelübde zu brechen. Was für ein Wahnsinn für ihn, der sich den leiblichen Genüssen in letzter Zeit so hingegeben hat. Gut, er hat schon zwei, drei Kilo abgenommen in den letzten beiden Tagen, aber er fühlt sich wie der nasse Wischlappen, der vor dem Fenster im Dauerregen hängt. Fischer hat Hunger, in ihm brodelt es wölfisch. Außerdem fallen ihm nach kurzer Zeit die Augen zu, beim Fernsehen, beim Lesen, beim Sinnieren. Er weiß nicht, ob das vom Fasten kommt oder ob er einfach einer grundlegenden Jahrhundertmüdigkeit verfallen ist, einem Sehnen und Streben in sich, alles zu verschlafen, traumgrunzend in Morpheus’ Armen zu liegen, bis die Verhältnisse sich wieder gebessert haben. Durchschlafen, alles überschlafen, diese ganze unerträgliche Unübersichtlichkeit namens Welt.
Möglicherweise sind auch die Tabletten gegen seinen Heuschnupfen schuld an der Müdigkeit. Die frühen Fruchtstände von Haselstrauch und Birke sind pures Gift für Fischer. Sobald der Frühling mit seinem blauen Band winkt, überkommt ihn die Seuche. Im April, dem grausamsten Monat, läuft seine Nase, die Atmung rasselt, die Schleimhäute sind trocken und jucken. Rettung liegt nur in der Chemie. Augentropfen, Nasenspray und ein kleines Dragee jeden Tag, das laut Packungsbeilage neben der Müdigkeit ebenso gewisse Sehstörungen verursachen kann. Sei’s drum, ein blinder Fischer sieht das ganze Weltelend wenigstens nicht mehr.
Er schüttelt nachdenklich das weiße Plastikfläschchen und schaut sich das Etikett genau an. Trinkmolke, besonders fein. Um Himmels willen! Warum hat er sich nur von Katharina zu dieser Kasteiung überreden lassen? Seit sie seine Exfrau ist, seit sie feierlich und beurkundet geschieden sind, kommunizieren sie fast normal über Alltägliches wie den gegenseitigen Stand der Gesundheit. Sie können auch wieder über die Dinge reden, die sie noch gemeinsam betreffen. Über die beiden Kinder und ihre Entwicklung. Über die Schule. Über die Aufgabenverteilung, was den Nachwuchs betrifft, etwa die Übernahme von Transporten oder die Besuche von Schulaufführungen und Sportveranstaltungen. Rebecca spielt Volleyball und Tim Gitarre. Katharina und die Kinder befinden sich südlich von Neapel, in der Frühlingssonne, während hier in der Aprilnässe das Leben verschimmelt. Seit Tagen hängt eine dichte Wolkendecke über Stadt und Land und lädt seine feuchte Fracht ab. Fischer geht ans Küchenfenster. Falsch leuchtet der echte Schneeball mit seinen weißen Scheinblüten vom Gartenrand in den trüben Mittag. Das aufdringliche Gelb des Goldglöckchens, der Forsythie, vergeht schon langsam.
Fischer erblickt eine der alten Damen aus dem Mietshaus nebenan, die ihren wohlgefüllten Hackenporsche hinter sich herzieht. Es scheint gerade kein Regen zu fallen. Die Seniorin kommt, dem sorgsam gewellten Haar nach, aus dem Coiffeursalon. Es sieht so aus, als ob die Frau eine getigerte Katze auf dem Kopf trägt. Oder einen Waschbären. Sie schreitet zügig aus und biegt dann ab zu ihrem Wohnblock. Plötzlich hält sie an und schaut in seine Richtung. Es ist ihm, als ob die alte Frau sorgenvolle Blicke auf den reichlich ungepflegten Garten wirft, in dessen Mitte das Häuschen steht und in dem der todesmüde Fischer vor sich hinleidet.
Alte Hexe, kümmere dich um deine eigene Frisur, denkt er und stellt die extrafeine Trinkmolke weg. Er wartet, dass ein Tier vom Kopf der Seniorin springt, bevor sie in den Wohnblock tritt. Nichts dergleichen geschieht. Als Fischer sich vom Fenster wegdreht, erklingt auf einmal ein sonores Rauschen. Regen. Es rieselt und schüttet schon wieder. Aprilwetter, Wasser stürzt herab, uns zu verschlingen. Niederschlag beherrscht das Welttheater. Draußen schütteln sich Schneeball und Goldglöckchen vor Ekel, als die nassen Tropfen auf sie einschlagen.
2. Kapitel
Aarau, die Provinzmetropole, ist ein wohlanständiges Städtchen, eine original Schweizerische Wertarbeit von Kantonshauptstadt. Einst sogar, zu napoleonischen Zeiten, von März bis September 1798, im ersten Jahr der Helvetischen Republik, war Aarau die Hauptstadt der Schweiz, wovon noch eine Prachtstraße, eine Avenue hin zum historischen Zentrum namens Laurenzenvorstadt zeugt. Heute summt und brummt die Stadt vor Geschäftigkeit. Es gibt hier vorzügliche Arbeitsplätze in der Aufzucht und der Verwaltung der Menschen durch die Menschen, in der Vermittlung von Bildung und Gesundheit, auf allen relevanten Gebieten des tertiären Sektors. Die Stadt mit knapp 20.000 Einwohnern hat einen Fußballklub, der in einem maroden, doch charmanten kleinen Stadion spielt und bei seinen Anhängern stets ein anregendes Herzflattern hervorruft, da er zumeist gegen den Abstieg aus der obersten Schweizer Spielklasse kämpfen muss.
Ansonsten spielt hier das Standortmarketing eine wichtige Rolle. Auch in diesem Städtchen hängt man dem Glauben an, dass eine Kunstszene für Identität, Emotion und sexy Lebensqualität sorgt, weshalb die Hauptstadt des sogenannten Kulturkantons sogar ein Kulturkonzept ihr Eigen nennt. Im Normalfall sind die meisten Kulturschaffenden zügig nach Zürich oder Basel, Berlin oder New York verschwunden. Das Kulturfördergeld aus der alten Heimat jedoch wird immer noch gerne genommen.
Doch auch das manuelle Schaffen war in Aarau ehedem vorhanden, die Produktivkräfte tobten sich aus. In bester Lage am Rande des historischen Zentrums entstand 1819 eine später weltbekannte Feinmechanikfabrik, in der einst Fischers Vater angestellt war. Lustig klapperten die Räder am Stadtbach und produzierten die nötige Energie. Die Landflüchtigen kamen zuhauf und verkauften ihre Produktivkraft. »Schweizer Qualität und Wertarbeit setzen sich immer durch«, so die Worte von Fischers Vater. Der war maßlos stolz auf die Produkte »seiner« Firma. Fischer war es egal, dass der Zirkel, den er im Schulunterricht bei fruchtlosen geometrischen Zeichenversuchen ruinierte, möglicherweise von seinem Vater zusammengebaut worden war.
Kurz vor seiner Pension war es dann um den Job von Vater Fischer geschehen. »Seine« Firma brauchte ihn ganz plötzlich nicht mehr. Bald darauf wurde die ehemalige Zirkelschmiede verkauft, der Standort Aarau schlussendlich dichtgemacht.
Melchior Fischer war da schon längst fort aus der Kantonshauptstadt. Sofort nach Ablegung der Reifeprüfung war er aus dem Elternhaus geflohen. Schon seine beiden älteren Brüder Kaspar und Balz hatten das unwirtliche Heim so schnell wie möglich verlassen. Bloß weg, rette sich wer kann! Vater Fischer war nach seiner Entlassung erkrankt. Die Erkenntnis, dass ihn überhaupt keiner mehr brauchte, setzte ihm zu. Er erkrankte schwer und verabschiedete sich bald von diesem Leben. Mutter Fischer blieb in Aarau, weil sich ihr ältester Sohn Kaspar mitsamt Familie mittlerweile dort angesiedelt hatte.
Fischer gähnt herzhaft, dann stößt er säuerlich auf. Nur nicht an die extrafeine Trinkmolke denken. Er hat sich mittlerweile durch das vorhandene Material der Anti-Atomkraft-Bewegung gelesen. Mit diesen Texten kann er nichts mehr anfangen. Er braucht intimere Informationen. Er wüsste schon, wer ihm die geben könnte. Sein Bruder. Balz, der mittlere Fischersohn. Aber der ist seit 25 Jahren tot. Ein Autounfall. Eine schreckliche Geschichte. Fischer fröstelt. Daran will er nicht denken. Das Klingeln des Telefons rettet ihn. Schon wieder Mendota.
»Fischer, ich habe mich gleich nach deiner Zusage mit dem Aarauer Kunsthaus und dem Herausgeber des Katalogs kurzgeschlossen. Man freut sich auf deinen profunden Artikel. Alter Freund, schaue in dich, erzähle uns, wie es damals war, als man verlacht und denunziert wurde als Kernkraftgegner. Erzähl etwas Persönliches, erzähl, wie du verunglimpft wurdest, als im Solde Moskaus stehender Lakai. Berichte von der Kriminalisierung der Bewegung gegen das schleichende Gift. Schreib dir die Seele aus dem Leib, Alter, erzähl den Nachfahren, wie du dich gefühlt hast – stigmatisiert als AKW-Gegner. 12.000 Zeichen mit Leerschlägen, als Gage habe ich einen Tausender rausgeholt. Geht das in Ordnung? Abgabetermin in, sagen wir mal, vier Wochen. Einen Vertrag vom Kunsthaus kriegst du noch. Und nun: Schreib!« Mendota atmet schwer am anderen Ende der Leitung. Dann fragt er noch einmal, ob Fischer wirklich im Vorort bleibe.
»Ja, das hab ich dir doch schon gesagt. Willst du mich vielleicht heute Abend zu einem Fünf-Gang-Menü in der Stadt einladen, weil eine deiner Hetären unpässlich ist? Erstens faste ich immer noch und zweitens habe ich diese Pollenallergie, da bleibe ich besser im Haus. Und ich fange hier auch gleich an zu schreiben, für diesen elenden Museumskatalog.«
Mendota schnaubt: »Habe ich das richtig verstanden, Genosse, du fastest? Du kasteist dich in vollem Bewusstsein, du baust Gewicht ab, um dich besser zu fühlen? Oder um flinker laufen zu können, wenn die alte Welt hinter dir her ist? Geht es dir gut dabei? Bist du dir ganz sicher in deinem Bemühen? Das ist im höchsten Maße unmenschlich.«
Fischer versucht, optimistisch zu klingen. Fasten sei prima, das alte Kampfgewicht habe er bald erreicht. Man fühle sich leicht und zu allem bereit. Mendota schnaubt noch einmal und unterbricht abrupt das Telefongespräch.
Fischers Optimismus bricht in sich zusammen. Verdammtes Fasten. Und dann noch Schreiben. Viel, viel einfacher gesagt als getan. Sein Kopf ist leer. Seine Augen sind entzündet. Seine Nase läuft. Sein Magen knurrt. Diese Körpermaschine läuft überhaupt nicht rund, und das hat Auswirkungen auf den Geist. Aber die tausend Franken stehen im Raum. Die braucht Fischer. Was soll er nur schreiben von der Anti-AKW-Bewegung, über diese längst vergangene Zeit? Jetzt ist das wieder auf die politische Agenda gekommen. Die unsichtbare Gefahr. Radioaktive Strahlung. Doch, und da ist sich Fischer bombensicher, nach kurzer Zeit werden sich diese Ängste wieder verlieren und man wird einfach weitermachen. Und auf den nächsten Knall warten.
Sein Bruder fällt ihm wieder ein. Balz. Der steckte damals bis über beide Ohren in der Geschichte. Da müssten wahrlich noch Sachen vorhanden sein, in seinem Nachlass. Der ist in Aarau, unter dem Dach, im Haus seines ältesten Bruders Kaspar, in dem auch die Mutter wohnt. Aber will er, Fischer, überhaupt in diese Vergangenheit eintauchen, zumal es eine unangenehme, verminte Geschichte ist? Er hat Angst vor ihr. Da sind schwarze Löcher. Hohlräume und Verdrängtes. Fischer kann nicht auf seine Vergangenheit bauen. Doch vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, diese Leichen im Keller endgültig zu beerdigen. Vielleicht ist die Zeit gekommen, sich gewissen früheren Ereignissen zu stellen. Auf nach Aarau! Dabei könnte man ja etwas in alten Wunden wühlen oder sonstige Dummheiten begehen. Dann kann er auch ins nur sieben Kilometer entfernte Gösgen fahren, wo das Atomkraftwerk fröhlich vor sich hindampft, um sich vor Ort inspirieren zu lassen. Überhaupt, wann hat er zum letzten Mal seine Mutter oder seinen Bruder Kaspar gesehen? Wie lange ist das her? Leben die überhaupt noch? Immer nur kümmert Fischer sich um sich selbst. Immer nur ist er der arme Hund. All sein Mitgefühl konzentriert sich immer nur auf sich. Auf diese lausige Figur, die er abgibt in diesem irdischen Jammertal. Sein Sohn Tim hatte letztes Jahr eine der Pubertät geschuldete religiöse Phase, dabei hat sich Fischer etwas um den Glauben gekümmert. Sie sind schon verlockend, diese Anlegestellen im ungewissen Lebensmeer, diese Pfähle und Pfosten zur Orientierung in der Unüberschaubarkeit. Es ist dieses Gewisse in der Religion, der feste Glauben an sich, der so attraktiv ist. Glauben kann man immer. Ohne Voraussetzungen, ohne Stress. Der Glaube betoniert all die Löcher der Ungewissheit und der Schuld in einem aus. Der Glaube imprägniert die verletzliche Seelenhaut.
Tims Glaube war dann allerdings relativ zügig wieder vergangen, weil der ihm zugeteilte Seelsorger ein ausgesprochener Rockmusikhasser war, und Tim damals gerade fanatisch Gitarre geübt hatte, um auf diesem Instrument noch besser und berühmter zu werden als all jene Saitenheroen aus der Schallplattensammlung seines Vaters. Fischer war froh über den Pragmatismus seines Sohnes. Aber sonst, alle Achtung, diese Religion, ein gottverdammt starkes Konzept, um ein bisschen Sinn in die Existenz hineinzuprügeln!
Wahrscheinlich ist er, Fischer, nun doch noch vor Hunger wahnsinnig geworden. Er muss Nahrung in das größte Loch in ihm, in seinen Magen, kriegen. Und wenn es Trinkmolke extra fein ist. Es schmeckt entsetzlich, Fischer wird schlecht. Er reißt das Küchenfenster auf. Feiner Regen spritzt herein und benetzt sein Gesicht. Das beruhigt ihn wieder. Er stellt die fatale Flasche mit der Molke in den Kühlschrank. Dieses Fasten hat allerdings nebenbei einen gewaltigen Vorteil: Man braucht fast kein Geld mehr. Keinen teuren Alkohol, kein luxuriöses Fleisch, keine speziellen Brotwaren und keine kostspieligen Obstsäuren werden benötigt. Fasten füttert das Portemonnaie.
Fischer holt sein Notebook und setzt sich an den Küchentisch. Schmal und silbern liegt das Ding vor ihm. Er klappt den Computer nicht auf und greift sich stattdessen einen Schreibblock. Wohlan, er muss zurück in die Vergangenheit. Tempi passati, Geschichte. Die hat er einmal studiert. Das ist auch so ein schwarzer Fleck in seiner Historie. Dass er das nicht durchgehalten und schließlich abgebrochen hat. Warum um Himmels willen hat er denn bei dem bisschen Studium schlapp gemacht? Es hat ihn immer interessiert, vor allem dieses frühe Geschehen, von dem es keine so klaren Zeugnisse gibt. Er hat sich letzthin in der Universitätsbibliothek ein paar Bücher über die Völkerwanderung ausgeliehen. Hunnen, Goten, Awaren, Vandalen, Langobarden. Das Thema fasziniert ihn immer noch. Ganze Völker, die auf der Suche nach einem besseren Leben in Asien und Europa herumziehen, die meist vom Osten her gen Süden wandern. Migration. Ein uraltes Thema. Die Angst vor dem Fremden sowieso. Fischer überlegt in letzter Zeit öfters, ob er nicht im reifen Alter seine Studien der Ur- und Frühgeschichte an der hiesigen Universität wieder aufnehmen sollte. Um dieses geheimnisvolle Geschehen in Europa vom vierten bis zum sechsten Jahrhundert zu untersuchen. Nur schon die Namen dieser reiselustigen Stämme faszinieren ihn, und wie prächtig fremdartig ihre Anführer heißen: der Vandale Geiserich, der Westgote Alarich, der Alamanne Chnodomar oder der Langobarde Alboin, den Hunnen Attila nicht zu vergessen. Diese Wanderungsbewegung ganzer Völker zu erfassen, vielleicht zu verstehen und dabei eine atemberaubende Entdeckung zu machen, das stellt sich Fischer als wunderbar vor. Er ist immer noch fit genug, Neues zu speichern. Glaubt er jedenfalls. Auch wenn dieses Maschinchen da oben in seinem Kopf wegen all der körperlichen Entschlackung und Enthaltsamkeit schon etwas stottert.
In schöne Gedanken gehüllt, sieht Fischer durch das Küchenfenster, wie ein Renault älteren Baujahrs langsam durch den Almagellweg rollt, eine gräuliche Abgaswolke hinter sich herziehend. Diesel, denkt Fischer verträumt, direkt aus dem Heizölkeller getankt. Das Innere der angerosteten Karre füllen vier Herren gut aus. Fischer braucht keinen zweiten Blick. Hier handelt es sich um die neue Völkerwanderung. Migration. Armutsdruck. Die Armen suchen die Heimstätten der Reichen auf. Dieses Auto voller zwielichtiger Herren ist ein Besuch jenseits der nahen Grenze, der lohnende Ziele für Einbrüche in der Schweiz ausbaldowert. Fischer sieht das fremdländische Kennzeichen, merkt es sich aber nicht. Wieso auch? Er steht auf Seiten der Besitzlosen. Vielleicht sind die vier Autoinsassen eine neue Bande à Bonnot und damit die Nachfolger jener anarchistischen Räuberbande um Raymond Callemin, genannt »La Science«, und Jules Bonnot, die um 1911 herum in Frankreich und Belgien Raubüberfälle beging, bei denen sie ganz clever Automobile benutzten. Die Polizei hatte damals noch keine.
Die Expropriation der Expropriateure ist für Fischer immer noch eine Forderung mit Sex-Appeal. Doch der angerostete Renault mit den vier vermeintlichen Ganoven fährt so langsam und stößt dabei eine so fiese Abgaswolke aus, dass er Aufsehen erregt. Das ist selbstverständlich nicht die richtige Annäherung ans Objekt der Begierde. Hier in diesem Sträßchen haben die Gardinen Augen, hier brechen aus jedem Sonnenstore misstrauische Blicke hervor. Fischer weiß das, hat es selbst erlebt. Fremde in Sicht! Von denen kommt nichts Gutes! Alles Verbrecher! Dann klacken Schlösser und rattern Rollos in den Häusern des Vororts. So zieht auch der Renault anscheinend unverrichteter Dinge, aber mit einer atompilzförmigen Rauchwolke aus dem Auspuff wieder ab.
Plötzlich hört Fischer ein Keifen. Er öffnet vorsichtig das Fenster. Gleich spritzt wieder Regen herein. Eine hohe, alte Stimme schimpft, wahrscheinlich dem wegfahrenden Auto nach. Es stinkt nach verbranntem Kraftstoff. Fischers Nase ist unglaublich sensibel geworden durch das Fasten. Es liegt allerhand in der Luft. Durch die Benzinwolke riecht Fischer aber auch Gesottenes, Gebratenes. Plötzlich hat er einen unmenschlichen Hunger. Sein Magen beginnt zu rumoren. Er schließt das Fenster vor dem Regen und atmet tief durch. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Nichts Orales aufkommen lassen. Das bringt nichts. Fischer geht entmutigt in die Küche, zum beunruhigend vor sich hin brummenden Kühlschrank. Er öffnet ihn nur aus lauter Gewohnheit. Drin ist nicht viel. Die vermaledeite Trinkmolke, extrafein, ein stilles Wasser, ein Rest Grüntee. Eine Substanz in einer Müslischale, die aussieht, als ob jeden Moment dort neues Leben entstünde. In diesem Kühlschrank sieht es genau so aus wie in Fischers Innerem. Er macht die Tür wieder zu und legt sich entmutigt aufs Sofa.
3. Kapitel
Therese Fischer, Mutter
Also ich darf jetzt einmal schnell die Familienverhältnisse der Fischers erklären. Vorweg werden Sie sich vielleicht fragen, wie man ein Kind Melchior taufen kann. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe mich damals nicht gegen diesen Namen gewehrt. Kaspar war unser Ältester. Zwei Jahre später, 1952, kam der Balz. Ich war noch jung. Der Dritte kam dann völlig unerwartet, 1958. Melchior, unser Nachzügler. Mein Mann hat mir Vorwürfe gemacht. Ich hätte nicht aufgepasst. Wieso ich? Warum hat er sich nicht zurückhalten können? Sonst hat er ja auch immer nur von Sicherheit, Vernunft, Kontrolle und so geredet. Aber es ist halt geschehen und da kam er, der Dritte. Melchior. Sie ahnen es. Die heiligen drei Könige. Mein Mann hatte plötzlich diese fixe Idee und war nicht davon abzubringen. Nicht, dass er religiös gewesen wäre. Er mochte die Kirche und die Pfaffen überhaupt nicht. Er mochte eigentlich keinen Menschen. Ich frage mich oft, wen er eigentlich gern gehabt hat. Sich selbst wohl auch nicht. Er fühlte sich zeit seines Lebens betrogen und hintergangen. Und jetzt noch drei Kinder, die seine jüngere Frau bedeutend mehr geliebt hat als ihren Ehemann. Ja, so wird’s wohl gewesen sein. Ich hab mich mit der Bedeutung von Melchior getröstet: König des Lichts. Kommt aus dem Hebräischen. Ich hab das mal nachgeschlagen. Mein kleiner König des Lichts. Melechor. Er war so ein liebes Baby. Immer schön geschlafen, viel geschlafen, zufrieden gelächelt, keine Schreianfälle wie der Balz. Ach je, der arme Balz.