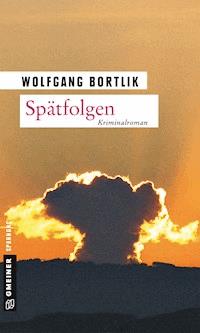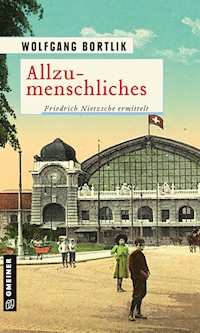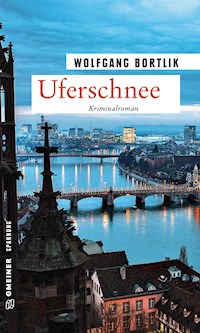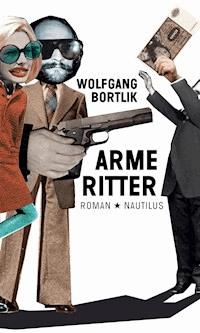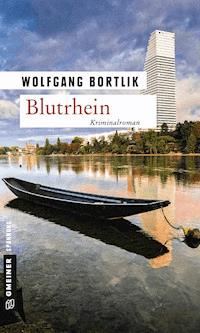Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hobbydetektiv Melchior Fischer
- Sprache: Deutsch
Drei Tote in der Basler Fasnachtswoche, alle drei wurden nacheinander an einem idyllischen Weiher im Naherholungsgebiet gefunden. Die Kriminalpolizei ist überfordert. Geht ein Serienmörder um? Handelt es sich um Rache? Waren es Morde oder bloß Unfälle? Alles scheint möglich, nichts ist klar. Als sein Freund Bike-Werner als Verdächtiger einsitzt, mischt sich Hobbydetektiv Melchior Fischer ein, obwohl er lieber mit seiner Enkelin an die Fasnacht gegangen wäre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Bortlik
Die drei schönsten Toten von Basel
Kriminalroman
Zum Buch
Fasnacht und Totschlag Drei Tote in einer Woche, während der Basler Fasnacht – das ist rekordverdächtig. Tatort ist bei allen drei Fällen ein Grundwasserteich im Basler Naherholungsgebiet. Kommissär Norbert Britzig übernimmt die Ermittlungen. Zunächst bleibt unklar, ob es sich tatsächlich um Mord und Totschlag oder bloß um fatale Unfälle handelt. Auch einen Serienkiller muss Britzig in Betracht ziehen. Melchior Fischer, Detektiv wider Willen, ist unterdessen als Leih-Großvater an der Fasnacht, den „drei scheenschte Dääg“ von Basel, denn seine Tochter hat einen neuen Freund mit Kind. Doch als Fischers alter Freund Bike-Werner als Tatverdächtiger einsitzt, muss er sich zu ungeliebtem Aktivismus aufraffen. Zugleich bringt die chaotische Polizeiarbeit erste Erfolge. Und wie meistens ist Fischer wieder der Mann, der ins richtige Fettnäpfchen tritt.
Wolfgang Bortlik, geboren 1952 in München, lebt in der Nähe von Basel in der Schweiz. Nach einem endlosen Studium der Geschichte in München und Zürich war er Buchhändler, Musiker und Verleger, danach wurde er Vater von drei Kindern, war als Autor, Kritiker und Übersetzer tätig. Er schreibt Belletristik, allerhand populäre Gebrauchstexte und arbeitet gerade an einem großen Alterswerk und einem neuen Nietzsche-Krimi. Er hat elf Romane und Krimis, zwei Fußballgedichtbände sowie diverse CDs mit Wort und Musik veröffentlicht.
Impressum
Der Autor dankt RIEHEN Lebenskultur
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Christian Bieri / adobe stock
ISBN 978-3-7349-3242-7
Haftungsausschluss
Die Leserschaft ist angehalten, diese Geschichte nicht ernster zu nehmen, als der Autor es beabsichtigt hat.
Personen und Handlung sind frei erfunden und Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und keineswegs gewollt.
Widmung
Für Felice Edie Ruth
Zitate
Wir Menschen verstehen einander nicht. Zwischendurch läuft so eine Art Leben ab. Mit den Blähungen von Gemeinsamem und Ineinanderverwachsensein. Schon das Kind sühlt sich im Pferche. Dann lernt man gehen und klettern, dann wird der Einzelne etwas größenwahnsinnig, er befiehlt, er ordnet, er säet, er beschreibt mit der Hand einen Bogen, als wolle er die ganze Welt umfangen – dazwischen explodiert Gehemmtes, Revolution flammt auf, Empörung und vorwärtszustürmen für die neue Welt, die Menschengemeinschaft, die Wahrheit – wo alles nur Schwindel ist. Schwindel von Anbeginn.
Franz Jung »Das Erbe«
The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far. The sciences, each straining in its own direction, have hitherto harmed us little; but some day the piecing together of dissociated knowledges will open up such terrifying vistas of reality, and of our frightful position therein, that we shall either go mad from the revelation or flee from the deadly light into the peace and safety of a new dark age.
Howard Phillips Lovecraft »The Call of Cthulhu«
Die Handelnden
Melchior Fischer, Detektiv wider Willen, ist neuerdings in Antonia verliebt und lernt über die Beziehung seiner Tochter Rebecca die Freuden des Großvaterseins mit der kleinen Ivy kennen.
Werner Egli alias Bike-Werner, Fischers alter Freund und Genosse aus den wilden 1980er-Jahren. Wird an der Fasnacht verhaftet.
Waldemar Oertli junior, genannt Walt, Sohn aus gutem Hause in Riehen bei Basel, eine rätselhafte Persönlichkeit, der alles zuzutrauen ist.
Henry Kornfeld ist mit Oertli Mitglied in anrüchigen Organisationen, träumt davon, König der Schweiz zu werden.
Kommissär Norbert Britzig, Nachfolger von Franz Gsöllpointner bei der Basler Kripo. Hat einen fatalen Hang zu hellbraunen Lederjacken und endlich einen vernünftigen Kaffeeautomaten in der Abteilung.
Mirjana Rosolic und Kilian Buff, Untergebene von Britzig und sehr vife Mitarbeiter.
Franz Gsöllpointner, Ex-Kommissär, nunmehr Besitzer der Detektei »Prevista«, frönt aber lieber dem Müßiggang und schimpft immer noch gern auf Bairisch.
Mathilde Kirchner, brave Bürgerin Riehens, die wie so viele andere leicht zu beeinflussen ist.
Norbert Rudolf Bohne-Quandt, älterer Herr aus Riehen, der an UFOs und vorzeitliche Monster aus dem Fundus von H. P. Lovecraft glaubt.
Ole Olsen, geheimnisvoller Kurier und Lieferant aus Paris, der im Riehener Ententeich ein Paket deponiert.
Mikkel Mikkelsen, mit Olsen im selben Geschäft, nebenbei Black-Metal-Musiker. Lernt das Grauen von Riehen kennen.
Glauber Rocha, Staatsanwalt in Basel-Stadt, keine sehr überzeugende Amtsperson.
Melinda oder Melli, eine kluge junge Frau, die sich nicht ins Bockshorn jagen lässt.
Prolog
Der Mann, der sich Ole Olsen nannte, hatte zuerst kurz üben müssen, wie man sich mit so einem vermaledeiten Drahtesel fortbewegte. Als Kind war er zum letzten Mal Fahrrad gefahren; lange her, mit einem klapprigen Vehikel, vielfach repariert. Bald war es zu klein für ihn gewesen, doch es hatte kein neues Fahrrad gegeben, seine Eltern hatten kein Geld dafür gehabt. Also hatte besagter Ole Olsen einfach ein schönes buntes Bike vom Schulhof geklaut. Damit begann sein zweites Leben, das ihn zu maßgeschneiderten schwarzen Anzügen, schnellen Autos, überstürzten Ortswechseln und zur Erkenntnis geführt hatte, dass Geld nicht alles, aber schon ziemlich viel war. Außerdem war Ole Olsen todkrank, er hatte Krebs, ein Mesotheliom am Bauchfell, das munter wuchs und Ableger streute, das spürte er nicht, wusste er nicht, und es spielt insgesamt auch keine Rolle für diese Geschichte.
Heute nun hatte er das Fahrrad, auf dem er zuerst noch herumwackelte, nicht gestohlen, sondern beim Schweizer Bahnhof in Basel gegen ein schmales Entgelt ausgeliehen. Eine prima Einrichtung, dachte Ole Olsen erfreut. Er hatte kein E-Bike gewollt, nein, ein ganz normales Herrenvelo, wie es hier hieß, reichte vollkommen. Ein bisschen Bewegung würde ihm guttun, hatte er gedacht und trat nun munter in die Pedale. Die erste Lieferung für den neuen Schweizer Kunden sollte in einem Naturschutzgebiet abgelegt werden. Ole Olsen hatte nur den Kopf geschüttelt. Was war denn das bitte? Jedoch, der Kunde war König und er nur ein dazwischengeschalteter Transporteur. Er kannte weder Lieferant noch Empfänger, und das war auch besser so. Beim Gewicht der Ladung hatte er sofort an Waffen denken müssen.
Grundsätzlich musste genau observiert und ausbaldowert werden, bevor eine Ladung deponiert werden konnte. War das an dem Ort, den der Empfänger der Ware bestimmte, logistisch möglich, dann kam das Geschäft zustande.
So hatte sich Ole Olsen als umsichtiger Transporteur die Sache mit dem Lager im Grünen erst mal auf Google Maps angeschaut. Ein Teich in einer Grünzone sollte das Depot sein. Genauer: unter einem Damm in diesem Teich. Etwa einen halben Kilometer entfernt vom nächsten Ort namens Riehen. Ein Teil der Zufahrtsstraßen war asphaltiert, dort waren nur Fahrräder und Fußgänger erlaubt. Die Gegebenheiten sahen gar nicht so schlecht aus, in der Gegend war wohl kein großes Hin und Her in der Nacht, wenn geliefert werden sollte. Schnell mit dem Auto hin, abladen, wieder weg, über die Grenze. Doch als seriöser Lieferdienst musste er sich das genauer ansehen, was da möglich und unmöglich war und ob es nicht Probleme geben könnte.
Ein gutes Viertelstündchen durch das idyllische Städtchen Basel und schon kam Ole Olsen am Rand dieser Grünzone mit dem Namen Landschaftspark Wiese an. Im Internet hatte er gelesen, dass dieses Gebiet im Volksmund die Langen Erlen hieß und ein Naherholungsziel für die städtische Bevölkerung war. Gegen Norden, auf dem Territorium der Gemeinde Riehen, lag ein Teich mit dem nicht allzu originellen Namen Entenweiher, an dem das Depot eingerichtet werden sollte.
Ole Olsen ging davon aus, dass an einem trüben, kühlen Februarsonntag wie diesem nur wenige Menschen an der frischen Luft spazieren gingen. Als er bei einer Trambahnhaltestelle namens Eglisee ankam, standen da Menschen en masse, mehr Männer als Frauen, auch Kinder, in Gruppen, Trupps und Rotten und, das sah Ole jetzt, sie hatten alle Instrumente dabei. Viele Trommeln und kleine Pfeifen oder Flöten. Er schüttelte den Kopf. Was war denn jetzt los? Als er auf dem Fahrradweg eine dahinmarschierende und musizierende Gruppe überholen wollte, ließ man ihn nicht vorbei. Er wurde unfreundlich angezischt, in einem Idiom, das er nicht verstand. Okay, schon gut, bog er halt an der nächsten Kreuzung unter hohen Bäumen ab. Weit kam er nicht.
Die nächste Gruppe, auf die er kurz darauf stieß, machte mit einem Haufen Blech und Pauken und Trompeten einen Höllenlärm. Ole Olsen erkannte den Song sofort: »The Lion Sleeps Tonight«. Er hatte durchaus Charme als Rumtata-Version, aber Olsen konnte trotzdem nicht an der Marching Band vorbeifahren – keine Chance. Langsam ging ihm das Ganze auf die Nerven. Hatten diese Leute die Vorfahrt gepachtet? Was wollten die eigentlich hier? Plötzlich öffnete sich eine Gasse in der Menschenmenge, als ob Moses das Rote Meer geteilt hätte. Drei, vier Fahrradfahrer, darunter Olsen, wurden freundlich durchgewunken und zogen so an der musikalischen Bande vorbei. Doch nur 30, 40 Meter weiter marschierte die nächste Anhäufung musikalischen Talents: »We Will Rock You« tschätterte es ins Unterholz. Wenn Olsen eine Rockband nicht mochte, dann war es Queen. Er bog wieder ab, verfuhr sich im Schatten der Bäume. Langsam wurde ihm kalt, und er fluchte in einer fremden Sprache ausgiebig vor sich hin.
Immer wieder traf er auf seinen Umwegen auf diese mehr oder weniger im Gleichschritt befindlichen Gruppen, die ihm vorkamen wie ein biblischer Volksstamm, der in die Wüste auszog, um das Heilige Land zu finden. Zuvorderst marschierten die Truppen, deren seltsame Musik in der Lage war, hohe Stadtmauern einstürzen zu lassen, und dahinter wandelten die Frauen und Kinder.
Schließlich gelangte Ole Olsen an das Flüsschen, das linker Hand schnurgerade in Richtung Stadt Basel dahinsauste. Das musste diese Wiese sein. Auch hier war die Hölle los. Auf dem anderen Ufer schien weniger Verkehr zu herrschen. Er warf einen Blick auf sein Handy. Das müsste gehen, über den Eisernen Steg, dann einfach bei der nächsten oder übernächsten Brücke wieder übers Wasser zurück und bald schon wäre er an seinem Ziel. Mittlerweile hatte ihn die vielstimmige Kakofonie in diesem Gehölz, das Tschättern des Blechs, das Rasseln der Trommeln, das hohe Pfeifen, in einen Rhythmus hineingezwungen, der ihn aufputschte und im Groove in die Pedale des Leihvelos treten ließ.
Auch an diesem Entenweiher, an dem er endlich ankam, standen Menschen, machten Lärm und freuten sich offensichtlich darüber. Dort war ein bisschen mehr Platz, Ole Olsen sah sich das kleine Gewässer an. Der Teich war sozusagen hinter Gittern, abgesperrt von der Straße, und bunten Schautafeln konnte man entnehmen, dass es sich dabei um Grundwasser für die lokale Wasserversorgung handelte. Da war schöne Wildnis um den Weiher, naturbelassene Ufer, von einem nicht so hohen Metallzaun von der Straße getrennt. Viel Gevögel war nicht auf dem Wasser. Weiter hinten standen graue Stelzvögel herum, Reiher wohl, im dunklen Teich schwamm ein einsames Blässhuhnpaar. Es war prinzipiell kein schlechter Platz, um Ware zu deponieren, wenn in der Gegend nicht immer so ein Publikumsverkehr wie jetzt gerade herrschte. Da waren der Damm, der den Teich teilte, und ein kleines rostiges Stauwehr. Weiter vorne träumte ein Steinhaufen vor sich hin bei einem Häuschen, in dem offensichtlich Material und Fahrzeuge lagerten, vielleicht ein kleiner Werkhof. Ole Olsen machte einige Dutzend Fotos.
Später gab er das Fahrrad wieder am Bahnhof ab. Er fragte den Mann hinter dem Glasschalter, warum gerade so viele Leute unterwegs seien und so einen Lärm machen würden.
Der Typ schaute ihn skeptisch an und schnaubte: »Guter Mann, Sie haben wohl keine Ahnung. In zwei Wochen ist Fasnacht. Das sind Cliquen und Guggenmusiken, die üben für die Umzüge.«
Auf den verständnislosen Blick seines Kunden hin stammelte der Veloverleiher ein paar englische Brocken: »Carnival. Music for Carnival, in two weeks, here in Bäisel. Carnival!«
Ole Olsen hob die linke Hand, um zu signalisieren, dass er verstanden hatte. Kurz darauf stieg er in den TGV nach Paris.
Erster Tag Fasnachtsmontag
1
»Blöde Funzel!«
Das Licht am Fahrrad flackerte. Fischer schimpfte leise vor sich hin. Dann erlosch der schmale Lichtstreifen, der immerhin einen Teil des Wegs vor ihm erleuchtet hatte. Er bremste, konnte sich nur knapp aufrecht halten und fluchte aus tiefster Seele. Er erschrak, wie laut seine Stimme durch die Stille schnitt.
Er trat versuchshalber gegen sein Vorderrad. Da war doch normalerweise irgend so eine Vorrichtung, die für das Licht am Fahrrad sorgte. Oder war das am Hinterrad montiert? Vielleicht konnte er es mit etwas Gewalt an seine Pflicht und Schuldigkeit erinnern. Er trat kräftiger zu und fuhr ein paar Meter, plötzlich war das Licht wieder da. Die Welt lag still um ihn herum. Für Februar war es viel zu mild, Fischer spürte bereits die Pollen der Haselkätzchen, die sich aufgemacht hatten, seine Schleimhäute zu erobern.
Trotzdem fror er an den Ohren, die Mütze verrutschte ihm ständig und offenbarte jeweils das eine oder das andere Ohrläppchen der Kälte. In Fischers Kopf knackte es, an seinen Schläfen ein leises Trommeln. Da war ein leerer Raum, da war ein Echo, ein Rauschen. Vielleicht hörte er aber auch schon das Plätschern des Flüsschens. Nicht weit da vorne musste die Brücke, der Steg übers Wasser, sein. Nicht mehr lang, dann war er zu Hause. Er trat in die Pedale. Das Licht wies ihm den Weg. Er musste sich beeilen. Er wollte an den Morgestraich, nein, er sollte unbedingt dorthin, an den Auftakt der Basler Fasnacht. Um 4 Uhr früh ging es in der Altstadt los. Seit Jahren hatte Fischer sich das vage vorgenommen, seit Jahren hatte er sich dennoch am heillos frühen Morgen des Montags nach Aschermittwoch im warmen Bett umgedreht, war liegen geblieben und nicht in die Basler Innenstadt gepilgert wie Tausende von Menschen.
Doch jetzt war es so weit.
Er konzentrierte sich auf die schmale Teerpiste vor ihm. Weiter vorne, schon am anderen Ufer des Flüsschens Wiese, zuckte und blitzte zwischen den Bäumen ein Licht. Möglicherweise einer, der bereits unterwegs war in die Stadt, zum großen Auftakt der Fasnacht, die mit dem allgemeinen Lichterlöschen, mit der großen Dunkelheit begann?
Für Fischer fing sie schon jetzt an, da das Licht von seinem Fahrrad erneut den Geist aufgegeben hatte. Er stieg ab und bedachte seinen ansonsten treuen Drahtesel mit allerhand Beleidigungen. Aber zur Not konnte er nun auch ohne Licht nach Hause pedalen.
Love made a fool of me. In seinem Kopf war immer noch postkoitale Rauschpause. Was verschlug ihn um diese Zeit in diese kalte, dunkle Leere? Alles wegen ihr. Sie pfiff und er kam angerannt. Mit dem Velo angefahren. Das gefiel ihr, das war echt öko. Fischer hatte gedacht, er sei zu alt, um sich noch einmal zu verlieben. Offenbar ein schwerer Irrtum.
Er lachte krächzend, schnaufte, spuckte. Er war todmüde, trotzdem trat er in die Pedale und dann – nachdem er kurz abgestiegen war – wieder gegen das Vorderrad. Das Licht wollte nicht mehr, der Dynamo war wohl ebenso erschöpft wie er, auch die Mechanik hatte eine Seele und einen Willen, so schien es ihm manchmal. Aber jetzt hatte Fischer das Hügelchen knapp vor der Wiese erreicht. Ein paar Meter ging es nach unten, dort führte der Steg übers Wasser. Die Brücke, etwa 50 Meter lang.
Fischer musste nach Hause, sich schnell etwas Wasserdichtes anziehen, denn ab 4 Uhr war Regen angesagt. Danach weiter in die Stadt, wichtig, sehr wichtig, jedoch nicht mit diesem Mistvelo, nein, Fischer hatte noch ein Ersatzrad im Fahrradkeller. Und eine andere Mütze musste ebenfalls her.
Obwohl er in allerhöchster Eile war, blieb er in der Mitte des Weiherstegs stehen und schaute und staunte. Was für ein Ausblick. Der schlanke Wasserlauf der Wiese hielt schnurgerade zu auf die in der Ferne zu erahnende Stadt, wo sie in den großen Rhein mündete. Das Flüsschen war ein Band aus ungeputztem Silber im vielschichtigen Grau der Nacht. An der Sichtgrenze zwischen Fluss und Himmel erkannte er ein halbes Dutzend geheimnisvoller roter Punkte, als ob dort ein UFO landen wollte. Es waren wohl die Positionslichter an den Kaminen der Chemiefabrik und der Kehrichtverbrennung. Der Himmel war hell, fast schon rosig, auch die Wolken. Die Erde war dunkel, selbst die kahlen Bäume links und rechts des dahineilenden Wassers trugen ein verlorenes Schwarz. Er stieg aufs Fahrrad und fuhr weiter, Licht aus, Licht an. Auf der anderen Seite des Weiherstegs stand kein Teufel, der seine Seele als Wegzoll verlangte. Das hätte Fischer gerade noch gefehlt. Er kicherte in sich hinein. Er hatte plötzlich das Bedürfnis, laut zu singen, doch er erschrak vor seiner eigenen Stimme.
Außerdem rauschte und gluckste die Wiese beunruhigend hinter ihm. Er verstand zwar nicht ganz, was das Flüsschen ihm mitteilen oder ob es ihn sogar warnen wollte, aber er würde gut aufpassen auf den letzten Metern bis zu seiner Bleibe in Riehen-Süd.
Gemächlich rollte Fischer zwischen den Bäumen der Langen Erlen hindurch.
Sie hatte es eingesehen, dass er in aller Herrgottsfrühe wegmusste. Sicher werde sie sich wieder melden, ja, es sei schön gewesen mit ihm. Fischer hatte ein Loch im Bauch gehabt und kurz daran gedacht, sich zurück zu ihr ins Bett zu legen. Aber er hatte keine Wahl, er war mit seiner Tochter verabredet. Er musste an diesen vermaledeiten Morgestraich. Er trat in die Pedale und fuhr ein bequemes Sträßchen aus Teer entlang, gleich dort vorne ging es links zum Entenweiher.
Vor ihm tauchte ein Auto auf, es stand im absoluten Fahrverbot, mitten auf dem Weg. Ein Sportwagen. In Fischer brandete der soziale Ordnungshüter hoch und er hielt an, statt das Hindernis einfach zu umfahren. Was sich das Pack erlaubte, unglaublich! Drecksautomobilist!! Saukopf, elender!!!
Er spähte ins Wageninnere. Da saß einer drin, den Kopf auf den Armen über dem Lenkrad. Fischer sah ihn nur undeutlich. Auf das energische Klopfen aufs Blechdach reagierte der Autoinsasse nicht. Vielleicht schlief das Arschloch. Oder es war tot. Fischers Empörung wich, auch weil ihm die Finger und Knöchel wehtaten. Scheiß drauf, er hatte keine Zeit, er musste so schnell wie möglich heim.
Als er beim Schrebergarteneingang vor den ersten Häusern von Riehen war, gab es plötzlich einen dumpfen Schlag, ein unidentifizierbares Geräusch in seinem Rücken. Erschrocken bremste Fischer und drehte sich um. Eine kleine gelbe, sehr helle Sonne war gerade aufgegangen und flackerte etwa dort, wo er auf das Autodach geklopft hatte.
Verdammte Kakerlakenkacke!
Fischer trat vehement in die Pedale. An der Trambahnstation Niederholzboden traf er erstmals wieder auf Menschen. Da warteten Kostümierte und Zivile auf eine Extrafahrt in die Stadt.
Seine Tochter Rebecca verließ sich auf ihn, er hatte ihr hoch und heilig versprochen, dass er rechtzeitig zum Morgestraich am Claraplatz sein würde, um auf das Kind ihres neuen Freundes aufzupassen. Erst danach würde Fischer der Polizei über die merkwürdigen Vorgänge beim Riehener Entenweiher berichten können.
2
Kommissär Norbert Britzig betrat sein Büro. Jetzt einen Espresso. Er schaltete die Maschine an und hängte seine Jacke an den Haken an der Tür. Der Jungkommissär hatte einen fatalen Hang zu braunen Lederjacken, die er immer ein wenig zu eng kaufte. Lange war er in diesem Verhalten von seiner Frau unterstützt worden, die stets meinte, dass er süß wie eine Leberwurst aussehe. Doch dann wurde seine Gattin Vegetarierin, möglicherweise sogar Veganerin, und urplötzlich stand Britzig alleine da und hatte ein Scheidungsverfahren sowie ein halbes Dutzend braune Lederjacken an der Backe.
Doch das kümmerte ihn momentan nicht, gerade litt er schwer am Schlafmangel, ihm fehlten wichtige Stunden der körperlichen und geistigen Erholung in horizontaler Lage, er war übernächtigt, restlos unerholt. Aber man wurde halt scheel angesehen im Korps, wenn man am Fasnachtsmontag nicht dabei war. Deswegen hatte er am Morgestraich teilgenommen, um darüber genauestens rapportieren zu können. Schön, aber – siehe seinen jetzigen Zustand – anstrengend, ja fast war es Raubbau am Körper, an der Konstitution. Er hatte um 3:30 Uhr in der Früh im romantisch lichtlosen Basel an einem Platz mit guter Aussicht gewartet, obwohl er gewusst hatte, dass er am Vormittag in seinem Büro sitzen und Präsenz markieren musste. Es war zum dritten Mal seit der Corona-Katastrophe, dass die Basler Fasnacht in ihrer vollen traditionellen Fülle und Pracht stattfinden durfte. Fast alle Einwohner der Stadt freuten sich über die Massen, da konnte ein Kommissär im öffentlichen Dienst nicht abseits stehen.
Und es war auch schön gewesen am Morgestraich, geheimnisvoll, spannend, sämtliche Lichter gelöscht, die Menschen in freudiger Erwartung im Dunkeln. Dann die Erlösung und alle spielten denselben Marsch in die atemlose Stille hinein, Melodie und Rhythmus blühten an den alten Häusern in der Basler Innenstadt empor. Bunte Lichter, die großen und kleinen Laternen. Aufblitzende Farben, die hohen Töne der Piccoloflöten und das radikale Trommeln, Menschen, die auf einmal gar nicht mehr aufhören konnten zu jubeln und zu klatschen vor lauter Begeisterung und innerer Befreiung, das verschlug einem schon den Atem. Endlich ging es los.
Britzig hatte das sehr gefallen, aber nun wollten ihm die Augen ständig zufallen. Hoffentlich wartete jetzt und die nächsten Tage nur krimineller Kleinkram, der gar nicht erst auf seinem Schreibtisch landete. Die üblichen Verdächtigen, die üblichen Gesetzesübertretungen. Es war selbstverständlich, dass jede öffentliche Festivität in Basel vom Verbrechen beziehungsweise von minderen Vergehen begleitet war. Taschendiebstählen zum Beispiel. Gewalttaten gab es eher gegen Ende der Fasnacht, am Mittwoch in der Nacht zum Donnerstag, wenn die Rückkehr in die Normalität drohte und es sich in vielen Köpfen leer drehte.
Weil so viele Kollegen Überstunden abbauten und frei hatten, hielt Britzig als Jungkommissär die Stellung, was immer auch passierte. Er schüttete den nächsten Espresso in sich hinein und dachte unvermittelt mittelschweren Herzens an seinen ehemaligen Chef, den guten Franz Gsöllpointner. Der arme Teufel hatte es nicht miterleben dürfen, dass im Kommissariat endlich eine vernünftige Kaffeemaschine installiert worden war, die einen prima Mokka produzierte. Ach ja, der Chef. Britzig nannte ihn in seinen wehmütigen Reminiszenzen wie auch in der Wirklichkeit bis heute so. Er war aus seinem Sabbatical nicht zurückgekommen, der Chef. Jedenfalls nicht zu den Basler Kriminalern. Wohl war er wieder in der Stadt, das schon, aber er hatte ein eigenes Unternehmen in der Sicherheitsbranche gegründet.
Britzig wusste nicht allzu viel davon. Er traf Gsöllpointner ab und zu auf einen Schwatz, an unverdächtigen Orten in der Stadt. Der Franz hielt sich dabei sehr bedeckt, was seine neue Tätigkeit betraf. Er wiegelte ab und wedelte fort, wenn ihn Britzig mit Fragen bedrängte. Ins Dienstgebäude der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft bei der Heuwaage würde er jedenfalls keinen Fuß mehr setzen, meinte der ehemalige Kommissär zu seinem Nachfolger, wenn sie in der Sonne am Wettsteinplatz hockten. Er mache das schon recht als sein Nachfolger, der Britzig, Kreuzkruzifix, ihn, den alten Gsöllpointner, brauche es gar nicht mehr.
Der neue Kommissär konnte nicht aufhören zu gähnen. Irgendwo heulte ein Staubsauger, der die vielen eingeschleppten Räppli, also Konfetti, aufsaugte, die mit den Menschen ins Gebäude gekommen waren.
Der Kommissär legte die Arme vor sich auf den Schreibtisch und versuchte, seinen Schädel schonend darauf zu platzieren, um ein paar Minuten die Augen zuzumachen und in aller Seelenruhe in den Weltenlauf hineinzumeditieren.
Nichts war einem vergönnt. Telefon. Alarm, Alarm. Es gab ein ausgebranntes Auto in den Langen Erlen.
Was hatte denn die Kripo damit zu tun? Das war doch ein Fall für die Feuerwehr.
Der Besitzer des zerstörten Porsches jedoch war eine brisante Personalie: Oertli, Waldemar junior, diverse Verzeigungen wegen sogenannter Gentleman-Verbrechen wie Geschwindigkeitsübertretungen, Beleidigung von Amtspersonen und so weiter. Strafauszug beiliegend.
Ja, und Kripo war schon richtig, denn es gab eine gerade eingegangene telefonische Zeugenaussage, dass in dem Auto jemand gesessen habe. Stein und Bein schwor dieser Zeuge, der in der Nacht durch die Langen Erlen geradelt war, um zum Morgestraich zu kommen. Er habe den Sportwagen stehen sehen, im Fahrverbot. Und da sei eindeutig ein Typ im Auto gewesen, der auf sein empörtes Klopfen jedoch nicht reagiert habe.
Herrje, Britzig schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als er den Namen des Zeugen las: Melchior Fischer. Es gab nur den einen! Jahrelang hatte er es miterlebt, wenn der Chef einen komplizierten Fall auf dem Schreibtisch hatte – also wenn rätselhafte Messermörder Basel verunsicherten, sich Kokainpakete selbstständig machten und Angehörige der Klimajugend die Rote Armee Fraktion nachahmen wollten –, dann war dieser Fischer nicht weit weg gewesen. Er war irgendwie in die Handlung eingebunden, aus welchen Gründen auch immer. Stets mischte er sich in die polizeilichen Ermittlungen ein und hatte trotz des einen oder anderen Fettnäpfchens doch ab und zu die richtige Spur gefunden …
Nemesis, genau, so hatte der Chef, also Franz Gsöllpointner, diesen Fischer genannt. Und seinem damaligen Adjutanten Britzig hatte der Kommissär erklärt, dass diese Nemesis mitnichten nur schlimmes Schicksal und Racheengel war, sondern auch für ausgleichende Gerechtigkeit sorgte. Deswegen hatte der Chef den Fischer immer geschützt und machen lassen, auch wenn er ihm in die Ermittlungen übel reinpfuschte. Die guten alten Zeiten.
Jetzt war er, Norbert Britzig, der Chef und hatte absolut keine Lust, sich mit Amateuren herumzuschlagen. Er ahnte, dass ihm dieser Fischer bei dem Fall gleich im Nacken hängen würde, einem Monster mit grausigen Tentakeln gleich, in üblen Fettnäpfen herumwütend, eine Figur aus einer wüsten Horrorerzählung. Der Kommissär las ab und zu Gruselgeschichten, von Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Algernon Blackwood, vor allem auch von H. P. Lovecraft, alles guter Stoff. Als Teenager hatte er damit angefangen und kam seither quasi nicht mehr davon los. Die Lektüre tat ihm oftmals nicht gut, erschütterte seinen Seelenhaushalt, er wusste es, aber er war halt ein bisschen süchtig. Nun hatte er, der Kommissär, diesen Fettnäpfchen-Fischer an der Backe, wenn er nicht schon in seinen Fangarmen zappelte. Wirrnis und Chaos drohten. Trotz allem musste der Zeuge so bald wie möglich herkommen, seine Aussage war wichtig.
3
Melchior Fischer war endlich ein richtiger Basler. Diesmal hatte er den Morgestraich nicht verschlafen. Zum ersten Mal in den vielen Jahren, in denen er in Basel und Umgebung lebte, hatte er es endlich geschafft. In der letzten Zeit hatte Fischer es einer Art Gottesurteil anheimgestellt, ob er diese spektakuläre Veranstaltung besuchte. Er würde sich flugs dorthin begeben, wenn er von sich aus erwachte – und er erwachte normalerweise problemlos, ohne Wecker, aus purer Willenskraft, wenn er früh aufstehen musste. Aber immer in jener Nacht auf den Montag des Morgenstreichs hin war sein Schlaf besonders tief. Nicht einmal präseniler Harndrang trieb ihn von seinem Futon hoch. So sah er allerfrühestens um 9 Uhr mit verklebten Augen aufs Handy. Verdammt, schon wieder verpennt und verpasst! Irgendwie erleichtert hatte sich Fischers dann jeweils noch ein Stündchen in der Horizontale gegönnt.
Doch jetzt war er stolz auf sich, am fasnächtlichen Auftakt dabei gewesen zu sein, so wie es nahezu jeder richtige Basler und jede richtige Baslerin eigentlich das ganze Leben tat, wenn er oder sie nicht sowieso aktiv an der Fasnacht beteiligt war.
Wahrscheinlich war daran auch seine Ehe mit der echten Basler Bürgerin Katharina gescheitert, weil Fischer es nicht als Hauptvergnügen oder als stadtmännische Pflicht empfand, um 3 Uhr morgens loszuziehen und ein Plätzchen in der Innenstadt, am Spalenberg oder bei der Mittleren Brücke zu suchen, von wo aus man das magische Ereignis miterleben konnte.
Allgemein machte Fischer im Nachhinein einen »Lack of Basility« bei ihm für das Ende der Ehe mit Katharina verantwortlich. Neben der Geringachtung der hohen Basler Feiertage und der hiesigen Bräuche und Gewohnheiten war seinerseits auch nur eine recht laue Zuneigung zum FC Basel oder zum Schwimmen im Rhein vorhanden.
Einst war er wegen Katharina am Kleinbasler Ufer gestrandet und hatte sich lange in dieser für ihn neuen Welt umgeschaut. Er war ein heimatloser, entwurzelter Geselle und kannte so etwas wie die Hingabe an die Tradition und die Bräuche einer Stadt nicht. Dieser Mangel an Heimatgefühl war Fischer immer als recht positive Eigenschaft für sein Leben vorgekommen. Freiheit und Bindungslosigkeit, das stand für geistige Mobilität.
Das waren allerdings Hirngespinste, Luxusgefühle eines weißen Mannes. Wenn man sich an einem Ort niederließ, so passte man sich den dort vorherrschenden Sitten und Bräuchen früher oder später an, so sah das aus. Und im Kultursektor, in dem sich Fischer betätigte, war es finanziell auch nicht hilfreich, wenn man zu viel herummoserte über das selbstzufriedene Basel. Also besser ab und zu mal die Klappe halten.
Der Vater Melchior Fischer ging fürderhin mit seinem Sohn Tim ins Joggeli zum FC Basel, Rebecca wollte eher zum Eishockey, und früher hatte es noch die langen Sonntage im Zoo oder im Tierpark in den Langen Erlen gegeben. Das war schon schön gewesen, soziale und kulturelle Kontakte zu pflegen und was man halt sonst so machte in dieser Stadt.
Das Fernbleiben vom Morgenstreich blieb ein Pièce de Résistance Fischers gegenüber Basel. Doch jetzt war alles ganz anders, er hatte es geschafft, knapp zwar, doch er war zum ersten Mal am Morgestraich gewesen. Rebecca hatte ihn ungeduldig am nördlichen Ende des Claraplatzes erwartet. Nur noch eine Viertelstunde bis zum Beginn der Fasnacht. Fischer war gar nicht dazu gekommen, sich zu entschuldigen für seine Verspätung, die ja nun wirklich höherer Gewalt geschuldet war. Rebecca hatte nichts hören wollen und ihm einen Kinderwagen hingeschoben.
»Das ist Ivy. Gerade schläft sie, aber sobald es laut wird, wacht sie auf. Nimm sie einfach auf den Arm.«
»Aber sie kennt mich doch gar nicht.« Fischer war überfordert.