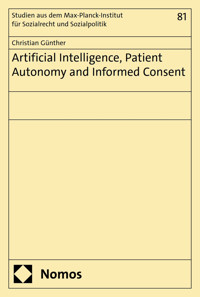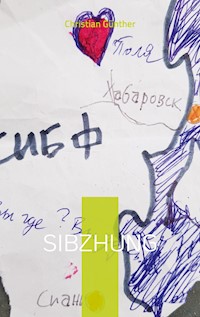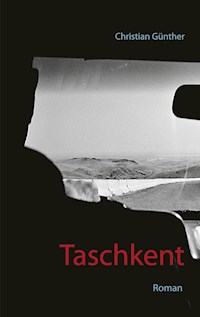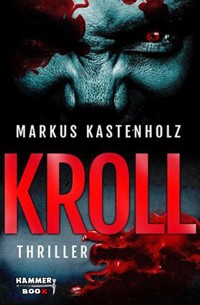Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Erzählungssammlung 'Bäume' geht es vor allem um Geschichten von der Liebe, deren Verschwinden und Wiederfinden. Aber auch um mysteriöse Zusammenhänge. So untersucht z.B. ein schuldbeladener, ehemaliger Polizeibeamter kriminelles Verhalten, das in rätselhafter Verbindung mit einer Buchenallee steht. In den 'Expat-Storys' wird das Leben von Auslandsdeutschen in Usbekistan kurz vor 9/11 kritisch geschildert, 'Azzurro' dagegen bietet Momentaufnahmen einer Reise durch Italien. Groteskes und Witziges findet sich an vielen Stellen, so in einem Text über eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn. Hauptthema ist aber unzweifelhaft die Liebe, ob im am Comer See spielenden 'Lago' oder in 'Das dunkle Mädchen', einer Novelle auf Postkarten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Bäume
Jacaranda
Buche
Esche
Linde
Akazie
Eiche
Expat-Storys
Im Banne des Bo
Handgeschliffen
Sundowner
Kommunizierende Röhren
Arabeske
Ornamental
Gorkij hin und gor'ko her
Unter Haselnußsträuchern
A-A-arriviert und de-haha-destabilisiert
Ballett
Kette
James Dean
Vom Balkon
Die Dame mit dem Hündchen
Zwei Geschichten
Die Schauspieler
Jahreszeiten
Italia
Divertimenti: raz – dwa
Bierchen
Tschuf tschuf
Die Wesen
„Mister – dead“
Costanera Sur
Pontiac
Der Nachtfalter
Lago
Das dunkle Mädchen
Bäume
Jacaranda
Unter uns lag das glitzernde Meer. Das Flugzeug ging zur Landung über, steuerte auf die Lagune zu und flog bald so tief, dass wir die staubigen Palmen auf dem ockerfarbenen Flugplatz erkennen konnten. Muriel ließ meine feuchte Hand los, und wir stiegen aus.
Als wir aus der vollklimatisierten Halle traten, schlug uns heiße Luft entgegen, die nach sonnendurchglühtem Asphalt und Meer roch. Eine leichte Brise wehte und ließ die Palmen rauschen. Zikaden schrillten.
Wir fuhren mit dem Mietwagen ins Zentrum, parkten und fanden an einem baumbestandenen Platz eine kleine Pension, die noch ein Zimmer für uns hatte. Nachdem der Patron schläfrig unsere Personalien aufgenommen hatte, schafften wir unser Gepäck hinauf und traten auf den winzigen Balkon hinaus. Mittelhohe Bäume, deren zartgliedrige Blätter vielfach gefiedert waren, säumten den Platz. Auf der gegenüberliegenden Seite stand eine verfallene Kirche. Ihr weißgekalkter, dachloser Türm, auf dem Störche ihr Nest gebaut hatten, ragte über die Bäume hinaus. Rechterhand, dort wo eine Straße auf den Platz mündete, standen ein paar Tische im flirrenden Schatten. Wir fragten uns, in welcher Richtung das Meer lag, und Muriel vermutete, dass es nicht allzu weit hinter der Kirche sei, weil dort ein etwas milchiger Dunst in der azurblauen Luft liege.
Obwohl wir müde von der Reise waren, durchstreiften wir noch am selben Tag einen großen Teil der Stadt. Wir bummelten durch die Straßen, gingen die Hafenmole entlang, lauschten dem klimpernden Klang der schaukelnden Boote, schauten den wenigen Schiffsleuten bei ihren Handgriffen zu und gelangten schließlich erschöpft wieder zum Platz vor unserer Pension. Wir waren durstig und ließen uns im Schatten unter den Bäumen an einem der Café-Tischchen nieder. Da kein Kellner zu sehen war, ging ich in den wohltuend dunklen Raum hinein, wo ein junger Mann hinter einer Espressomaschine saß und ein Buch las. Lächelnd nahm er meine Bestellung auf und brachte bald schon Pfirsicheistee und kaltes Wasser zu uns heraus. Nachdem wir jeder ein Glas des erfrischenden Getränks, das verdünnt besonders köstlich schmeckte, heruntergestürzt hatten, lehnten wir uns entspannt zurück. Muriel schlüpfte aus ihren Riemchensandalen und legte ihre müden Füße auf meine Knie, ich spielte mit ihren Zehen. Nach einer Weile rückte sie neben mich und flüsterte mir ins Ohr, ob mir der seltsame Mann aufgefallen sei, der unweit von uns auf einer Bank sitze. Ich wusste sofort, wen sie meinte. Der Mann war ausgemergelt, sein schmales Gesicht braungebrannt, Schuhe, Hemd und Hose waren schmutzig, aber früher elegant gewesen. Er trug eine Brille, die er hin und wieder abnahm und anschaute, wie um ihre Sauberkeit zu prüfen, was wie ein Tic wirkte. Wenn er die Brille wieder aufgesetzt hatte, schaute er hoch, so als suche er etwas im Baumblattwerk über seinem Kopf. Vielleicht sitze dort ein Vogel, meinte Muriel, und ich scherzte, dass er doch schon einen habe. Wir verglichen unsere Beobachtungen miteinander und kamen zu der Vermutung, der Mann sei kein Südeuropäer. Er sei unglücklich, ergänzte Muriel nach einiger Zeit, - und nicht betrunken, steuerte ich bei. Sie lehnte ihren Kopf an meine Schulter, und ich strich über ihre blonden Locken.
Schließlich setzten wir unseren Erkundungsgang durch die Stadt fort. Wir gingen durch schmuddelige Gassen und einen staubigen Park und kamen an einem Fußballstadion vorbei. Gegen Abend fanden wir zu unserer Pension zurück und kauften Brot, Käse und eine Flasche Wein in einem Supermarkt. Vom kleinen Balkon aus war der Mann auf der Bank nicht zu sehen, die Bäume verbargen ihn.
Als wir früh am nächsten Morgen aufbrachen, um mit dem Mietwagen die Küste entlangzufahren, war die Bank, auf der der merkwürdige Mann gesessen hatte, leer. Auf einer Schnellstraße brausten wir stundenlang an weiß getünchten Häusern, riesigen Werbeschildern für Hotels und Golfplätze, an Agaven und Palmen vorbei. Aus manchen der Agaven waren in der Mitte bis zu drei Meter hohe Stämme emporgewachsen. - So blühen sie, informierte mich Muriel. Während wir uns den Fahrtwind um die Ohren blasen ließen, wanderte unser Blick oft aufs Meer hinaus, das beständig zur Linken lag. Auf der anderen Seite waren bewaldete, rundkuppige Berge zu sehen.
Nach einigen Stunden bogen wir in nordwestliche Richtung ab. Die Landschaft wurde hügeliger, die Straße zweispurig und kurvenreich. Sie führte durch Korkeichenhaine und duftende Eukalyptus- und Pinienwälder. Schließlich endete der Wald, und wir durchquerten eine Dünenlandschaft. Eine Staubwolke hinter uns lassend, fuhren wir zu einem Parkplatz hinauf, der über den Klippen lag, und stiegen aus. Sofort umwehte uns der Geruch des Ozeans, wir traten an den Klippenrand und sahen auf die riesige tiefblaue Fläche hinaus, die zum Ufer hin smaragdgrün war und sich in großen Wellen wild und weiß schäumend brach. Die Brise trug winzige Gischttropfen zu uns herauf, und von den Pflanzen, die auf den Klippen wuchsen, ging ein würziger Duft aus. Rechterhand gingen die Klippen in einen viele Kilometer langen, sanft geschwungenen, menschenleeren Sandstrand über.
Wir folgten einem Pfad zum Strand hinunter. Dort stapften wir durch den Sand bis zu einer Stelle, vor der im Meer keine Felsen waren. In der Ferne ließen ein paar Leute einen Drachen steigen. Schnell zogen wir uns um und liefen ins Wasser, das uns in den ersten Minuten furchtbar kalt erschien, so dass wir über die sprudelnden, gewaltigen Wellenausläufer zu springen versuchten, die uns umzureißen drohten. Als wir bis zum Bauchnabel im flutenden Wasser standen, kam eine große grüne Welle auf uns zu, deren Kamm genau vor uns seinen höchsten Punkt erreichte und sich uns durchsichtig entgegenbog. Nebeneinander durchtauchten wir die grün glitzernde Wand, strichen uns danach das Wasser aus dem Gesicht und sahen uns vor Freude lachend an. Vom nächsten großen Wellenberg - Muriel tauchte unter ihm hindurch - ließ ich mich bis ins flache Wasser mitnehmen und lief dann wieder zu ihr hinaus.
Als wir genug hatten, legten wir uns in die Sonne, um uns wieder aufzuwärmen, und ich küsste Muriels blaue Lippen.
In der kleinen Ortschaft, die etwas landeinwärts lag, gab es keine Unterkunft, also fuhren wir weiter die Küste hinauf und gelangten schließlich in einen größeren Ort, der sich die Hänge eines Hügels hinaufzog, auf dem eine Windmühle stand. Wir bekamen ein winziges Zimmer in einer Pension, die von vielen jungen Touristenpärchen bewohnt war, stellten unsere Sachen ab und schauten uns das Städtchen an. Wir stiegen die steilen verwinkelten Gassen hinauf, die zwischen den weiß gekalkten Häusern hindurchführten. Auf den Dachterrassen und Balkonen hingen Badehandtücher und Wäsche, Jasmin und Bougainvillea umwuchsen Wände und Dächer, und in den Gärten standen Oliven- und Zitronenbäume. Oben auf dem Hügel orgelte der Wind auf den Tonkrügen, die an die Flügel der Mühle gebunden waren, und wir schauten auf den Ozean hinaus. Dann sahen wir, dass ein Fluss an der Ortschaft vorbeiströmte, und folgten mit den Augen seinem Lauf. Er war von grünen Feldern umgeben und schlängelte sich auf das Meer zu. Seine Mündung war nicht zu sehen, und wieder wanderte unser Blick über die weite blaue Fläche des Ozeans bis hin zum Horizont.
Auf dem Rückweg vom Strand kamen wir an der Kirche und der Feuerwehr vorbei und landeten auf dem von kleinen Restaurants und Bars umgebenen Dorfplatz, in dessen Mitte, von Verkehr umflutet, alte Männer unter ein paar Palmen saßen. Wir teilten uns eine Portion gegrillten Fisch, tranken ein Bier, merkten, wie müde wir waren, gingen zur Pension zurück und ließen uns aufs Bett fallen.
Eine Woche lang sah unser Tagesablauf so aus: Wir frühstückten in einem Café, verbrachten die Zeit bis zum Mittag am Strand und hielten dann - wie alle Bewohner - Siesta. Gegen vier aßen wir ein Sandwich und fuhren wieder an den Strand. Am Abend kehrten wir zurück, duschten, liefen durch das Städtchen, tranken in einer Bar neben der Markthalle ein Bier und gingen essen. Ich allerdings rief einmal am Tag zuhause an, weil dort nicht alles zum Besten stand.
Über diese täglichen Telefonate kam es nach einiger Zeit zum Streit. Der Streit war so heftig, dass wir die letzten Urlaubstage, die uns danach noch blieben, nahezu schweigend verbrachten. Es war die erste große Krise unserer Beziehung. Um den Zustand etwas erträglicher zu machen, schlossen wir uns einem harmonischen Pärchen an, das uns ein wenig von unserer Wut aufeinander und Traurigkeit über uns ablenkte.
Endlich war die Zeit um, wir verabschiedeten uns und fuhren missgestimmt auf der kurvigen Straße durch die Korkeichen-, Eukalyptus- und Pinienwälder zurück, bis wir nach vielen Stunden die vierspurige Schnellstraße erreichten, die uns schließlich wieder in die Stadt führte, auf deren Flughafen wir vor zehn Tagen gelandet waren. Bis zum Abflug blieb noch viel Zeit, und weil wir nicht zusammen durch die Stadt gehen wollten, verabredeten wir, uns drei Stunden später wieder am Wagen zu treffen. Während Muriel, wahrscheinlich um sich Geschäfte anzuschauen, in Richtung Zentrum davonging, streifte ich erst einmal am Hafen umher. In Gedanken versunken, sah ich auf die blendenden Sonnenreflexe im Hafenbecken, als mir plötzlich eine Idee in den Sinn kam. Ich beschloss, zum Abschied noch einmal den Platz aufzusuchen, an dem unsere Pension stand. Auf gut Glück ging ich los, verirrte mich ein paarmal, fand aber den Platz schließlich wieder. Ja, dort war unsere Pension, da war der Balkon, von dem aus Muriel und ich gemeinsam auf den Platz geschaut hatten, und ich stand neben dem Café, vor dem wir gesessen hatten. Aber wie sehr hatte sich der Platz verändert! Nun blühten alle Bäume. Violettblaue Blütentrauben hingen zwischen den gefiederten Blättern. Es sah wunderbar aus. Jetzt erst fiel mein Blick auf den merkwürdigen Mann, den Muriel und ich in der Woche zuvor so genau betrachtet hatten, und der auf derselben Bank saß. Flüchtig ging mir durch den Kopf, dass es vielleicht auch die Erinnerung an ihn gewesen war, die mich hierher gezogen hatte. Während ich darauf wartete, dass einer der Café-Tische frei wurde, schaute ich gelegentlich zu ihm hin, und es schien mir so, als hätten sich nicht nur die Bäume, sondern als hätte auch er sich verändert. Seine Haltung schien entspannter, und er hantierte nicht mehr mit seiner Brille. Aus Neugier und weil vor dem Café immer noch nichts frei war, ich aber sitzen wollte, ging ich über den Platz und setzte mich neben ihn auf die Bank. Zu meiner Überraschung wandte er sich mir sofort zu, so dass ich in seinem mit scharfen Falten versehenen, braun gebrannten Gesicht die leuchtend graugrünen Augen sehen konnte, und sprach mich auf Deutsch an. Ob sie nicht schön seien, die Jacarandabäume, fragte er. Und als ich bejahte, erhob er sich, zog eine der Blütentrauben behutsam zu sich herab und roch daran. Ich solle mir dieses Blau ansehen, sagte er, woher solch ein Blau wohl komme, frage er sich. So wie er mit mir sprach und mich anblickte, wirkte er keineswegs verwirrt, was ich insgeheim befürchtet hatte, allenfalls ein wenig überspannt. Und unglücklich, wie noch in der Woche zuvor, schien er auch nicht zu sein. Er erkenne mich wieder, sagte er nun, vor einiger Zeit sei ich mit einer Frau hier gewesen. Ich nickte und gestand ihm, dass wir uns Gedanken über ihn gemacht hätten, weil er so einsam und verzweifelt auf dieser Bank gesessen habe. Ja, es sei ihm nicht gut gegangen, sagte er, jetzt ginge es besser. Ob ich seine Geschichte hören wolle? Ich nickte.
Vor einem Jahr habe er den Sommerurlaub mit seiner Frau hier im Land verbracht. Es sei schon das dritte Mal gewesen, und, vielleicht auch weil ihnen das meiste hier schon zu bekannt gewesen sei, hätten sie sich gelangweilt und nicht so gut verstanden. Er sei von seinem Beruf als Lehrer so angestrengt gewesen, dass er ein sogenanntes Sabbatjahr eingelegt habe. Und obwohl er gewusst habe, dass er sich nun ein Jahr lang erholen könne, habe er sich nicht entspannt. Früher habe er mit seiner Frau viel teilen können, die Natur sei zum Beispiel eines ihrer gemeinsamen Interessen gewesen. Sie hätten sich ausgetauscht und viele schöne Momente gemeinsam erlebt. Das sei in diesem letzten Urlaub anders gewesen. Sie hätten kaum noch miteinander gesprochen, und er habe nicht gewusst, woran dies eigentlich gelegen habe. Allerdings habe es doch noch einige wenige glückliche Augenblicke gegeben. Schließlich, am Tag vor der Rückreise, habe seine Frau es nicht mehr ausgehalten und ihm gestanden, dass sie sich kurz vor der Reise in einen anderen verliebt habe. Er sei dann nicht mit ihr zurückgeflogen, habe sich ein billiges Zimmer gemietet und sei ruhelos durch die Stadt gestreift. Dabei habe er sich wieder und wieder an den letzten glücklichen gemeinsamen Augenblick erinnert. Das sei ein Moment unter den blühenden Jacarandabäumen hier auf diesem Platz gewesen. Als sie verblüht gewesen seien, habe er die Stadt verlassen und sei an die Küste gereist. Dort habe er den Rest der Saison in einer Restaurantküche gearbeitet, vor allem um nicht zuviel nachzudenken, und sei den deutschen Aussteigern, Haschisch rauchenden Althippies, FKK-Anhängern und Frührentnern aus dem Wege gegangen. Die Winter hier seien regnerisch, in den Häusern sei es feucht und kühl, das Leben eintönig und trist. Viele Männer tränken, und das Fischen habe ihm nicht gefallen. Er sei den Menschen immer mehr ausgewichen, viel durch die Gegend gewandert und habe sich nicht mehr um sein Äußeres gekümmert. Immer wieder habe er an die blauen Jacarandablüten denken müssen, das sei zu einer Art Besessenheit geworden, und irgendwann habe er sich vorgenommen, noch einmal unter den blühenden Bäumen auf derselben Bank zu sitzen, auf der seine Frau und er zuletzt einen kurzen Augenblick glücklich gewesen seien. Deshalb sei er im Sommer hierher zurückgekehrt und habe unter den Jacarandas sitzend auf das Erscheinen ihrer blauen Blütentrauben gewartet. Als es vor einigen Tagen soweit gewesen sei, seien ihm Glücksschauer den Rücken hinabgerieselt. Kurz darauf habe er sich überwunden und seine Frau angerufen. Deren Verliebtheit in den anderen sei inzwischen erloschen gewesen, sie sei einsam, habe sie gesagt, und denke oft an ihn. Also werde er in ein paar Tagen zu ihr nach Hause fliegen, schloss er und sah zu den Blüten hinauf.
Ich wünschte ihm Glück und erwähnte, dass ich und meine Freundin in etwa einer Stunde am Flughafen sein müssten. Er wisse das, sagte er, meine Freundin habe es ihm vorhin erzählt.
Während ich ihn völlig überrascht und auch ungläubig ansah, fuhr er ruhig fort. Sie habe ihn wohl treffen wollen. Genau dort, wo ich säße, habe zuvor sie gesessen und seine Geschichte ebenso interessiert wie ich angehört. Plötzlich hatte ich das Bild vor Augen, wie Muriel hier an meiner Stelle unter den Jacarandabäumen gesessen hatte, und Sehnsucht nach ihr überkam mich. Der Mann sah mich mit seinem schutzlos offenen Gesicht an. Ich solle mich nun auf den Weg machen, sagte er zum Abschied, auch er wünsche mir Glück.
Ich stand auf, gab ihm die Hand und ging, noch einmal auf ihn und den Platz mit den blühenden Bäumen zurückblickend, in der Richtung davon, in der ich unseren Mietwagen vermutete, an dem Muriel vielleicht schon auf mich wartete.
Buche
Ich hatte die Kassenzettel der letzten Tage auf den Küchentisch gelegt und kontrollierte die Summen mit einem Taschenrechner. Des öfteren musste ich neu ansetzen, weil die Zahlen auf der Anzeige einfach verschwanden. Obwohl draußen die Sommersonne schien und das Licht in der Küche eingeschaltet war, war es zu dunkel für die Solarzelle. Also hielt ich den Rechner von Zeit zu Zeit in die Nähe der Glühbirne, so dass er danach für ein paar Minuten seinen Dienst tat. Ich fand keinen Fehler und heftete die Belege im dafür vorgesehenen Aktenordner ab. Nachdem ich den Ordner zu den anderen ins Regal gestellt hatte, setzte ich mich wieder an den Küchentisch und berechnete in einem karierten Schulheft, wieviel vom monatlichen Arbeitslosengeld mir bis zum Ersten noch blieb. Den Leistungsssatz, die Differenz zwischen Miete und bewilligtem Wohngeld sowie die Sätze für noch zu zahlende Nebenkosten hatte ich im Kopf. Das Ergebnis, das mich nicht überraschte, weil ich es fast bis auf den Cent genau hätte vorhersagen können, trug ich in meine Wochentabelle und danach noch in ein Koordinatensystem ein. Die Kurve nahm exakt dengleichen Verlauf wie die des vergangenen Monats. Ich legte das Heft auf die anderen in der Schublade und schaute zur Wanduhr: 19.33 Uhr. Wie immer würde ich mir um 19.45 Uhr ein Brot mit Butter schmieren und dann zwei Scheiben Fleischwurst darauf legen. Ich beobachtete den schwarzen Minutenzeiger der einer Bahnhofsuhr nachempfundenen Uhr und wartete darauf, dass er sich weiterschob. Bevor dies ein weiteres Mal geschah, stand ich auf, holte die Butter in ihrem durchsichtigen Kästchen aus dem Kühlschrank und stellte sie auf den Tisch, damit sie sich in zehn Minuten besser streichen ließe. Nur keinen Leerlauf aufkommen lassen, dachte ich und meinte, mit meinen Füßen den Durchtritt der Pedale ins Nichts zu fühlen, wie damals als Kind, als ich den Halt verloren und mit dem Mund auf die Lenkergabel gefallen war. Ich erinnerte mich an den metallischen Geschmack des Blutes und das Bild im Spiegel, das mich mit blutverschmiertem Mund zeigte.
Nein, nicht an ihr Gesicht denken, an ihre Wange, die Lippen, ihre Tränen, das zitternde Kinn, den Blick!
Nach dem Abendbrot, zu dem ich wie gewöhnlich ein Glas Mineralwasser getrunken hatte, stellte ich die Butter und die Frischhaltebox mit der Wurst wieder in den Kühlschrank. Den Teller und das Messer spülte und trocknete ich gleich ab. Danach ging ich in den Flur, in dem die Zeitungen des vergangenen Jahres aufgeschichtet waren, nahm die Ausgabe, die an der Reihe war, also die Zeitung, die genau vor einem Jahr erschienen war, von einem der Stapel und die aktuelle Nummer von einem anderen und setzte mich wieder an den Küchentisch. Nun trennte ich die Lokalteile heraus und faltete sie so, dass ich deren erste Seite nebeneinander legen konnte. Seit dem letzten Sommer las ich ausschließlich die Artikel und Meldungen des Lokalteils, wobei ich beide Ausgaben miteinander verglich. Es erstaunte mich nicht mehr, wie viele Übereinstimmungen es gab. Die Artikel zu jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie Vogelschauen, Jahrmärkten oder Stadtteilfesten ähnelten sich sehr. Einige stimmten sogar fast wortwörtlich überein. Der Journalist hatte einfach den Artikel vom Vorjahr übernommen und nur einige Namen geändert. Obwohl ich nicht genau wusste, warum, hatte das vergleichende Lesen der Lokalteile wie immer eine beruhigende Wirkung auf mich. Vielleicht weil ich mir vorstellte, dass alles immer so weitergehen würde, dass auch im nächsten und unabsehbar vielen vielen weiteren Jahren der Mai-Kirmes das Stadtteilfest und dem Stadtteilfest die Vogelschau folgen werde. Dabei nahm ich am öffentlichen Leben der Stadt gar nicht teil. Ich hatte noch nie eine jener Veranstaltungen besucht. Lediglich einige Abschlussfeuerwerke hatte ich beobachtet, so gut es vom Fenster aus ging. Im tiefsten Grund empfand ich diese Lektüre vielleicht deshalb als so angenehm, weil mir die Meldungen zu versichern schienen, dass die Menschen um mich herum friedlich zusammenlebten. Es hätte ja auch ganz anders sein können. Anstatt um Harmonie untereinander bemüht zu sein und miteinander zu feiern, hätte ein jeder den anderen drangsalieren können. Weil ich Verbrechen und auch Unfälle für Ausnahmen hielt, die in der Berichterstattung jedoch überrepräsentiert waren, las ich die betreffenden Artikel meistens nicht. Außerdem wollte ich nicht an meine frühere Arbeit erinnert werden, die gerade mit diesen Schattenseiten des Lebens in Zusammenhang gestanden hatte. Nicht nur das - ich selbst hatte Schatten verursacht und war vor über einem Jahr aus dem Polizeidienst ausgeschieden. Während ich versuchte, die Erinnerung an diese Zeit zu unterdrücken, ging mir durch den Kopf, dass es genau das Falsche war, Zeitungsartikel zu studieren, die die Vergangenheit, in die ich nicht zurückschauen wollte, wieder aufleben ließen. Nur mühsam gelang es mir, mich auf die Seite vor mir zu konzentrieren, und wahrscheinlich weil ich abgelenkt war, las ich einen Artikel, den ich sonst nicht gelesen hätte. Am siebzehnten Juni vergangenen Jahres hatte ein älterer Mann an einem Vorortbahnhof eine Frau unsittlich bedrängt, war auf die Gleise gestürzt und von einer Bahn aus der Gegenrichtung zu Tode gefahren worden. Als ich nun auf die entsprechende Seite der heutigen Ausgabe blickte, stutzte ich. Gestern, am siebzehnten Juni, also genau ein Jahr später, hatte an demselben kleinen Bahnhof ein junger Mann versucht, eine ihm unbekannte Frau zu umarmen, zu küssen, und hatte sie dann in den Oberarm gebissen. Daraufhin war er von einigen Passanten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Da der Mann einen verwirrten Eindruck gemacht habe, sei ein psychiatrisches Gutachten angefordert worden.
Es erschien mir seltsam, dass beide Vorkommnisse, die einander darin ähnelten, dass es sich bei beiden um geschlechtliche Übergriffe handelte, an derselben Stelle und auf den Tag genau im Abstand von einem Jahr stattgefunden hatten. Natürlich konnte das alles nur Zufall sein. Aber weil mir nun noch auffiel, dass die Straftaten offenbar auch zur selben Tageszeit - „gegen neunzehn Uhr“ hieß es in beiden Artikeln - geschehen waren, beschloss ich, die Zeitungen vom vergangenen Jahr auf ähnliche Meldungen hin zu durchsuchen. Wie verblüfft war ich, als ich in der Ausgabe vom sechsundzwanzigsten Juni auf eine kurze Meldung stieß, die besagte, dass sich am Tag zuvor gegen neunzehn Uhr an eben jenem Bahnhof, der nur wenige Tage vorher Schauplatz eines sexuellen Übergriffs und tödlichen Unfalls gewesen war, eine Frau nackt ausgezogen und getanzt habe. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses sei die sich heftig wehrende Frau kurz darauf in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Weitere Meldungen, die den Vorkommnissen ähnelten oder sonst in einem Zusammenhang mit ihnen standen, fand ich bei einer schnellen Durchsicht aller mir zur Verfügung stehenden Zeitungsausgaben nicht.
Als ich die letzte wieder zurück auf den Stapel legte, bemerkte ich erst, dass der Zeitpunkt, zu dem ich mich für gewöhnlich schlafen legte, längst überschritten war. Ich erschrak geradezu, als ich von der Wanduhr ablas, dass es schon nach ein Uhr morgens war. Schnell löschte ich das Licht, und fahl fiel der Schein einer Straßenlaterne, die schräg vor dem Haus stand, in die Wohnung. Ich ging ins Badezimmer, wusch mich und putzte mir die Zähne. Wie immer vermied ich den Blick in den Spiegel. Bevor ich mich auf die Schlafcouch legte - ein Möbelstück, das außer von mir noch von niemandem benutzt worden war, denn ich hatte nie Gäste gehabt -, trat ich ans Fenster und sah auf den von der Laterne angeleuchteten Baum hinaus, der dort zwischen den Mietskasernen stand. Es war ein großer Baum, dessen Äste tief herniederhingen, und seine Blätter waren von einem dunklen, fast schwarzen Rot wie getrocknetes Blut. Ich wusste, dass ich schlecht einschlafen würde. In meinem Kopf schwirrten Verbrechen und Verbrecher umher, und ich dachte daran, wie ich noch vor nicht allzu langer Zeit regelmäßig biertrunken in unserer damaligen Wohnung irgendwo im Sitzen eingeschlafen war. Dann erinnerte ich mich auch an das immer noch betrunkene Aufwachen, die Kopfschmerzen, den Geschmack im Mund und den eigenen Geruch. Als ich meinte, Gabrieles Schluchzen zu hören, wie es damals aus dem Schlafzimmer gekommen war, schaltete ich das Licht wieder an, nahm ein Buch über Verschlüsselungscodes zur Hand und versuchte zu lesen.
Nachdem ich wie immer zerschlagen aus meinen üblichen Träumen, in denen ich Alkohol trank und die Kontrolle verlor, aufgewacht war, stellte ich die Kaffeemaschine an, deren Geräusche mich wie jeden Morgen etwas beruhigten. Während ich zwei Tassen trank, schaute ich auf den Baum hinaus, dessen Blätter mich nun im Sonnenlicht nicht mehr an Blut erinnerten. Mein Tagesplan sah Gänge zu verschiedenen Supermärkten vor, um dort Angebote im Sortiment und Jobangebote am schwarzen Brett zu studieren, aber da mir die tags zuvor entdeckten Geschehnisse an dem Vorortbahnhof aus irgendeinem, mir selbst nicht erklärlichen Grund keine Ruhe ließen, beschloss ich, einem ehemaligen Revierkollegen einen Besuch abzustatten.
Seit fast zwei Jahren betrat ich die Wache zum ersten Mal wieder. Der Pförtner erkannte mich und ließ mich unbeanstandet hinein. Mein Kollege arbeitete noch immer in demselben Büro, in dem auch ich einen Teil meines Dienstes versehen hatte. Er begrüßte mich freundlich - alle Kollegen hatten in der Sache, die zu meiner Entlassung aus dem Polizeidienst geführt hatte, hinter mir gestanden -, und nach einem kurzen, unverbindlichen Gespräch konnte ich mein Anliegen vorbringen, mir Einsicht in die Akten über jene Vorkommnisse zu gewähren. Ich könne es wohl nicht lassen, meinte der Kollege kopfschüttelnd, ließ sich dann jedoch recht schnell überreden, mit einem Bekannten im Archiv zu telefonieren, der mir die entsprechenden Akten heraussuchen würde. Noch am Nachmittag könne ich zur Einsichtnahme kommen. Bevor ich ging, versicherte mir der ehemalige Kollege noch einmal, dass ich für sie immer noch einer von ihnen sei, denn ich hätte nur das getan, was sie alle schon oft hätten tun wollen und was in ihren Augen völlig in Ordnung sei.
Im Archiv des Polizeipräsidiums schleuste mich der Bekannte meines Kollegen in einen Raum, in dem die Schriftstücke schon auf einem Tisch bereitlagen. Ich begann mit dem am weitesten zurückliegenden Vorfall. Weil die Ermittlungen aufgrund des Todes des Beschuldigten sofort eingestellt worden waren, erfuhr ich an mir Neuem nur Namen, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse von Opfer und Täter. Nachdem ich mir die Daten notiert hatte, wandte ich mich dem zweiten Fall des vergangenen Jahres zu. Hier war die Aktenlage genauso spärlich, weil von einer Anzeige abgesehen worden war, und ich konnte meiner Liste nur die persönlichen Angaben über die nackt tanzende Frau hinzufügen. Im letzten Fall war dem Bericht der Beamten, der zum Hergang des Geschehens nichts Neues beitrug, eine Zeugenaussage des Opfers beigefügt. Dieser war zu entnehmen, dass der Täter ihr schon im Zug aufgefallen sei. Er hätte bis kurz vor dem Halt ganz ruhig an der Tür gestanden und hinausgeschaut. Sie habe sich neben ihn gestellt, um auszusteigen. Kurz bevor sie die Türen geöffnet habe, sei er unruhig geworden und habe sehr laut durch die Nase geatmet, so als bekomme er nicht genug Luft. Er habe sie schon beim Aussteigen bedrängt und sie dann gleich auf dem Bahnsteig mitten in der Menge von hinten gepackt. Er habe sie zu sich gedreht und küssen wollen, sie habe sich gewehrt, da habe er sie in den Arm gebissen. Als sie geschrien habe, hätten ihn Männer von ihr weggerissen und festgehalten. Auf die Frage, ob ihr noch etwas aufgefallen sei, gab das Opfer an, der Mann habe plötzlich so gewirkt, als habe er Drogen genommen. Andere Zeugen bestätigten ihre Aussage. Die ärztliche Untersuchung aber hatte keinen Hinweis auf Drogenkonsum erbracht, lediglich ein erhöhter Adrenalinwert war bei der Blutanalyse festgestellt worden. Nachdem ich alle notwenigen Notizen gemacht hatte, verließ ich Archiv und Präsidium.
Wieder in meiner Wohnung suchte ich im Telefonbuch nach den Rufnummern der Beteiligten. Ich fand die des ersten Opfers, der verhaltensauffälligen Frau und des letzten Täters. Ich legte mir Block und Stift bereit und setzte mich vor das Telefon. Unentschlossen stand ich jedoch wieder auf und stellte mich ans Fenster. Obwohl es schon gegen Abend ging, stand die Sonne gleißend über dem rotbelaubten Baum und blendete mich. Ich dachte daran, dass übermorgen der längste Tag des Jahres sein würde, die Sommersonnenwende. Dann ging ich wieder zum Telefon hinüber, starrte aber nur auf den Apparat hinunter. Die Schatten im Zimmer hatten sich schon erkennbar verschoben, als ich mich schließlich überwand und die erste Nummer auf meiner Liste wählte. Der Ehemann des ersten Opfers teilte mir in entschiedenem Ton mit, seine Frau wolle nicht mehr über das damals Geschehene sprechen, und legte auf. Die Frau, die vor fast genau einem Jahr auf dem Bahnsteig getanzt hatte, ging selbst an den Apparat. Auch sie wollte nicht über das Vorkommnis sprechen, aber als ich ihr sagte, dass ich Polizeibeamter sei und Zusammenhänge zu zwei anderen Fällen sähe, begann sie doch zu erzählen. Sie wisse bis heute nicht, sagte sie mit trauriger Stimme, was damals über sie gekommen sei. Sie erinnere sich nur noch daran, dass sie im Zug gefahren sei und es auf einmal gar nicht mehr habe abwarten können, an der nächsten Station auszusteigen, obwohl sie dort gar nicht habe aussteigen müssen. Ich fragte sie, ob sie noch wisse, wo sie im Zug gesessen habe. Sie habe an den Ausstiegstüren gestanden, antwortete sie. Ob sie sich erinnern könne, warum sie unbedingt habe aussteigen wollen, fragte ich. Sie schwieg und sagte dann stockend, gleichsam nach Worten tastend, sie habe ins Freie kommen, die Luft auf ihrer Haut fühlen wollen. Also habe sie sich ausgezogen, das sei ihr ganz natürlich vorgekommen. Sie schwieg einen Moment und flüsterte dann, es sei wunderbar gewesen. Überrascht fragte ich nach, und sie wiederholte, ja, es sei ein wunderbares Gefühl gewesen, wie sie es noch nie und seitdem nie wieder gehabt habe. Als ich fragte, an was sie sich noch erinnere, antwortete sie mit brüchiger Stimme, an nichts, nur daran, dass sie danach völlig zerstört gewesen sei. Drei Monate später habe man sie aus der Klinik entlassen. Jetzt müsse sie Schluss machen, fügte sie hinzu und legte auf. Der Klang ihrer Stimme hallte in meinem Kopf nach, und gegen meinen Willen gesellte sich plötzlich die Vorstellung von Gabrieles Gesicht dazu, mit den Abdrücken auf ihrer Wange. Um das Bild zu verdrängen, wählte ich hastig die Nummer des letzten Täters. Eine ältere Frau gab mir die Auskunft, Herr Ehlers sei im Krankenhaus. Auf mein Nachfragen hin erfuhr ich, dass er in der Universitätsklinik behandelt werde.
In dieser Nacht musste ich zwei Tabletten nehmen, um wenigstens ein paar Stunden zu schlafen.
Schon um neun am nächsten Morgen stieg ich aus dem Bus, der vor dem Eingang zum Klinikgelände hielt. Zwischen großen alten Backsteingebäuden rauschten die Bäume. Ich ging durch die Parklandschaft und gelangte zur Nervenklinik. Ein Krankenpfleger öffnete die Tür zur Station von innen und ließ mich ein. Ich sagte, dass ich ein Freund von Herrn Ehlers sei und ihn besuchen wolle. Eigentlich sei dies im Moment nur Familienangehörigen gestattet, teilte er mir mit, aber weil es Herrn Ehlers den Umständen entsprechend schon recht gut gehe, könne er eine kurze Ausnahme machen, der Patient sitze im Fernsehraum. Dort hielt sich nur ein Mann im Bademantel auf, der auf den ausgeschalteten Fernseher zu schauen schien. Vorsichtig sprach ich ihn an, und er wandte mir langsam sein trauriges Gesicht zu. Ich fragte ihn, wie es ihm gehe, und er sah mich nur mit großen Augen an. Dann schaute er wieder zum Fernseher hin. Ich erzählte ihm, dass ich versuchen würde, das Geschehen am Bahnhof aufzuklären. Weil er nicht der erste gewesen sei, der genau dort und zu genau derselben Zeit auffällig geworden sei, müsse ein Zusammenhang bestehen, sagte ich und bat ihn, mir noch einmal zu schildern, was vorgefallen sei. Aber Herr Ehlers schüttelte nur den Kopf und schwieg. Als ich ihn weiter bedrängte, vergrub er irgendwann den Kopf in den Händen. Sein Bademantel war schlecht zugeknotet, und seine schmuddelig weiße Unterhose war zu sehen. Ich schaute auf ein Regal mit Brettspielen und dachte, dass das Ganze hier keinen Sinn habe und dass ich den Mann besser in Ruhe ließe. Doch dann fiel mir eine letzte Frage ein. Ob er sich erinnern könne, am Bahnhof dort ein Glücksgefühl gehabt zu haben? Da sah er mich wieder mit großen Augen an und nickte dann langsam. Er habe sich sehr gut gefühlt, sagte er tonlos, so gut wie niemals zuvor, fügte er noch hinzu. Weil ihn der Pfleger nun ins Stationszimmer rief, stand er schwerfällig auf und ging davon. Ich sah ihm nach, wie er in kleinen Schritten und mit herabhängenden Armen den Gang hinunterschlurfte. Dann bat ich einen vorbeikommenden Pfleger, mich hinauszulassen.
In der Stadt angekommen, beschloss ich, nicht nach Hause zu gehen, sondern mit dem Zug die Strecke abzufahren, die Opfer und Täter zurückgelegt hatten.
An dem kleinen Bahnhof, wo die unerklärlichen Vorfälle geschehen waren, stieg ich aus. Ein teilweise überdachter Bahnsteig mit einem Fahrkartenautomaten, ein altes Bahnwärterhäuschen, Fahrradständer, - hier war nichts Auffälliges zu entdecken, kaum zu glauben, dass genau hier diese seltsamen Dinge geschehen waren.
Mit dem nächsten Zug fuhr ich ein paar Stationen weiter, stieg dort um und fuhr wieder zurück. Im Zug stellte ich mich wie die Täter ans Fenster vor den Ausstiegstüren und schaute hinaus. Auch sie hatten diese Felder und die Hügel im Hintergrund gesehen, das Strauchwerk am Bahndamm, die kleinen Ortschaften mit Kirche und Baumarkt, die Bahnschranken, und nun, bevor der Zug vor dem kleinen Bahnhof abbremste, das Jagdschlösschen und die lange Allee.
Etliche Male fuhr ich die Strecke ab, aber es fiel mir nichts auf.
Als ich um kurz vor sieben Uhr abends, also zu der Tageszeit, zu der alle drei Ereignisse vorgefallen waren, im Zug am Fenster stand, dachte ich wieder darüber nach, ob ich mir einen Zusammenhang zwischen den Fällen nur einbildete, ob vielleicht doch alles nur Zufall war. Während ich hinausschaute, überlegte ich, was jetzt, zu dieser Tageszeit, anders war als bei den Fahrten zuvor. Die Sonne stand etwas niedriger, das war alles, und obwohl es ein diesiger Tag war, blendete sie mich ein wenig. Ich kniff die Augen zusammen: Dort war das Jagdschlösschen, gleich würde der Zug an der langen Allee entlanggleiten, abbremsen und am Bahnhof halten. In einem der Bäume bewegte sich etwas, wahrscheinlich ein Landschaftsbauer, ein von der Gemeinde beauftragter Baumarbeiter, der morsche Äste absägte, die Passanten gefährdeten. Diesmal stieg ich nicht mehr an der Station aus und fuhr gleich in die Stadt weiter.
In dieser Nacht verfolgten mich trotz der Tabletten Traumfetzen, in denen ich mit Gabriele stritt, in denen ich trank, und schließlich ließ mich die Szene, als ich sie schlug, erschrocken aufwachen. Ich nahm noch eine Tablette und schlief erst gegen Morgen noch einmal ein.
Als ich mit starken Kopfschmerzen aufwachte, stand die Sonne schon hoch am gleißenden Himmel. Ich sah noch einmal meine Unterlagen durch, hielt es aber nicht lange in der Wohnung aus und beschloss, einen Spaziergang zu machen, um mich abzulenken. Ohne dass ich es wirklich gewollt hatte, führte mich mein Weg in die Gegend, in der Gabriele seit unserer Trennung wohnte. Ich sah zu ihrer Wohnung hinauf, stellte mir vor, wie sie nun lebte, und wartete. Es war ein heißer Tag, und ich setzte mich in den flimmernden Schatten einiger Bäume, die um einen Spielplatz gruppiert waren. Ich merkte, dass es mir nicht gut ging. Aber wann war es mir denn je gut gegangen? Plötzlich trat Gabriele aus dem Haus. Ihre Haare glänzten im Sonnenlicht, sie trug ein fliederfarbenes T-Shirt und einen kurzen weißen Rock. Sie sah ein bisschen wie eine Tennisspielerin aus. In dem kurzen Augenblick, in dem ich ihr Gesicht sah, wirkte sie glücklich, glücklicher, als sie es mit mir gewesen war, dann sah sie mich, erschrak und ging schnell fort. Ich folgte ihr nicht und blieb wie betäubt auf der Bank des Kinderspielplatzes sitzen.
Am späten Nachmittag stieg ich an dem kleinen Bahnhof aus, den ich inzwischen so genau kannte. Diesmal wollte ich die Strecke zu Fuß abgehen. Zwischen den Büschen am Bahndamm führte ein kleiner Trampelpfad entlang. Der Schotter neben den Gleisen glitzerte, und von den in der Sonne schmorenden Holzschwellen drang ein chemischer Geruch herüber. Langsam näherte ich mich der Allee, die schon von weitem zu sehen gewesen war. Der Lärm einer Motorsäge klang herüber. Nun gelangte ich zu den ersten Bäumen. Jetzt war es völlig still. Die Motorsäge war verstummt, und kein Lufthauch wehte, so dass die Bäume nicht rauschten. Ich trat zwischen die Reihen auf den welligen, verwitterten Asphalt. Aus etlichen geborstenen Stellen wuchsen Büschel trockenen Grases. Die Allee musste sehr alt sein. Während ich an den Bäumen vorüberschritt, sah ich mir diese genauer an. Die Stämme, deren Rinde grau und recht glatt war, so dass sie mich an Eselshaut erinnerte, hatten Wülste und Ausbuchtungen, wo einmal Äste gewesen waren. Manche wiesen auch Verknotungen auf, die mich an Elefantenrüssel denken ließen, auch wegen der waagerechten bräunlichen Streifen, mit denen die Rinde gezeichnet war. Während ich mit den Augen den Ästen ins Blattwerk hinauf- und in die grünen Blattmassen hineinfolgte, stieß ich mit dem Fuß plötzlich gegen abgeschnittene Äste und Zweige. Die mittelgroßen spitz zulaufenden Blätter waren am Rand gesägt, und mir fielen die stark sichtbaren Blattnerven auf. Ich wandte mich wieder den Bäumen zu. Hier, hoch über meinem Kopf, musste der Gartenarbeiter seinen Dienst tun. Die Motorsäge war allerdings schon seit einiger Zeit nicht mehr zu hören gewesen. Von meinem Standort aus konnte ich nichts im Grün weit oben über mir erkennen. Mich wunderte auch, dass keine Leiter zu sehen war. Jetzt war mir, als hätte ich ein leises Knacken gehört. Ich rief in den Baum hinauf, doch niemand antwortete. Vielleicht trug der Arbeiter einen Hörschutz. Ich rief noch einmal, aber wieder rührte sich nichts. Es konnte natürlich auch sein, dass der Mann kurz zuvor weggegangen war, um eine Pause zu machen. Ein drittes Mal rief ich vergeblich, dann setzte ich meinen Weg durch die Allee fort und nahm mir vor, auf das Geräusch der Motorsäge zu achten, das auch noch in weiter Ferne zu hören sein würde. Hier am Anfang der Allee sah ich noch viele frisch abgeschnittene Zweige auf dem Asphalt liegen, später waren sie in den Graben geräumt, und die Blätter verwelkt.
Als ich die Allee hinter mir gelassen hatte, schaute ich noch einmal zurück. Aus dieser Richtung würde ich mich ihr nachher im Zug nähern. Ich lauschte, aber nichts außer dem Zirpen der Grillen war zu hören. Nachdem ich an einem Feld vorübergegangen war, gelangte ich zu dem Jagdschlösschen. Das blassgelbe Gebäude schien leer zu stehen und wirkte aus der Nähe verwahrlost. Große Farbplacken waren von den Wänden in wuchernde Brennnesseln gefallen. Ich schaute durch eines der Fenster hinein, konnte aber nichts erkennen. Schließlich ging ich weiter, an einer Bahnschranke, einem Baumarkt und ein paar Schrebergärten vorbei bis zur Bahnstation. Dort gab es nicht einmal ein Bahnwärterhäuschen. Die Uhr über dem Bahnsteig zeigte halb sieben, und während ich auf den Zug wartete, drang noch einmal der Lärm der Motorsäge herüber, brach dann jedoch ab. Wahrscheinlich hatte der Baumpfleger seine Arbeit beendet. Jetzt lief der Zug ein.