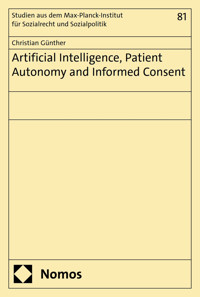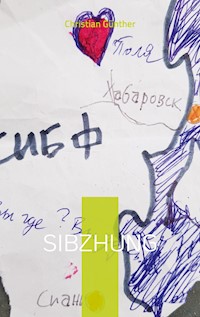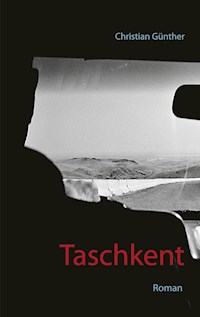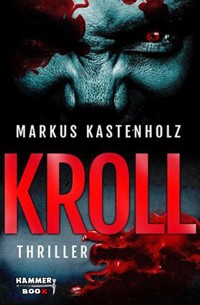Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Mordversuch an einem Mann, der ihn sexuell genötigt hatte, befindet sich Rainer, ein Mann Ende dreißig, in der Nervenklinik. Der behandelnde Arzt setzt ihn unter Druck, seine Geschichte aufzuschreiben, sonst drohe die Verlegung in eine Strafanstalt. Rainer beginnt widerwillig, findet jedoch allmählich ins Erzählen. Das Ergebnis dieses Schreibprozesses ist Let It Snow. Die Auseinandersetzung mit dem zentralen Geschehen vermeidet er anfangs. Stattdessen porträtiert er den Arzt und Mitpatienten, darunter die Nervöse und Mehdi, einen Marokkaner, der sich von einer Haschischpsychose erholt. Zwischen den beiden entsteht eine Freundschaft. Rainer erträumt sich sogar einen gemeinsamen Fluchtversuch. Schließlich stellt er sich aber der Vergangenheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Gang werden schwere Dinge auf Rollen gezogen. Es riecht nach Kantine, nach Metall und
Desinfektionsmitteln. Sie zwingen mich zu schreiben, Herr Doktor. Sie sagen, sonst wird ich ins Gefängnis gesteckt. Ich glaub zwar, Sie bluffen, aber weil ich mir nicht sicher bin, schreib ich einfach irgendwas auf. Blablabla. Ich sitz hier im Aufenthaltsraum am Tisch. Mit einem Schulschreibheft, das Sie mir gegeben haben. Der Kugelschreiber schreibt blau, das ist schon was. Besser als schwarz, grün oder rot. Er ist aus durchsichtigem Plastik, fühlt sich nicht gut an in meiner Hand. Die Mine ist voll, die Wanne ist voll, meine Hand sieht alt aus, Hühnerhaut, tiefe Gräben am Daumengelenk, Schraffuren oben auf dem Zeigefinger, Rillen an der Seite, der Stift liegt auf Faltenwülsten, Jahresringe um die ‚Schwimmhaut‘ zwischen Indexfinger und Daumenansatz. Sieht aus, als ob ein labbrig lauwarmer Teil eines Brathähnchens schreibt, eine Mutation, mit Fingern statt Flügelstummeln, gestreckte Chicken-Wings aus dem 3-D-Drucker eines durchgedrehten Experimentators. Fingernägel, längsgeriffelt mit weißen Flecken, unter den Rändern mandarinenorange. Das ist meine Hand. Sie ist mir unsympathisch. Wie wenig Gutes hat sie getan, wieviel Schmutziges, einiges Schlechtes. Kleine Tiere getötet, Insekten an der Fensterscheibe, so fing es an … Blaue Scheiße kommt aus dem Ballpoint raus, ich verteil sie über die Seite. Kriechspuren einer Spinne, die aus meinem Kopf ausgeschlüpft ist und mit ihren acht Beinen übers graue holzige Papier läuft. Sie macht mir Angst und ich muss wegschauen, versuche aber gleichzeitig weiterzuschreiben, ich wills nur nicht sehen. Stattdessen guck ich auf einen Patienten, der eingenickt ist, sieht aus wie tot. Ist vielleicht tot. Und einer schlurft gerade aus dem Raum raus. Seine Arme hängen runter. Das Übliche. Ich schaue zum Fenster. Das spiegelt die Neonröhre an der Decke und undeutlich die Sitzecke mit aufgehängtem Bild dahinter. Vorn mein dunkler Umriss, kahlgeschorener Eierkopf auf Rumpf. Draußen die Abenddämmerung, ein blattloser Baum, dahinter ein anderer Flügel der Klinik.
… hab aufgehört zu schreiben. Der Pfleger Karl hat hereingeschaut. Ihr beobachtet mich. Wenn ich nicht schreibe, weckt ihr mich vielleicht mitten in der Nacht, zieht mir eine Zwangsjacke an, stülpt mir einen Kartoffelsack über den Kopf und karrt mich zum Knast.
Also weiter. Aufschreiben, was ich sehe, zum Beispiel. Drüben, im anderen Flügel, in einem erleuchteten Krankenzimmer sitzt eine Besucherin am Bett ihres bewegungslos daliegenden Bekannten, Verwandten, Mannes. Sie hat herübergesehen, bleiches Gesicht, dunkle lockige Haare, wirkte ratlos. Mich besucht niemand. Auf unserer Station gibt es nicht viele Besucher. Einfach aufschreiben, was ich so denke. Aber mit Selbstzensur. Vorhin hab ich gedacht, dass die Straßen im Zentrum der Stadt sicher voller Menschen sind, während wir hier sitzen, gefangen in diesem Bau und in unseren Köpfen. Weihnachtslieder träufeln dort ihr süßes Gift aus Boxen über die Stände, während wir hier süße Erlösung in Form bunter Pillen aus anderen Boxen schlucken, Boxen, viergeteilt in morgens, mittags, abends, nachts. Nicht weit von hier die Maronibrater, die Karussells, das spritzende Frittierfett, Glühweindampfschwaden, Jingle Bells, das Klingeln der Glöckchen am Hals der Rentiere im Takt ihres schnellen Laufs. Oder ‚Last Xmas I gave you my heart‘ … Ein paarmal hab ich das Lied gesungen. Und wie oft hab ich mein Herz vergeben? Nur ein Mal. Aber du hast es nie angenommen. Du … irgendwie bin ich auch deinetwegen hier drin … Du, mit deinen dunklen warmen Cognacaugen, der Puschelmähne eines Kuschelponys, den mahagonifarbenen Wellen, die deinen und meinen Kopf umwogten, wenn wir über das Schulbuch gebeugt waren, mit dem Nougatton deiner Haut, deiner Wangen, deines Nackens, deines Halses bis zu den Schlüsselbeinen, wenn ich auf den Ausschnitt deiner Bluse sah. Du, mit deinen schönen Händen, dem Schwung deiner dunkelroten Lippen, zwischen denen deine großen Schneidezähne aufschienen, wenn du lächeltest. Ich saugte deinen Atem in mich ein, selbst wenn er nach den Pausen ein wenig nach Zigarette roch, und wollte dich küssen. Wenn ich neben dir saß, die wenigen Male, war ich immer kurz davor, zu dir hinüberzusinken wie ohnmächtig, dein Gesicht duftend über mir wie die Blüten eines Orangenbaums, in den schützenden Schatten deines Haars, um von dir wachgeküsst zu werden, behütet von deinen weit geschwungenen Schultern, deiner über mich gebeugten, hochgewachsenen Gestalt.
Ich wollte immer in deiner Nähe sein, schaffte es aber nur im Chemieunterricht neben dir zu sitzen - für ein paar Stunden, dann verdrängten mich deine Freundinnen. Das war meine glücklichste Zeit auf der Schule, im Dunkel neben dir, vorne das in der Bunsenbrennerflamme leuchtend gelb verbrennende Natrium. Später gelang es mir immerhin, im Mathematikunterricht in der Reihe hinter dir zu sitzen. Aber schon damals wusste ich, dass ich nicht zu aufdringlich oder anhänglich sein durfte. Deshalb hielt ich auf dem Schulhof einen gewissen Abstand und versuchte auch, nur wenig zu dir hinzuschauen. Ganz zufällig sollte mein Blick nur kurz auf dir ruhen. Und wenn sich unsere Blicke trafen, tat ich, als sähe ich dich gar nicht. Dennoch entging mir wenig. Ich registrierte genau, mit wem du sprachst und über wessen Bemerkungen du lachtest.
Da sitzen wir wie weichgekochte Rüben, Kürbisse, Kohlrabis, in Beruhigungsmittel eingelegt, mit Stimmungsaufhellern aromatisiert. Wir sind abgeschossen, durchlöchert, abgeheftet, warten im Aufenthaltsraum, dass die Zeit vergeht, und Sinatras Stimme rieselt auf uns herab, Santa Claus Is Coming To Town … Die Gurke, für Sie, Herr Doktor, der Patient Mehdi Ghazali, nickt im Takt mit. ‚Better watch out!‘, kreischige Blechbläser – ich stelle mir Godzilla vor, mit angeklebtem weißen Rauschebart und im roten Mäntelchen, wie er zwischen den Häusern unserer Stadt umherstapft, einfach alles zertrümmert, nix da Geschenke. Sinatra war ein Scheißkerl. Wie sehr aber habe ich seine traurigen Songs gemocht, die, die er sang, als Ava Gardner ihn verlassen hatte … Jetzt hab ich ihn nur als Rat Pack - Arsch im Kopf, aufgequollen, betrunken, mit seinen kalten blauen Augen Frauen musternd, in brutale Mafia-Geschäfte verwickelt. Die Welt ist schlecht.
Es ist so schön, wenn die Schwestern morgens in das Zweibettzimmer, das ich mit der Gurke teile, hereinrauschen. „Wenn ich Sie so sehe, Schwester Müller, so jung und positiv“, strahle ich sie an, „dann möchte ich eigentlich nur noch sterben, denn für einen Moment kann ich glauben, dass die Welt gut ist und man beruhigt abtreten kann.“ Sie schaut mich mit verständnislosem Blick an, weiß nicht, wovon ich rede. Ihre blauen Augen blitzen und ihre Apfelbäckchen sind gerötet. „Was schwafeln Sie denn da?“ Ich versuche zu erklären, dass Tote den Staat doch weniger kosten, dass also nur ein toter Patient ein guter Patient ist. Jetzt tritt die Schwester ganz nahe an mein Bett und schnarrt „Raus da!“ - „Aber Schwester Müller, das stimmt doch. Wenn bei Ihnen die Sterberate hoch ist, ist das ein gutes Zeichen.“ - „Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie zum Kotzen sind“, zischt sie und: „Machen Sie Ihr Bett selbst.“ Weg ist sie. Die Gurke hat gar nichts mitbekommen, hat sich im Bad die Zähne geputzt.
Sinatra war ja in Wirklichkeit noch viel fieser als in diesem Melodram, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, in dem er Shirley MacLaine mies behandelt, seine süße, lebendige, sympathische Busbekanntschaft, die am Ende von ihrem eifersüchtigen Freund erschossen wird. Widerlich war er. Und in dieser schlechten Welt sind’s, wenn man genauer hinschaut, vor allem die erfolgreichen, mächtigen Männer. Ihre schrecklichen Taten kommen oft erst später ans Licht. Ich will die Namen hier nicht nennen, vielleicht schreibe ich sie auf ein Blatt Papier, das ich später verbrennen werde. S. war ja nur ein kleiner Fisch, nein, ein kleiner Kröterich, der sein Mäulchen aufmachte und ganz gut quaken konnte. Früher dachte ich, dass im Lauf der Zeit alles schlechter wird, heute denke ich das nicht mehr, denn mir ist klar geworden, dass die Verbrechen durch das Internet viel eher bekannt werden. Früher konnte man viel mehr unter den Teppich kehren, unter diese eh schon stinkenden Teppiche voller Blut, Tränen, Gehirnmasse, Sperma und Champagner. Nein, ich nenne die Namen der Täter nicht. Ihre Namen sollen ausgelöscht sein.
Besonders zu schaffen macht es mir, wenn ein Idol meiner Jugend sich später als moralisch verkommen oder sogar als Sexualstraftäter herausstellt. Die Enthüllungen über ein solches Idol, dessen Namen ich nicht nenne und niemals mehr nennen werde, haben einen Teil meiner Jugend entwertet. Ich war auf ein paar seiner Popsongs und auf seine Tanz-Moves hereingefallen. Ich hatte jemanden bewundert, der Kinder sexuell missbrauchte. Seitdem ich das erfuhr, habe ich seine Musik nie wieder gehört und werde sie nie wieder hören. Ich wünschte, ich könnte die Erinnerung an ihn löschen …
Ich schaue mich wieder im Aufenthaltsraum um. Die Gurke sitzt zusammengesackt im Sessel. Die Luft ist abgestanden – ich öffne ein Fenster. Kalte Luft kommt herein, die nach gebrannten Mandeln vom Weihnachtsmarkt riecht. Ich erschaure. Seit dem missglückten Gespräch mit Schwester Müller - wie lang ist das her? Eine Woche? - spreche ich mit niemandem mehr. Alle ziehen mich nur runter, das brauche ich nun wirklich nicht. Im Notfall antworte ich nur mit irgendetwas, das mir gerade einfällt. Je unverständlicher desto besser, nämlich desto verrückter. Das sichert mir den Platz hier. Die Gurke schnarcht jetzt. Er hat ja mit anderen eine Bank überfallen, war der Fahrer, aber im Kifferwahn … Sieht ganz süß aus. Die langen Wimpern heruntergeklappt, dunkle Locken um den Kopf. Auch ihm hängen die Arme an den Seiten runter. Extrapyramidale Nebenwirkungen, die kennt hier jeder.
Heute Nachmittag hatte ich mein wöchentliches Schaulaufen bei Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Sprock. Auf Ihr ‚Guten Tag‘ hin habe ich wohl ein „Selber“ gemurmelt. Das gefiel Ihnen nicht. „Warum so feindselig?“ Ich hab nicht geantwortet. „Wie geht es Ihnen?“ (Oder hatten Sie etwa ‚Wie geht’s uns denn heute‘ gefragt?) „33⅓.“ „Sie wissen ja, dass für Sie besondere Auflagen bestehen?“ ‚Du mich auch‘, dachte ich, sagte aber „Shine on you crazy diamond“. „Sie scheinen medikamentös gut eingestellt zu sein …“ „I wanna be sedated.“ „Hmh“, sagten Sie lächelnd, „aber das sind Sie doch. – Und jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Mensch! Haben Sie Ihre 300 Wörter pro Tag geschrieben? Zeigen Sie mal her.“ Sie überflogen ein paar Seiten. „Das ist wenigstens ein Anfang. Immerhin spielen Sie in Ihrem Text nicht den Verrückten so wie jetzt gerade.“ Sie sahen mich genau an. „Ich weiß, was Sie denken.“ Ich dachte darüber nach, dass meine Chancen, in der Anstalt zu bleiben und nicht ins Gefängnis zu kommen, am größten wären, wenn ich mich so verrückt wie möglich zeigte. „Vergessen Sie nicht, dass ich es bin, der Sie beurteilt“, sagten Sie. „Sie wissen, dass mir die Behörde im Nacken sitzt. Die fragen regelmäßig, ob Sie haftfähig sind. Mir geht es um Therapie, denen dort um Strafe. Verrückt können Sie auch im Gefängnis sein. Da können Sie auch Zitate aneinanderreihen. Nur hört Ihnen da keiner mehr zu und Sie werden ganz andere Probleme haben. Verstehen Sie? Also machen Sie mir nichts vor und bleiben Sie bei der Sache.“ Ich muss das wohl abgenickt haben. Daraufhin stellten Sie mir Ihre Fangfrage. „Na dann sagen Sie mir doch mal: Was ist denn Ihre Sache?“ Ich wusste keine Antwort. „Mann Gottes!“ Ja, das riefen Sie. „Ihre psychische Verfassung natürlich! Ihre Instabilität, so will ich es einmal nennen. Liefern Sie mir erhellende Details. Vorgeschichte, Gedanken, Gefühle … Zeigen Sie mir, dass Sie sich mit Ihrer Schuld, mit Ihren kriminellen Handlungen auseinandersetzen.“ Sie schauten mich wieder durchdringend an, so, wie nur Sie das können. „Und noch einmal! Ich bin es, der Ihre Haftfähigkeit beurteilt.“ Mit diesen Worten entließen Sie mich. „I’m looking for freedom“, hab ich beim Hinausgehen gemurmelt. „Raus mit Ihnen!“, riefen Sie.
Sie hatten mich überrollt. Auf dem Gang hab ich mir dann Luft gemacht. „Ihr seid doch einer wie der andere!“, hab ich geschrien. Genauso wie ich das immer wieder von Rentnern gehört hatte, die sich über irgendetwas aufregten und dabei mit ihren Gehstöcken in die Luft stachen. Gleichzeitig wusste ich aber, dass ich es nicht überziehen durfte, denn rausgeworfen werden wollte ich ja nicht.
Ich setze mich auf mein unbequem hohes Bett und ziehe mir den rollenden Nachttisch mit dem einstellbaren Tablett heran. Ach, wie gern hätte ich jetzt die kleine Hand meiner Mutter gehalten und ihr einen Kuss auf die Stirn gegeben. Sie trägt die dunkelblauen Sandalen, die sie immer anhatte, auch jetzt, im Grab, unter der Erde unter der Birke, aus der winzige Samenblättchen auf mich herabgeregnet waren, als ich zuletzt auf dem Friedhof war. Es muss im Herbst gewesen sein, vielleicht Allerseelen, El día de los muertos, und ich denke an ein Foto, das ich mal gesehen hatte: Ein alter kaputter Mexikaner sitzt da neben dem Grab seiner geliebten Frau und wartet darauf, dass sie für ein paar Stunden zu ihm zurückkehrt.
Absichtlich langsam – nur nicht zu gesund wirken! - bin ich zurück zum Aufenthaltsraum geschlurft. Alle saßen noch genauso da wie vor einer Stunde. Sitzen auch jetzt noch so da. Teilweise mit geschlossenen Augen – wie Filmstars, die daran leiden, dass alles vorbei ist, unwiederbringlich, dass ihr Ruhm vergessen ist und nichts mehr kommt. Auf jeden Fall geht der Zauber der Weihnachtszeit allen am Arsch vorbei - an unseren plattgesessenen Ärschen. Ein graugesichtiger Patient starrt schon seit Stunden auf den kleinen blinkenden Weihnachtsbaum in der Ecke. Vielleicht erinnert ihn das Ding an seine glückliche Kindheit. Unwahrscheinlich. Eher denkt er, eine höhere Macht wolle ihm eine Nachricht zukommen lassen. Er kann sie aber nicht verstehen. Oder er denkt, der Tannenbaum sei sein eigenes Hirn, in dem die paar Synapsen immer im gleichen, wahnsinnig machenden Rhythmus feuern.
Doch plötzlich steht da so eine Art Drag Queen im Raum und sagt mit rauchiger Barsängerinnenstimme „Hallo, ihr Hübschen“. Dunkelbraune, glänzend-glatte, bauschige Perücke, lackroter Mund, grün glitzernde Augenlider, Wimpern wie Bambi, markante Wangenknochen … Sie ist groß und zeigt mir ihren Riesen-Jeanshintern, als sie sich zur Gurke hinunterbeugt und ihr ein Küsschen gibt. Als sie sich aufrichtet, scheint sie ihren großen Busen wieder in der Bluse unterbringen zu müssen. Sie sieht aus wie ein Hispano, der sich als überreife Beauty Queen verkleidet hat. Mit Pilzkopffrisur und Plateauschuhen total Ende Sixties. Sie sieht die Gurke an und flüstert melodiös „the power of love …‘, woraufhin die Gurke irgendwie erwacht und schleppend „a voice from above“ krächzt. „Cleaning my soul“, haucht die Nightclub-Lady, nimmt ihren Freund an den Händen und zieht ihn langsam zu sich empor. Sie fasst ihn an der Taille, die Gurke macht gar keine schlechte Figur, und gemeinsam wiegen sie sich im imaginierten Song. „Love is like an energy“, singt plötzlich die Raquel-Welsh-Bombe und dann tanzen die beiden hinaus.
Als ich später in unser Zimmer komme, sitzen sie am kleinen Tisch und spielen Karten. Ich wasche mir im Bad die Hände. „Schaust du nicht gern in den Spiegel?“, fragt Raquel, die mir wohl zugesehen hat. Ich gehe zurück, schaue in den Spiegel und erschrecke. Ich hätte es besser wissen müssen! Ich sehe genauso aus wie der abgehalfterte Schrumpfkopf Sinatra in ‚Tony Rome‘ – Scheiße! „Komm, wir hübschen uns ein bisschen auf, Mehdi“, sagt Raquel jetzt unternehmungslustig. Die beiden gehen ins Bad, schließen sich ein und ich höre sie kichern. Ich lege mich aufs Bett und erstelle im Kopf eine Liste der besten Disco-Songs. Mir fallen nur sieben ein: 7 Grace Jones: Pull up to the bumper, Baby – 6 Boney M: Daddy Cool – 5 Sylvester: Уou make me feel … - 4 Tina Turner: Nutbush City Limits 3 Broken Bells: Holdin‘ On For Life 2 Candi Staton: Υou are the love und die klare Nummer 1, absolut unwiderstehlich: Bee Gees: Stayin‘ Alive. Ich summe gerade den Falsett-Part, als die beiden wieder rauskommen. Unglaublich! Die Gurke ist völlig verändert, das Gürkchen ist zum Gherkin mutiert. Seine Freundin hat ihn auf Pumps gestellt, ihm die lockigen Haare gekürzt, seine großen Kulleraugen mit Kajal umrandet, ihm ein tailliertes Oberteil übergestülpt. Die Gurke sieht sehr gut und sehr intensiv aus. Vielleicht ist ihr auch ein Pillchen verabreicht worden, denn sie strahlt plötzlich, schwingt ihre Hüften, wackelt mit dem Po, hat den Swag …
Die beiden tanzen mich an. Und für eine Minute vergesse ich das Klinikzimmer, den Geruch nach Reiniger - sehr giftig für Wasserorganismen wie Guppys und Nixen, zum Beispiel - , die abgestandene Luft, das Neonlicht, das die Balken über dem Kopf der Betten an die Wände strahlen und das sich zur Decke hin im Grau verliert, die spiegelnden Glasscheiben, die nur das Bild der Gegenstände, Nachtschränke, Betten, eins mit Galgen, zurückwerfen, dabei ist in der Schwärze hinter den Scheiben das Leben, die Freiheit, die Welt. Doch nun ist all das einen Augenblick lang auch hier im Zimmer und mich erfasst die Sehnsucht, mich fallen zu lassen, aufgefangen zu werden von dieser voluptuösen Queen, ihre Wärme zu spüren, von ihr umarmt zu werden, meine Nase in den duftenden Stoff ihres Tops zu drücken, die Augen zu schließen in einem Walzerwirbel … Und tatsächlich umarmt sie mich, zieht mich an sich - ist das ein echter Busen, dessen Weichheit und Wärme ich an meiner Brust fühle? Meine Beine werden wacklig, ich knicke in den Knien ein, aber ihre großen Hände stützen mich im Rücken, heben mich zu ihr und drücken mich wieder an sie, so dass mein Gesicht sanft auf einer ihrer Schultern, mit dem Kinn in der Kuhle über ihrem Schlüsselbein zu liegen kommt und an ihrem Haar vorbei sehe ich das glückliche Gesicht Mehdis, der mit sich selbst tanzt, sich die Hände auf die wiegenden Hüften legt, versunken in den Moment wie ich.
Diese Seiten über die Gurke werde ich natürlich nicht abgeben. Die kriegt keiner hier zu sehen. Es wäre für uns beide nicht gut. Aber worüber soll ich sonst schreiben? Wie kriege ich die Seiten hier voll, so dass dieser erloschene Vulkanier Mr Spock alias Sprock Ruhe gibt? Über meine Zeit in Sarahs Wohnung will ich nichts sagen. Und ich hab auch keine Lust, von der Fahrt nach Madrid zu erzählen. Ich streich einfach alles - vom Besuch beim Stationsarzt an bis hierher. Stattdessen knall ich irgendwas anderes hin, was mir gerade einfällt. Den letzten Satz muss ich natürlich auch streichen.
Die US-Briefmarke ‚Old Faithful‘ ist von 1972 und aus der Serie National Parks Centennial. Sie ist ein Hochformat, etwa viereinhalb mal drei Zentimeter groß und hat den Standardwert 8 Cents. Sie zeigt die Fontäne des Geysirs im Υellowstone Nationalpark als Stichtiefdruck in den Hauptfarben Hellblau, Weiß und Hellgrau. Die Eruption wird von drei beieinanderstehenden Personen im Vordergrund betrachtet, die angesichts der riesigen Dampfwolke sehr klein wirken. Die Marke erinnert mich an meinen Besuch im Nationalpark. Ich hatte mit einem Freund in einem Zelt übernachtet. Da es in der Gegend Braunbären gab, hängten wir unsere Nahrungsmittel über Stangen, die zwischen den Baumstämmen angebracht waren. In der Nacht regnete es. Am Morgen war es kalt und unsere Turnschuhe waren völlig durchnässt. Frierend standen wir an der kaum befahrenen Straße. Schließlich nahm uns eine kleine Familie in einem alten Bully mit. Sie waren sehr nett und in der Wärme waren unsere Schuhe nach ein paar Stunden halbwegs trocken.
Nein, über meine Erlebnisse in Madrid schreibe ich nichts.
Schon immer hatte ich eine Schwäche für französische Bulldoggen. Ich mag ihre platt gedrückten Gesichter mit den spitz hochstehenden Fledermausohren. Ihr kräftiger Rumpf mit der breiten, oft gefleckten Brust, wird von kurzen krummen Beinen getragen und läuft in einem Schwanzstummel aus. Eine französische Bulldogge wiegt bis zu 15 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von bis zu 40 Zentimetern. Sie ist kompakt und muskulös, ein guter Familienhund, freundlich, zutraulich und verspielt. Sie ähnelt einem Mops, ist aber größer und hat vor allem einen im Verhältnis viel größeren Kopf. Wie alle Hunde schnüffelt sie gern am Hintern anderer Hunde, um herauszufinden, wie es um den anderen steht. (Letzten Satz streichen!)
Später, als wir wieder allein sind, zeigt Mehdi mir, was ihm seine Freundin geschenkt hat: eine fremdländische Streichholzschachtel, Fósforos ‚La Imperial‘, mit dem Bild eines blauen Raben drauf, grünen Blättern vor blauem Himmel, Hecho en México, und im Rumpf des Raben sind die Buchstaben EERS eingezeichnet, man soll einen Namen daraus bilden, Raquel sagt, es heißt ‚eres‘ - ‚du bist.‘ Mehdi zeigt mir, dass man das Schächtelchen aufklappen kann wie ein Fenster, dann sieht man drei Figuren in einem winzigen Raum sitzen. Es ist das heilige Paar mit dem Jesuskind im Stall. Die Personen sind wohl aus Plastilin geformt, sie wirken sehr echt, und durch ein Fensterchen in der Wand hinter ihnen sieht man auf eine dunkle Landschaft unter lapislazuliblauem Sternenhimmel. Ein kleines Wunder - und wir beide sitzen ein paar Minuten nebeneinander auf der Bettkante und schauen in die Streichholzschachtel.
Ich flieg über die Erde, mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, ich habe keine Flügel, ich fliege einfach, ich kann nicht stoppen, über eine Stadt, ich sehe von oben auf die Dächer, die