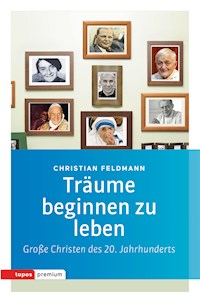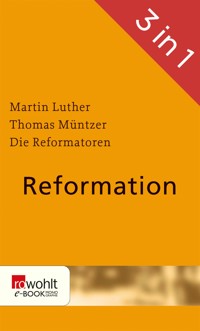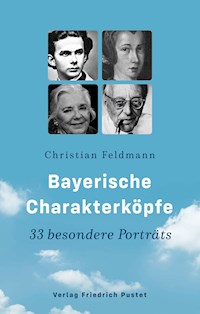
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum war Oskar Maria Graf alles andere als ein krachlederner Provinzdichter? Warum verbirgt sich hinter Karl Valentins irrwitzigem Nonsens die höchste Logik? Wie wurde der aufrechte Menschenfreund Ludwig Thoma am Ende zum Volksverhetzer? Warum bekam der Publikumsliebling Walter Sedlmayr eine so einsame Beerdigung? Wie kam es, dass der Machtpoker der Habsburger an der letzten bayerischen Kurfürstin Maria Leopoldine scheiterte? Wie rettete die Sozialpolitikerin Ellen Ammann die bayerische Demokratie – vorläufig – vor Hitler? Weshalb konnte Franz Josef Strauß nie Kanzler werden? Diesen und vielen weiteren Fragen geht der Autor in insgesamt 33 spannenden, nicht selten überraschenden, oft herrlich amüsanten, manchmal auch schockierenden Reportagen aus 1300 Jahren bayerischer Geschichte und Kultur nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Feldmann
Bayerische Charakterköpfe
33 besondere Porträts
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2021 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg
Tel. 0941/920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3276-3
Umschlaggestaltung: Maria Seidel, Teising
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2021
eISBN 978-3-7917-6205-0 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie im Webshop unterwww.verlag-pustet.de
Inhalt
„An diesem Volksstamm kannst zerschellen …!“
Ein Vorwort
„Erst Herzog, dann fast König, zum Schluss Mönch“
Warum Tassilo III. (um 741–um 796) so hoch stieg und so tief fiel
Ein feuriger Elias
Warum der nicht sehr bibelfeste Bruder Berthold von Regensburg (um 1210–1272) zu einem der besten Volksprediger des Mittelalters wurde
Pionier der mündigen Welt
Warum die Regensburger den Wandermönch Albertus Magnus (um 1200–1280) nicht als Bischof haben wollten
„Darum hat sie ertränkt werden müssen“
Warum die unglückliche Liebe zwischen Agnes Bernauer (um 1410–1435) und dem Herzogssohn Albrecht ein schreckliches Ende fand
Schuhmacher und Poet dazu
Wie es der fast noch mittelalterliche Volksdichter Hans Sachs (1494–1576) auf Richard Wagners Opernbühne schaffte
Ketzerprozess gegen einen Bischof
Warum Johann Michael Sailer (1751–1832) in Rom denunziert, aber nicht verurteilt wurde
„Mein Herz hat noch keine Rinde angesetzt“
Wie die letzte Kurfürstin Maria Leopoldine (1776–1848) ihre Bayern vor dem Machtpoker der Habsburger rettete
„Majestät, wer ko, der ko!“
Wie ein einziger frecher Satz den Münchner Lohnkutscher Franz Xaver Krenkl (1780–1860) berühmt machte
Der Vater von Kasperl Larifari
Warum die Münchner Kinder den Grafen Franz von Pocci (1807–1876) so lieb hatten
Ganzheitsmedizin für Leib und Seele
Wie sich der „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp (1821–1897) gegen neidische Ärzte und misstrauische Behörden durchsetzte
Schlösser bauen statt Kriege führen
Warum Ludwig II. (1845–1886) weniger ein Märchenkönig war als eine tragische Figur
„Es war ein Schütz in seinen schönsten Jahren“
Warum der Wildschütz Georg Jennerwein (um 1850–1877) mit nicht mal dreißig Jahren sterben musste
Der Mann, der ganz München untertunneln ließ
Wie Max von Pettenkofers (1818–1901) irrige Theorie zur höchst segensreichen Praxis wurde
Beruf: Betrügerin
Warum auf Adele Spitzeder (1832–1895) mehr als 30 000 Menschen hereinfielen und warum sie als „Engel der Armen“ galt
Ein weißblauer Shakespeare
Wie der aufrechte Menschenfreund Ludwig Thoma (1867–1921) am Ende zum Volksverhetzer wurde
„Im freien Wald bin ich groß geworden“
Warum die anarchistische Bayerwald-Poetin Emerenz Meier (1874–1928) nach Amerika auswanderte
Freitod statt Land-Idylle
Warum Lena Christ (1881–1920) so viel literarischen Ruhm erntete und doch so unglücklich blieb
Fräulein Parzival
Wie sich die bayerische Kultusbürokratie an der links denkenden Grundschullehrerin Elly Maldaque (1893–1930) rächte
Sprachclown mit Tiefgang
Warum sich hinter Karl Valentins (1882–1948) irrwitzigem Nonsens die höchste Logik verbirgt
Komikerin mit Weinkrämpfen
Warum Liesl Karlstadt (1892–1960) mehr war als bloß die Stichwortgeberin für Karl Valentin
Sozialpolitik auf katholisch
Wie Ellen Ammann (1870–1932) die bayerische Demokratie (vorläufig) vor Hitler rettete
Hitlers populärster Gegner auf der Kanzel
Warum der Münchner Männerseelsorger und Widerstandskämpfer Rupert Mayer (1876–1945) trotz allem eine problematische Figur gewesen ist
Oberpfälzer Don Camillo mit Löwenmut
Wie sich der Dorfpfarrer Johann Nepomuk Kleber (1886–1969) mit hinterfotzigem Witz gegen die braune Diktatur behauptete
Zeugin der anderen Welt
Warum ein Kraftmensch mit Charisma wie die „Resl“ von Konnersreuth (1898–1962) umstritten bleiben wird
„Rassen gibt’s doch bloß beim Vieh“
Warum Oskar Maria Graf (1894–1967) alles andere war als ein krachlederner Provinzdichter
„Das ist ein Aufwachen ringsum im Land!“
Warum Carl Orffs (1895–1982) pralles Musiktheater alles andere als altmodisch ist
Damit der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Warum Bertolt Brecht (1898–1956) so schlechte Manieren hatte
„Ich hab nichts zum Sagen“
Wie die Theaterlegende Therese Giehse (1898–1975) Bühnenhandwerk und Moral verband
„Sag nicht, es ist für’s Vaterland!“
Wie die Geschwister Hans (1918–1943) und Sophie Scholl (1921–1943) von begeisterten Jungnazis zu todesmutigen Widerständlern wurden
Herkules ohne Selbstkontrolle
Warum der geniale politische Stratege Franz Josef Strauß (1915–1988) nicht Bundeskanzler wurde
Eine ausgestorbene Rasse von Politikern
Warum Hermann Höcherl (1912–1989) mehr war als nur ein bayerisches Schlitzohr
Paradebayer und armer Hund
Warum der Publikumsliebling Walter Sedlmayr (1926–1990) eine so einsame Beerdigung bekam
„Weißwurst-Paula“ und KZ-Eichmanns Gattin
Warum die Volksschauspielerin Ruth Drexel (1930–2009) ein politisch bewusstes „Alphatier“ war
Literatur in Auswahl
Bildnachweis
„An diesem Volksstamm kannst zerschellen …!“
Ein Vorwort
„An diesem Volksstamm kannst zerschellen …!“, klagt der ausgeschmierte Tod im „Brandner Kaspar“ über die Bayern, und der muss es wissen. Denn wer kennt die Menschen besser als der Knochenmann, der um das Schicksal jedes einzelnen weiß?
(Er sagt es übrigens nicht in Franz von Kobells 1871 in den „Fliegenden Blättern“ erschienener hintersinniger Geschichte, sondern erst in der Bühnenbearbeitung von Kobells Ururgroßneffen Kurt Wilhelm für das Münchner Residenztheater 1975. Da ist der Himmel schon fest in bajuwarischer Hand und die Pforte für Preußen verschlossen; „sonst war’s ja koa Paradies mehr“.)
Der Stoßseufzer des „Boanlkramers“, wie man den Sensenmann hierzulande lange Zeit plastisch genannt hat („Boanl“ sind Gebeine), könnte zu der irrigen Meinung führen, nur Sturschädel und unbelehrbare Trotzköpfe könnten richtige Bayern sein: Paradeexemplare wie Franz Josef Strauß oder Ruth Drexel, der aufmüpfige Lohnkutscher Franz Xaver Krenkl („Wer ko, der ko!“) oder der politisch unflexible Herzog Tassilo am Beginn der weißblauen Geschichte.
Nun gehören zum bajuwarischen Charakter tatsächlich immer schon das Misstrauen gegen jede Art von Obrigkeit, ein Hang zur Rebellion und ein Hauch von Anarchie. Kraftmenschen, die sich den Schneid nicht abkaufen ließen und sich nicht vor der Macht duckten, hat man hier stets geschätzt – ob es sich nun um den listigen Dorfpfarrer Johann Nepomuk Kleber handelte, der die Nazis mit hinterfotziger Ironie der Lächerlichkeit preisgab, oder um den schneidigen Wilderer Georg Jennerwein, der sich auf das uralte Gewohnheitsrecht der armen Leute berief.
Aber Kraftmensch, Selbstdenker, Charakterkopf – das ist ein Begriff mit vielen Facetten. Schon der „Charakter“ ist doppeldeutig: Ist die ganz besondere Eigenart eines Menschen gemeint, sein Naturell, seine Persönlichkeit? Oder heißt „Charakter“, dass jemand Rückgrat besitzt, Format, Standhaftigkeit, Integrität?
Charakterköpfe müssen keine Helden sein. Auch vordergründig Gescheiterte, tapfer Leidende, verzweifelt sich aus dem Leben Stehlende gehören dazu wie Elly Maldaque, Emerenz Meier, Lena Christ. Leise Rebellen, die ihre Schwäche und Melancholie nicht selten in Kraft verwandeln und uns heute noch inspirieren. Auch versponnene Romantiker wie Ludwig II., der lieber Schlösser bauen als Kriege führen, lieber von Schönheit träumen als intrigante Machtpolitik für eine Dynastie machen wollte.
Und der Autor, ist er überhaupt ein echter Bajuware? Ein Oberpfälzer mit böhmischen Wurzeln bin ich. Biografien von Franzosen und Italienern habe ich geschrieben, von US-amerikanischen Gewerkschafterinnen und jüdischen Talmudgelehrten. Aber am liebsten schreibe ich über meine bayerischen Landsleute.
Einige Gründe dafür finden Sie in diesen Lebensgeschichten.
Regensburg, im Sommer 2021
Christian Feldmann
„Der ehrwürdige, gottesfürchtige und erlauchteste Tassilo, unser verehrter Herzog“ Arbeo von Freising
„Erst Herzog, dann fast König, zum Schluss Mönch“
Warum Tassilo III. (um 741–um 796) so hoch stieg und so tief fiel
Mit seiner sozialen und frauenfreundlichen Gesetzgebung und dem hartnäckig verfochtenen Programm eines politischen Föderalismus habe Herzog Tassilo III. bereits vor mehr als zwölfhundert Jahren den Grund für das neuzeitliche Bayern gelegt. Das behauptete jedenfalls der (oft allzu gewagt spekulierende) Historiker und Journalist Rudolf Reiser 1985 in einem Buch über das Geschlecht der Agilolfinger, dessen bedeutendster Spross Tassilo gewesen ist. Doch der Bayernherzog nahm ein trauriges Ende. 788 steckte ihn der machtlüsterne Frankenkönig Karl mit seiner ganzen Sippschaft in Klosterhaft und zog seine Güter ein. Die Agilolfinger verschwanden aus der Geschichte, und Bayern gehörte jetzt zum Reich.
Im Dunkel hatte die bayerische Geschichte begonnen: mit den Kelten, die hier seit dem fünften vorchristlichen Jahrhundert festummauerte Siedlungen bauten und Handwerk sowie Eisenindustrie zu erstaunlicher Höhe führten. Mit den Römern, die ihre Götter und Mysterienkulte mitbrachten, Obstbäume und Weinbau einführten und ein hervorragendes Straßennetz anlegten. Mit den Bajuwaren, die in mehreren Schüben ins Land kamen – ob aus Böhmen, Ungarn, vom Schwarzen Meer, lässt sich immer noch nicht genau sagen.
Alle diese Volksstämme, Lebensformen und Mentalitäten mischten sich zu einem eigenständigen und eigensinnigen Menschenschlag, der seit dem sechsten nachchristlichen Jahrhundert von den Agilolfingern – dem ersten bekannten deutschen Fürstengeschlecht – beherrscht wurde. Auch deren Herkunft ist ungeklärt. Manche meinen, sie seien aus Burgund gekommen; die Mehrheit der Forscher neigt der These zu, es handle sich um ein fränkisches Geschlecht aus der Merowinger-Dynastie. Die erste ihrer Herzoginnen war eine Langobardin aus Ungarn; sie hatte zwei Ehen mit fränkischen Königen hinter sich, als sie den Agilolfinger Garibald heiratete. Ihr Herrscherhaus drängte die slawischen Nachbarn zurück und betrieb eine ausgedehnte Siedlungs- und Missionierungspolitik.
Chronisten beschrieben Bayern damals als Paradies, „lieblich anzusehen, reich an Hainen“, mit jagdbaren Tieren, Wein, Honig, Salz, Gold und Silber gesegnet, wie Arbeo von Freising schwärmte, Bayerns erster Schriftsteller. „Das Erdreich war fruchtbar und brachte üppige Saaten hervor, in Seen und Flüssen gab es Fische in großer Zahl, (…) das Bergland war ergiebig an Obst und bot Weiden und saftiges Gras.“
Von Anfang an stand dieses von den Agilolfingern geführte Wunderland in einem vibrierenden Spannungsverhältnis zum aufstrebenden Frankenreich. Zwar hatte der erste Merowinger, Chlodwig, viel für die Missionierung des bayerischen Raums getan, und die althochdeutsch sprechenden Franken zogen die anfangs noch im römischen Sprachgut verhafteten Bayern in ihren kulturellen Bann. Der erste Agilolfingerherzog, Garibald, war mit der Witwe eines Merowingerkönigs verheiratet.
Doch in Garibalds Familie wird bereits der Konflikt deutlich, der am Ende zur Auslöschung seines Geschlechts führte: Seine Tochter Theodolinde ehelichte den Langobardenkönig Autari in Oberitalien; ihre Enkel und Urenkel wurden dort Könige. Zwei Jahrhunderte lang funktionierte die politische Achse Regensburg – Pavia zwischen Bayern und Langobarden. Sehr zur Empörung der Franken, welche die Langobarden als Todfeinde betrachteten, vor allem seit sie den Kirchenstaat bedrohten, für den die Frankenkönige eine (nicht uneigennützige) Schutzfunktion übernommen hatten.
Herzog von Pippins Gnaden
Und nun schob sich dieser unzuverlässige Partner Bayern als störender Pufferstaat zwischen Frankenland, Langobardenreich und Kirchenstaat und drohte sich der Oberherrschaft der Franken zu entziehen. Die bayerischen Emanzipationsgelüste erreichten ihren Höhepunkt mit dem um 741 geborenen Tassilo III. (der Name ist langobardisch und bedeutet vielleicht „kleiner Dachs“). Sein Onkel und Vormund, der fränkische Hausmeier und spätere König Pippin, wachte mit Argusaugen über die Entwicklung des früh zum Waisen gewordenen Tassilo, schickte seine Spitzel an den Agilolfingerhof in Regensburg – das alte Römerlager am nördlichsten Punkt der Donau war zu einer der bedeutendsten Metropolen im Reich geworden – und ließ Tassilo 757 in der Königspfalz von Compiègne den Vasalleneid leisten.
Tragisch: Tassilo III.
In der ersten überlieferten Lehensübertragung der Geschichte wurde Tassilo bayerischer Herzog von fränkischen Gnaden. Nach fränkischem Brauch habe er seine Hände zwischen die von König Pippin gelegt, berichtet der Geschichtsschreiber Einhard von dieser rührenden Szene. Zu diesem Zeitpunkt hatte der kaum fünfzehnjährige Tassilo bereits die ersten Kampfeinsätze an Pippins Seite hinter sich; im italienischen Pavia hatte er ihn und den Papst in Scharmützeln mit den Langobarden unterstützt; deren König Haistulf hatte sich ergeben, Tribut zahlen und Geiseln stellen müssen.
Doch Tassilo war ganz wild darauf, sich – und sein Land – von der Oberherrschaft der Franken zu emanzipieren. Schließlich galt der Lehenseid von Compiègne nur für Aktivitäten außerhalb Bayerns. Tassilo trat gern mit Zepter und Reichsschwert auf, ließ sich als „höchster Fürst und Herzog“ anreden und betrieb eine eigenständige, ziemlich fortschrittliche Politik: Auf einer in Dingolfing abgehaltenen Synode, zu der er alle bayerischen Bischöfe und Äbte versammelte, erließ er ein Gesetz, das jeder Frau – zum ersten Mal im Reich – die sofortige Scheidung garantierte, wenn sie ihr Mann vor der Hochzeit über seine Vermögensverhältnisse getäuscht hatte.
Eine Ehefrau, deren Gatte sein Eigentum verlor, wurde in diesem Gesetz außerdem vor dem Verlust ihrer Rechte geschützt. Auch indem er das Eigentum an Grund und Boden genau definierte, sorgte Tassilo für mehr Rechtssicherheit. Die Bildung förderte er, indem er jedem Bischof vorschrieb, eine Domschule – Vorläufer der späteren Universitäten – zu unterhalten. Bischöfen und Äbten schärfte er ein, sich in ihrem Privatleben streng nach den Kirchengesetzen beziehungsweise Ordensregeln zu richten. Auf einer weiteren Synode in Neuching bei München, in der Nähe von Erding, erleichterte Tassilo das Los der Sklaven, die es damals auch noch in Bayern gab.
Seine Klostergründungen dienten der Förderung von Glauben und Kultur gleichermaßen. Das erste Projekt ist vermutlich die Abtei Benediktbeuern am Fuß der Benediktenwand gewesen, die schnell durch eine hervorragende Predigtsammlung berühmt wurde. Die ersten Äbte hatten eine rührige Schwester, Gailswind, die in der Nähe das Frauenkloster Kochel errichtete und als Äbtissin zur Blüte führte. Innichen im Pustertal, Polling, Thierhaupten gehen auf Tassilo zurück, Gars am Inn und Metten in Niederbayern, vor allem aber Wessobrunn (wo eine Tassilo-Linde an ihn erinnert und an seinen Jäger Wezzo, der hier eine heilkräftige Quelle entdeckt haben soll) und Kremsmünster, das als Stützpunkt der Mission nach Osten gedacht war. Hier hütet man heute noch den kostbaren „Tassilokelch“, den englische Goldschmiedemeister zwischen 764 und 768 für seine Hochzeit mit der Langobardin Liutbirga gefertigt haben. Der Abendmahlskelch zeigt Christus, die vier Evangelisten und (vermutlich) Johannes den Täufer, den gemeinsamen Patron der bayerischen und langobardischen Herrscherhäuser – und die Inschrift „Tassilo dux fortis – Liutpirc virgo regalis, Tassilo, der starke Herzog, und Liutbirga, die königliche Jungfrau“.
In Gottes Namen, ich, Tassilo, Herzog der Bayern, schenke und übergebe von dem Gedanken an Gottes Barmherzigkeit und die ewige Seligkeit durchdrungen, mit starker Hand und unter Zustimmung der Mächtigsten aus Bayern, den Ort India, der im Volksmund Gelau heißt, dem Abt Atto (…) zu Bau und Unterhalt eines Klosters; vom Taistnerbach bis zur Slawengrenze, das heißt zum Erlbach, schenke ich alles ganz und gar, Gefilde und Gebirge, Weide und Jagd, Moos und Au, was immer zu diesem Ort gehört, sodass kein Mensch-in Zukunft sich unterfangen soll, unter was für einem Vorwand oder Anspruch auch immer, diesen Ort und seine Bewohner (…) zu beunruhigen. Darum habe ich eigenmächtig, so gut ich konnte, in Gegenwart meiner Richter und Vornehmsten, den Anfang der Buchstaben dieser Handschrift nachgebildet. Wir wissen auch, dass diese Gegend seit alter Zeit öd und unbewohnt ist, darum habe ich das demütige Bitten erhört und damit das ungläubige Volk der Slawen auf den Weg der Wahrheit geführt werde. Geschehen in Bozen, bei der Rückkehr aus Italien.“
Klostergründungsurkunde für Innichen im Pustertal, 769
Kremsmünster erinnert allerdings auch an einen ersten schweren Schicksalsschlag in Tassilos tragischem Leben: Gemeinsam mit seinem Sohn Gunther soll er dort im Gebiet der Enns gejagt haben; Gunther hatte es auf einen mächtigen Eber abgesehen, den er in einem wütenden Zweikampf erlegte. Doch das Wildschwein hatte ihn so schwer verletzt, dass er verblutete. Gunthers treuer Hund führte den Vater zur Leiche, und der soll so erschüttert gewesen sein, dass er spontan hier ein Kloster zu errichten versprach. Tatsächlich birgt die Klosterkirche einen wunderschönen, ein halbes Jahrtausend später gestalteten Epitaph für Sohn Gunther.
Gescheiterte Friedensinitiative
Zu einem ersten Affront war es gekommen, als Tassilo 763 seinen Onkel Pippin bei dessen Feldzug gegen die an der Loire siedelnden Aquitanier unterstützen musste – die peinlicherweise mit Tassilos Vater verbündet waren – und mitten im Krieg das Schlachtfeld mit seinen Truppen verließ. Glatte Fahnenflucht, obwohl er sich darauf berufen konnte, dass daheim an der bayerischen Ostgrenze wieder einmal Attacken der Awaren drohten. Pippin plante einen Rachefeldzug, Tassilo bat den Papst um Vermittlung, Pippins plötzlicher Tod löste das Problem – scheinbar.
Tassilo schloss ein Bündnis mit den Langobarden, heiratete deren Prinzessin – und schöpfte Hoffnung, als sein Cousin Karl (der spätere Karl der Große), Pippins Sohn, eine Schwester Liutbirgas zur Frau nahm und Pippins Witwe Bertrada die Aussöhnung zwischen Franken und Langobarden betrieb. Bertrada, Tassilos Tante, stattete ihm in seiner Regensburger Herzogspfalz einen Besuch ab und wurde herzlich empfangen. Doch Karls Bruder Karlmann und der die Langobarden wie den Teufel fürchtende Papst machten die Friedensinitiative zunichte, es gab neue Feldzüge, heimtückische Morde.
Der auf Unabhängigkeit bedachte Bayernherzog geriet immer stärker ins Visier der misstrauischen fränkischen Führung. Es half ihm wenig, dass er den Aufstand der Osttiroler Karantanen im Auftrag Karls bravourös niedergeschlagen hatte und von begeisterten Klosterchronisten mit Kaiser Konstantin verglichen worden war. 781 wurde er vor die Reichsversammlung in Worms geladen, wo er seinen Vasalleneid erneuern musste. Als er auch noch unter den bayerischen Adeligen und Bischöfen auf zunehmende Opposition stieß, suchte Tassilo in Panik und völliger Verkennung der politischen Realitäten den Schulterschluss mit den Hunnen, den Todfeinden des fränkischen Reiches. Damit war sein Schicksal besiegelt. Karl – der sich jetzt etwas angeberisch „König der Franken und Langobarden“ nannte – rüstete zum Krieg gegen Bayern. Tassilo flehte ihn um Gnade an, bekam Verzeihung gewährt, unter demütigenden Bedingungen, er musste Karl die Füße küssen und ihm sein Zepter überreichen – und schon nahm er erneut Verhandlungen mit den Hunnen auf. Obwohl er Karl zwölf Geiseln gestellt hatte, darunter seinen eigenen Sohn.
788 wurde er auf der Reichsversammlung von Ingelheim entwaffnet, verhaftet und wegen des Bündnisses mit den Reichsfeinden und der ein Vierteljahrhundert zurückliegenden Fahnenflucht zum Tod verurteilt; die wütendsten Ankläger gehörten dem bayerischen Adel an, der sich bei König und Papst einschmeicheln wollte. Karl wandelte die Todesstrafe generös in dauernde Klosterhaft um und verbannte den Herzog zunächst nach St. Goar und dann nach Jumièges an der Seine. Auch Liutbirga und Tassilos vier Söhne und Töchter verschwanden für immer hinter Klostermauern, in Trier, in Chelles, in Laôn, damit sie keinen Kontakt miteinander aufnehmen konnten.
Nach 792 ist Tassilo gestorben, angeblich im Kloster Lorsch an der Bergstraße. Seine Bayern liebten ihn bis zuletzt, trotzig tauften sie ihre Kinder auf die Namen der Verbannten. Tassilos Standbild in seiner stolzen Gründung Kremsmünster trägt die melancholische Inschrift: „Tassilo, zuerst Herzog, dann fast König, zum Schluss Mönch.“
„Herr Papst, wärt Ihr hier, ich getraute mich wohl, Euch zu sagen …“
Ein feuriger Elias
Warum der nicht sehr bibelfeste Bruder Berthold von Regensburg (um 1210–1272) zu einem der besten Volksprediger des Mittelalters wurde
Er war der prominenteste deutsche Volksprediger des Mittelalters. Einen „feurigen Elias“ nannte man ihn oder die „leuchtende Fackel“. Wo er auftauchte, strömten die Menschen in Scharen zusammen. Der Bauer ließ die Ochsen vor dem Pflug stehen und der Metzger seine Schinken unter dem Rauchfang liegen. „Seit den Aposteln bis auf unsere Tage“ sei ihm niemand gleichgekommen, zumindest in deutschen Landen, schwärmt der italienische Geschichtsschreiber Salimbene de Adam in seiner nach 1280 entstandenen sehr unterhaltsamen Chronik:
„Wenn er über das Jüngste Gericht predigte, da zitterten alle so, wie die Binse zittert im Wasser. Und sie baten ihn um Gottes willen, über dieses Thema nicht zu predigen, weil sie fürchterlich und schrecklich Not litten, wenn sie ihn anhörten.“
Dass Kirchen und Basiliken Bertholds Publikum nicht fassen konnten, dass er auf Baumkanzeln und Holzgerüsten reden musste, ist gut bezeugt – ebenso wie die massive Erschütterung, die diese Ansprachen auslösten. Hartgesottene Sünder bekehrten sich, erbitterte Feinde fielen einander weinend in die Arme, Patrizierinnen und Edelhuren trennten sich von ihren Juwelen. Das zumindest hatte der Wanderprediger Berthold mit seinem großen Vorbild, dem durch Galiläa ziehenden Rabbi Jesus, gemeinsam: Beide veränderten nicht unbedingt die Welt, aber die Lebensläufe einzelner Menschen, und zwar radikal.
Franziskus und die Arroganz der Gelehrten
Bertholds Geburtsdatum liegt irgendwann zwischen 1200 und 1210; es sind die Jahre, in denen Franziskus durch Umbrien wandert und seine Kirche einlädt, dem armen Christus wieder mehr zu vertrauen als der Herrschaftssicherung durch Besitz und Waffen. Wo Berthold zur Welt kam, wissen wir nicht, manche nehmen an, in Regensburg. Familienname, Elternhaus, Beruf des Vaters: unbekannt. Um 1226, zwei Jahre nach dem Tod des bezaubernden Francesco von Assisi, soll er in dessen Orden eingetreten sein, in Regensburg vermutlich.
Charismatisch: Bruder Berthold von Regensburg
Damals hatten die Franziskaner hier gerade vom Bischof Konrad ein altes Kirchlein und ein Wohnhaus geschenkt bekommen und eine ihrer ersten deutschen Niederlassungen gegründet. Das Volk nannte die ohne Schuhe durch die Straßen eilenden Mönche respektlos „Barfüßer“. Sie selbst bezeichneten sich etwas seriöser als Minoriten, „mindere Brüder“.
Seine Ausbildung absolvierte Berthold wohl in Magdeburg, wo die Franziskaner ein sehr anspruchsvolles Studienzentrum für Philosophie und Theologie aufbauten. Die so schlicht auftretenden Minderbrüder hatten nämlich vor, sich auf Predigt und Seelsorge in den Städten zu spezialisieren. Francesco selbst freilich hatte die Arroganz der Gelehrten wie die Pest gefürchtet.
Berthold jedenfalls erwarb sich ein solides Wissen, das zeigen die Anspielungen in seinen späteren Predigten. Wahrscheinlich ging er in Magdeburg bei dem hochgebildeten Engländer Bartholomaeus Anglicus in die Schule, der Naturwissenschaft und Astronomie streng sachlich vermittelte, ohne die damals üblichen weitschweifigen Allegorien.
Dort in Magdeburg hat Berthold möglicherweise einige Jahre als Lektor gewirkt, bevor er zu predigen begann. 1246 wird er als Visitator des Regensburger Damenstifts Niedermünster erwähnt: Die vornehmen Fräulein lebten hier zwar nach der Regel des heiligen Benedikt; deren Strenge war aber durch eine Menge Freiheiten gelockert, und die kirchliche Obrigkeit fand es angebracht, von Zeit zu Zeit nach dem Rechten zu sehen. Berthold als Klostervisitator – das setzt voraus, dass er ein erfahrener Ordensmann von untadeligem Ruf war und von der Bistumsleitung geschätzt wurde.
„Habgieriger, wie gefällt dir das?“
Von jetzt an beginnen die Quellen zu fließen. Wir wissen, dass Berthold zwischen 1250 und 1265 rastlos unterwegs war. In Niederbayern, in Speyer, Pforzheim und Augsburg hat er gepredigt, im Elsass und in der Schweiz, in Österreich, Böhmen und Schlesien, Thüringen und Ungarn. Es war die „kaiserlose, schreckliche Zeit“ des Interregnums, als Bürgerkrieg, Faustrecht und Straßenraub die Szene beherrschten. Fürsten und Adelige bekämpften sich auf Kosten der unteren Schichten, eine korrupte Justiz bot keinen Schutz. Doch auch eine frisch aufgebrochene religiöse Sehnsucht gehört zur Epoche, mit Alternativmodellen zur machtverkrusteten Kirche in neuen Frömmigkeitsformen und Gemeinschaften – und mit Aberglauben, Wundersucht und wilden apokalyptischen Ängsten.
Bertholds Namen scheint man bald in halb Europa gekannt zu haben. Er predigte meist im Freien, von der Stadtmauer oder von einem hölzernen Turm herunter. Salimbene de Adam: „Auf dessen Spitze wurde eine Fahne aufgepflanzt, um festzustellen, aus welcher Richtung der Wind wehte und wohin das Volk sich setzen sollte, um am besten zu hören.“ Bisweilen sind es solche technischen Details, die den begnadeten Redner verraten.
Wenn Berthold oben auf seiner Linde oder seinem Holzturm wie auf einer Kanzel stand und das Volk sich auf einer weiten Wiese ringsum lagerte, hatte er die schönste Kulisse für seine breit ausgemalten Gleichnisse. Die furchterregende Begegnung mit dem Satan schilderte er, als entwerfe er ein Bühnenbild:
„Und wäre es so, dass man den Teufel möchte sehen mit fleischlichen Augen, dass man vor Grauen nicht stürbe, und dass er jetzt dort her ginge aus dem Wald, und es stünde hier vor uns ein glühender Ofen, es gäbe das allergrößte Gedränge in den glühenden Ofen, das die Welt je sah …!“
Bertholds Predigten müssen eine unglaubliche Suggestivkraft entfaltet haben – was sicher vor allem an ihrer Drastik und ihrem Bilderreichtum lag. Gebannt lauschten die Zuhörer, wenn Berthold sich über die scheinbar frommen Anstrengungen eines notorischen Geizhalses lustig machte und dabei die feine Ironie Schritt für Schritt mit wütender Anklage vertauschte. Er soll nur das Kreuz nehmen und ins Heilige Land pilgern, der Geizkragen, es wird ihm nichts nützen:
So nimm das Kreuz, welches der Papst gibt, und nimm dazu das Kreuz, an dem der gute Schächer hing, und nimm des Sankt Andreas Kreuz und Sankt Peters Kreuz – das sind alles gar gute Kreuze – und dazu nimm das Kreuz, an welchem Gott als Mensch selbst starb, und führe die Kreuze alle übers Meer und erschlage Heiden und Tataren, und lass dich im Dienste Gottes erschlagen, und lass dich in das Grab legen, in welchem Gott selbst lag, und lass auf dich legen die heiligen Kreuze allesamt, und lass Gott selbst und Sankt Maria und die vier Evangelisten und die heiligen Apostel zu deinen Füßen und zu deinem Haupt stehen und alle Gottes Heiligen neben dir, und nimm den heiligen Leib Gottes in deinen Mund, und du bist nur acht Pfennige schuldig, die hast du als unrechtes Gut, und du weißt wohl, wem du sie schuldig bist, und magst sie nicht zurückerstatten und wiedergeben: Ihr Teufel, kommt her im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und zerrt ihm seine Seele aus dem Leib und führt sie in die ewige Marter, wo dir nimmermehr Rat wird. Sieh, Habgieriger, wie gefällt dir das?“
Woher bezogen diese Predigten ihr Charisma? Von Ohnmachten und lauten Schuldbekenntnissen berichten die Chronisten, manchmal klingt es nach einem Ausbruch von Massenhysterie. Todfeinde versöhnten sich – wie lange der Friede anhielt, wissen wir natürlich nicht –, Diebe und Raubritter brachten zurück, was sie gestohlen hatten. Als Berthold 1256 im schweizerischen Graubünden über Habgier und Machtmissbrauch sprach, soll er den Ritter Albert von Sax so beeindruckt haben, dass der dem Kloster Pfäfers das Schloss Wartenstein zurückgab, welches er sich widerrechtlich angeeignet hatte.
Manche Notizen in den alten Chroniken lesen sich wie Szenen einer Seifenoper: Da steht mitten in so einer donnernden Moralpredigt eine Frau auf, die für ihren lockeren Lebenswandel bekannt ist, beginnt hemmungslos zu schluchzen und gelobt, auf der Stelle ein neues Leben zu beginnen. Der Franziskaner, der wohl weiß, dass gute Vorsätze nicht immer lange halten, packt die Gelegenheit beim Schopf. Er fragt in die Runde, wer die bekehrte Sünderin zum Weib nehmen wolle. Tatsächlich meldet sich ein Bräutigam, und noch bevor die Predigt beendet ist, hat man unter der begeisterten Zuhörerschaft zehn Pfund Silberpfennige als Mitgift gesammelt.
Virtuoser Erzähler
Bruder Berthold, der Wundermann, hat auch keine bessere Predigttechnik als die übrigen Bettelmönche. Theologisch ist er ganz gut beschlagen, aber die Bibel zitiert er oft schlampig oder schlicht falsch, er wirft Personen und Fakten durcheinander oder dichtet nach eigenem Gusto dazu. Worin liegt dann das Geheimnis seines durchschlagenden Erfolgs?
Es ist das unnachahmliche persönliche Flair seiner Rede. Es ist die Farbe seiner Bilder, die lebendige Kraft seiner Sprache, die Anschaulichkeit seiner Gleichnisse. Es ist die Virtuosität, womit er eine bunte Vielfalt von Stilmitteln zu bändigen weiß, mit Fantasie, Humor, Lust am Erzählen, nicht ohne boshaften Sarkasmus, manchmal derb, dann wieder charmant, zart lockend und plötzlich in ein Donnerwetter ausbrechend, nicht jedes Mal tiefschürfend in seinen Gedanken, aber immer interessant, häufig von epischer Breite, aber nie langweilig.
Schon die Überschriften, die Bertholds Predigten in den ältesten Sammlungen tragen, machen neugierig: „Von sechs Mördern.“ – „Von zehn Chören der Engel und der Christenheit.“ – „Von zwölf Junkern des Teufels.“ Titel wie Schlagzeilen. „Von des Leibes Siechtum und dem Tod der Seele.“ – „Von rufenden Sünden.“ – „Von achterlei Speise im Himmelreich.“ Die Methode, den Predigtinhalt eingängig aufzulisten, teilt Berthold mit vielen Volkspredigern des Mittelalters bis hin zu Martin Luther.
Langweilig wird dieses Aufzählen nie. Wie ein geschickter Dramaturg beherrscht Berthold den Wechsel von behäbigen Schilderungen und stoßweisen Attacken, reiht er zauberhafte Bilder und Schreckensvisionen aneinander, inszeniert er von der Kanzel herab spannende Dialoge. Er kündigt an, etwas enorm Wichtiges sagen zu wollen, zögert den entscheidenden Satz dann aber so geschickt hinaus, dass sein Publikum bloß noch atemlos auf die erlösende Information wartet.
Berthold arbeitet mit Übertreibungen und grellen Kontrastwirkungen, er führt auf seiner Baumkanzel komplette kleine Dramen auf wie in seiner Predigt vom Jüngsten Gericht: Da lässt er einen eben Gestorbenen auftreten und die Qual des Sterbens beschreiben, die Teufel debattieren am Totenbett über ihren Anspruch auf die Seele, und Gott selbst fordert den armen Sünder zur Rechenschaft auf, was der Prediger wiederum mit beschwörenden Mahnungen an die Zuhörer kommentiert. Berthold-Experten sind sicher, dass er solche Reden wie ein Schauspieler vorgetragen hat, die einzelnen Rollen mit unterschiedlichen Stimmlagen und dramatischen Gesten verkörpernd.
Mancher läuft hin nach (Santiago de) Compostela zu Sankt Jakob (…). Nun, was findest du in Compostela? Da findest du Sankt Jakobs Haupt. Das ist sehr gut; doch ist es ein toter Schädel, der bessere Teil ist im Himmel. Nun, was findest du hier zu Hause bei deinem Hofzaun? Wenn du morgens in die Kirche gehst, dann findest du den wirklichen Gott!“
Und dann diese Fülle von Bildern! Wunderschön illustriert Berthold den Glaubenssatz von der Auferstehung der Toten: „In der Auferstehung wird die Seele einen Leib haben, lichter als der Sonnenschein, schneller als der Augenblick, beweglicher als die Luft.“
Die ziemlich abstrakte Lehre von der Dreifaltigkeit erklärt er so, dass ja auch Friedrich II. gleichzeitig römischer Kaiser, König von Deutschland und Herzog von Schwaben sei, ein und derselbe Mensch, der lediglich verschiedene Funktionen ausübe. Genauso seien Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht drei Götter, sondern ein einziger Gott.
Und dann geht die Kanzelrede auf einmal in ein fast intimes Zwiegespräch mit einem armen Sünder über, der Franziskaner greift fiktive Einwände auf, stellt kritische Fragen und gibt sogleich selbst die Antwort, oder er wendet sich direkt an irgendeine Gestalt aus der Bibel oder ruft die Engel oder auch die Teufel zu Zeugen an. Er kann sanft schmeicheln, besonders wenn er die Frauen anspricht, die gewiss lieber beten als die Männer – und er kann dreinfahren wie ein Fuhrknecht: „Pfui Kupplerin, du Lockpfeife des Teufels, damit er manche Seele fängt!“ – „Pfui Fresser!“ – „Pfui Geizhals, wie hart dein Amen vor Gottes Ohren, wie Hundegebell!“
Anders als viele todernste Bußprediger seiner Epoche verfügt Bruder Berthold über einen bärbeißigen Humor. Die triviale Vorstellung, Gott sitze in seliger Muße droben im Himmel und lasse die Beine auf die Erde herunterbaumeln, pariert er mit dem Seufzer: „O weh, lieber Gott, da müsstest du lange Hosen haben!“ Den alten Leuten wirft er gern an den Kopf, sie sollten sich bloß nichts einbilden auf ihre Tugendhaftigkeit; zu Sünden wider die Keuschheit seien sie schlicht nicht mehr rüstig genug: „Ihr altes Gebein hat ausgehüpft, und jetzt denken sie daran, was sie in der Dummheit getan haben, und bereuen es oft mehr, als billig und ziemlich wäre.“
Warum gibt es so viele Arme?
Mit seiner Realistik, seinem aufmerksamen Blick für die Alltagswelt erhebt sich der Prediger Berthold weit über den Durchschnitt seiner Kollegen, die sich in der Regel auf das saft- und kraftlose Herbeten der Kirchenväter beschränkten. Darum waren die Germanisten um Jacob Grimm hell begeistert, als sie diese frische, unverwechselbare Stimme vor zweihundert Jahren wiederentdeckten.
Umso größer der Schock, als sich Bertholds Prosa als Produkt irgendwelcher anonymer Bearbeiter entpuppte. Die hatten aus den überlieferten lateinischen Predigtfassungen deutsche Übersetzungen gefertigt – mit den Eigenmächtigkeiten und Unschärfen, die zu erwarten sind, wenn von einem mittelalterlichen Wanderprediger lediglich verstreute Redensammlungen existieren, und wenn er selbst sich über schlampige Nachschriften beschwert, aber keine autorisierte, letztgültige Ausgabe vorgelegt hat. Man weiß außerdem, dass er mit Vorliebe improvisierte und sich keineswegs an die eigenen Entwürfe hielt. Die 263 über Europa verstreuten Handschriften mit seinen lateinischen Predigten sind Rekonstruktionen, und die deutschen Sammlungen sind wiederum nachträgliche Bearbeitungen dieser Rekonstruktionen.
Sei’s drum, Bruder Bertholds Botschaft ist zeitlos: Christsein, wie er es in seiner von Gewalt und Unrecht geprägten Epoche versteht, ist eine sehr praktische Sache. Reue und Buße müssen Folgen haben, auch soziale. Die Entscheidung für Christus muss das alltägliche Leben verändern, sonst bleibt sie fromme Heuchelei. Wobei Berthold keineswegs nur mit der Hölle droht, sondern eindringlich Gottes leidenschaftliche Liebe zu den Menschenkindern verkündet. Statt ihn ebenso stürmisch wiederzulieben und den Himmel erobern zu wollen, geben die sich aber mit dem bequemsten Weg zufrieden: „Lehre uns, wie wir gemächlich in das Himmelreich kommen!“, mokiert er sich über seine trägen Zuhörer und vergleicht sie mit Kriechtieren.
Wozu ist der Mensch denn auf der Welt? Um Gott lieb zu haben und seine Seele zu bewahren. Barmherzig sollen sie miteinander umgehen, seine Zuhörer. Ein Ehemann darf seine Frau nicht einfach beschimpfen und verprügeln, weil sie ihm untertan zu sein habe, „denn sie hat Gott in ihrem Herzen und deshalb soll sie dir gleich sein.“ Und nur deshalb gibt es so viele Arme, weil die Reichen prassen und saufen und im Luxus leben wollen.
Den Umsturz predigt Berthold nicht – wer tat das damals schon? Aber eine Bekehrung, die auch die Spitzen der Gesellschaft und der kirchlichen Hierarchie nicht ausspart. Seine ungeheure Popularität ermöglicht es dem Franziskaner, dem Kaiser und den Fürsten, den hohen Prälaten und dem Papst in Rom einen Spiegel vorzuhalten. „Herr Papst, wärt Ihr hier …!“, pflegt er solche Standpauken zu beginnen. „Herr Papst, wärt Ihr hier, ich getraute mich wohl, Euch zu sagen: Alle die Seelen, die Ihr dem allmächtigen Gott zugrunde richtet oder die durch Eure Schuld verloren gehen, sofern Ihr’s abwenden solltet und könntet, die müsst Ihr Gott erstatten zu Eurem großen Schaden.“
Was die Päpste nicht daran hindert, Berthold mit so heiklen Aufgaben zu betrauen wie der Kreuzzugspredigt gegen die Waldenser. Die gelten als Ketzer, weil sie eine arme Kirche ohne Hierarchie fordern, den Kriegsdienst ablehnen, Frauen predigen lassen und den Ablass ebenso überflüssig finden wie die Heiligenverehrung. Der Auftrag ist deshalb so heikel, weil er für eine Sache werben soll, an die er selbst nicht glaubt, schlimmer noch: die ihm zuwider ist. Denn für ihn grenzen die von Päpsten und Theologen hochgepriesenen Kreuzzüge an Mord.
„Pfui, Bluttrinker, wo ist dein Bruder?“, hat er den ersten Kreuzrittern zugerufen. Jetzt muss er der Kirchenführung gehorsam sein und Zwang und Gewalt im Namen Gottes legitimieren. Nach eineinhalb Jahren, in Rom ist gerade der Papst gestorben, stellt man ihn endlich von der ungeliebten Aufgabe frei. Als Ratgeber und Schlichter bei Familienstreitigkeiten und politischen Konflikten hat er genug zu tun.
Im Dezember 1272 stirbt Bruder Berthold im Regensburger Minoritenkloster. Seine Gebeine befinden sich im Regensburger Dom, in der Bischofsgruft.
„Gott leitet die Naturdinge durch natürliche Ursachen“
Pionier der mündigen Welt
Warum die Regensburger den Wandermönch Albertus Magnus (um 1200–1280) nicht als Bischof haben wollten
Eigentlich war der gelehrte Mönch Albert aus dem 13. Jahrhundert ein ganz moderner Mensch: Er wollte Christ sein ohne Berührungsängste gegenüber fremden Weltbildern. Er konnte Ideen, die zunächst nicht christlich gewesen waren, dankbar aufnehmen und in seine gläubige Weltsicht integrieren. Leidenschaftlich bemühte er sich darum, Frömmigkeit und kritisches Denken zu verbinden, Treue zur Erde und Liebe zum Himmel. Denn auch die Vernunft hielt er für ein Geschenk Gottes, und seine Spuren entdeckte er überall in der Schöpfung.
Merkwürdig, dass ausgerechnet dieser Beamtensohn aus der tiefsten Provinz eine Pioniergestalt der abendländischen Geistesgeschichte werden sollte! Aufgewachsen ist er in der schwäbischen Kleinstadt Lauingen. Bauern, Winzer, Fischer waren seine Freunde. Über seine Schulbildung wissen wir nichts. Albert stand bereits im vierten Lebensjahrzehnt, da tauchte er plötzlich in den Studentenlisten der italienischen Universität Padua auf.
Ein Examen legte er dort nicht ab, aber er kam in Padua in Kontakt mit den Dominikanern, damals ein Bettelorden, der auf die Predigt spezialisiert war und seinen Leuten deshalb ein theologisches Studium zur Pflicht machte. Die Dominikaner schickten den schon etwas angegrauten Schwaben als Studenten nach Köln. Ein paar Jahre später unterrichtete er bereits, publizierte erste Schriften und bildete in Straßburg den Ordensnachwuchs aus.
Als Lehrer muss er so faszinierend gewesen sein, dass ihn sein Orden um 1244 als ersten deutschen Professor an die berühmte Universität Paris sandte. Der größte Hörsaal war hoffnungslos überfüllt, wenn „Albert der Deutsche“ Vorlesung hielt. Man bewunderte seine verwegene Vorliebe für Aristoteles: Erst kürzlich hatte eine Synode in Paris das Studium von dessen naturphilosophischen Schriften verboten.
Albert ließ sich davon nicht abschrecken. Zu viel, meinte er, war von dem genialen Heiden zu lernen. Er war sich seines Glaubens so sicher, dass er keine Angst vor dem Dialog hatte. Man musste eben genau unterscheiden, was die Vernunft ergründen kann und was man aus Vertrauen auf die Wahrheit Gottes schlicht und einfach glauben muss. Albert: „Zwar handeln Glauben und Wissen vom gleichen Gegenstand, jedoch nicht in der gleichen Hinsicht, und daher entleert das eine das andere nicht.“
Gottes „Verstandeslicht“ erhellt die Welt
Natürlich geht es in der Theologie um mehr als um Erkennen und Wissen. Es geht um das letzte Glück des Menschen, um die Leidenschaft für Gott, die Verstand und Willen mitreißt. Aber lieben kann man nur, was man kennt. Darum nimmt Albert die Ansätze begeistert auf, mit denen der große Aristoteles bereits von einer mündigen Welt spricht und von der Eigengesetzlichkeit der Naturvorgänge.
Als Albert beschloss, sein Bild von der Welt nicht auf das Studium antiker Gewährsleute zu gründen, sondern auf die eigene Erfahrung, setzte er sich damit in Gegensatz zu allen Naturkundigen seiner Zeit. „Das Experiment allein gibt Gewissheit“, hieß sein Motto. „Ein Grundsatz, der vom praktischen Versuch nicht bestätigt wird, ist kein Grundsatz.“ Und: „Es ist nicht genug, zu sagen, das geschieht durch ein Wunder. Wir müssen Rechenschaft geben!“
Deshalb war sich der gefeierte Professor Albert nicht zu schade, eigenhändig das Auge eines Maulwurfs zu sezieren oder durch eigene Geschmackstests herauszufinden, wo der Saft der Bäume am bittersten ist: in der Wurzel nämlich. Deshalb unternahm er ausgedehnte Studienreisen, um in Bergwerken Metalle zu analysieren. In einer Zeit, als den Menschen die ungerodete Natur noch als finstere Bedrohung erschien, staunte Albert, der prächtigste Dom sei im Vergleich zu einem majestätischen Tannenwald doch nur ein wüster Steinhaufen.
Gott ist in der Welt durch Zeichen seiner Gegenwart. Da nämlich der Schöpfer kraft Vernunft und Verstand alles schuf, ist er in der Welt, weil er darin Zeichen seines Verstandeslichtes zurückgelassen hat.“
Die Liebe zur Erde trieb ihm nicht die Sehnsucht nach dem Himmel aus – im Gegenteil. Das eigentliche Wunder war ihm nicht ein spektakuläres Eingreifen Gottes in die natürlichen Abläufe, sondern das ganz alltägliche Funktionieren der Natur nach den sinnvollen Gesetzen, die der Schöpfer in sie hineingelegt hat und die von der menschlichen Vernunft zu erforschen sind.
Der erhabene Gott regiert die Naturdinge und leitet sie durch natürliche Ursachen, und diese suchen wir hier, weil wir die göttlichen – uns nicht so nahe – nicht so leicht finden können.“
Die Natur erhält ihren eigenen Wert zurück – und wird damit entzaubert. Die Menschen haben sie gefürchtet und zum Geisterreich erklärt; jetzt dürfen sie die Natur als Kreatur Gottes, des einzigen Herrn über alle Dinge, bewundern und lieben. Ein Leben lang hat Albert seine Umwelt mit einer fast besessenen Leidenschaft beobachtet. Auch noch, als er in Köln die erste deutsche Hochschule aufbaute und bald darauf zum Provinzial der deutschen Dominikaner gewählt wurde.
Albertus war damals schon ein Sechziger, aber wie ein Wandermönch zog er von Kloster zu Kloster, durch halb Europa: Polen, Frankreich, die Schweiz, die Niederlande, immer zu Fuß. Auf Landstraßen und Ackerwegen, an Flussufern und Meeresstränden machte er epochale Beobachtungen. Als erster Zoologe beschrieb er den Zug der Krähen und die Lebensgewohnheiten von Wiesel, Marder und Haselmaus. Er wusste, dass Spechte von Larven leben, die sie aus der Baumrinde heraushacken, und dass der Uhu eine seiner Zehen nach Lust und Laune vor- und rückwärts bewegen kann. Eigenhändig untersuchte Meister Albert das Verdauungssystem der Bienen; er entdeckte den Bauchnervenstrang bei den Insekten.
Gelehrtes Genie und armer Bettelmönch
Doch „will man fragen nach den tiefsten Geheimnissen Gottes“, mahnte er seine Professorenkollegen, „so frage man nach dem ärmsten Menschen, der mit Freude arm ist aus Liebe zu Gott; der weiß von den Geheimnissen Gottes mehr als der weiseste Gelehrte.“ Ein Mensch, der seinem Nächsten in seinem Leid zu Hilfe komme, soll Albert einmal gesagt haben, handle besser als jemand, der auf dem Pilgerweg von Schwaben bis Rom bei jedem Meilenstein ein Münster aus reinem Gold errichten würde. Denn Jesus Christus sei nicht um einer Kathedrale willen gestorben, sondern für den Menschen.
Fromm wie ein Kind, bedürfnislos wie ein Eremit, lebte der international geschätzte Wissenschaftspionier das arme Leben eines Bettelmönchs. Unerbittlich kämpfte er gegen klerikale Machtpolitik und Habgier. Einem Kölner Prälaten, der ihm stolz berichtete, die römische Kurie habe ihm den Besitz mehrerer einträglicher Pfründen gleichzeitig erlaubt, entgegnete er sarkastisch: „Jawohl, jetzt könnt Ihr mit Erlaubnis zur Hölle fahren!“ Im Dominikanerorden setzte der Provinzial Albertus sehr schmerzhafte Konkretisierungen des Armutsgelübdes durch.
Auf seine Initiative beschloss das Ordenskapitel, Dominikaner müssten in Zukunft beim Reisen auf einen Wagen verzichten und dürften sich ohne triftigen Grund auch nicht von einem Wagen mitnehmen lassen. Führende Ordensmitglieder, die gegen das Armutsgebot verstießen, wurden unnachsichtig bestraft oder sogar abgesetzt. Albert ging selbst mit gutem Beispiel voran: Seine Reisen durch Europa machte er grundsätzlich zu Fuß, unter härtesten Bedingungen, in sommerlicher Gluthitze, bei Eis und Schnee, ein armer Wandermönch.
Und das Verblüffendste: In den Marschpausen legte sich der erschöpfte Wanderer nicht etwa auf die faule Haut. Für ihn war das die Mußezeit zum Schreiben seiner hochgelehrten Abhandlungen über Ethik und Metaphysik, Logik, Mathematik, Zoologie und Botanik – vierzig Bände im Lexikonformat in der kritischen Neuausgabe. Dieses Riesenwerk, welches das gesamte Bildungsgut der damaligen Zeit ordnet, entstand in bescheidenen Herbergen und in den Gastzellen irgendwelcher Klöster. Machte man an der Landstraße Rast, so zog Albert gern eine Pergamenthandschrift mit Aristoteles-Texten aus seinem Bündel. Kam er in ein Kloster, durchforstete er regelmäßig die Bibliothek und schrieb sich aus Büchern, die er noch nicht kannte, in aller Eile die interessantesten Stellen ab.
Naturverliebt: Albertus Magnus
Natürlich geriet der unbestechliche Prophet einer armen Kirche oft genug in Konflikt mit den Machtinteressen besitzstarker Bischöfe und Kardinäle. Er führte eine offene Sprache, wenn es um die Sünden der Kirchenleitung ging, genoss an der römischen Kurie aber dennoch einen so guten Ruf, dass man den Siebenundsechzigjährigen 1260 plötzlich zum Bischof von Regensburg machte.
Ein Bischof als Finanzminister
Regensburg, das war damals ein ausgeplündertes, verrottetes Bistum, das niemand haben wollte. Alberts Vorgänger, ein gewisser Graf von Pietengau, hatte die Diözese mit skrupelloser Machtpolitik, Krieg und Mord zugrunde gerichtet. Ein Bettelmönch als neuer Bischof, als Reichsfürst – in einer auf Geld und Pomp versessenen Kirche mochte das durchaus als Signal zur Umkehr verstanden werden.
Ohne jeden Prunk zog er zu Fuß in seine Bischofsstadt ein. Er fand die Vorratsspeicher leer, dafür Schulden in astronomischer Höhe. „Nahrung für ihn und sein Gesinde gab es nicht“, berichtet ein Chronist schaudernd, „auch kein Futter für die Pferde. Es war nichts vorhanden, was auch nur den Wert von einem Ei gehabt hätte.“
Albert, das Multitalent, wurde auch mit dieser Herausforderung fertig. Der Naturforscher und Theologe verwandelte sich in einen Finanzminister. Er traf geschickte Maßnahmen zur Haushaltssanierung; binnen eines Jahres war das Bistum tatsächlich schuldenfrei. Die Menschen dankten es ihm nicht. Die einfachen Leute zeigten sich enttäuscht von dem Hungerleider auf dem Bischofsthron, der ihnen das Schauspiel der Prachtentfaltung vorenthielt und auf alle Zeichen seiner Würde verzichtete.