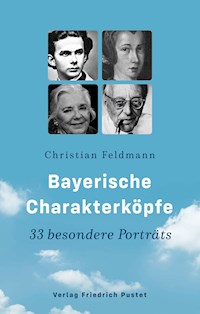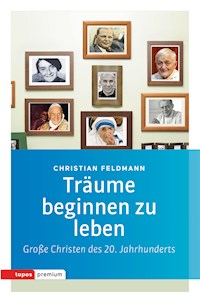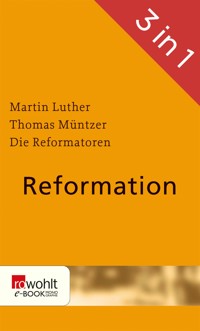Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Christian Feldmann erzählt aus dem Leben christlicher Mystiker und führt spannend und unterhaltsam in eine faszinierende und überraschende Welt. Bei manchen scheinen Ekstasen und parapsychologische Phänomene das Normalste von der Welt gewesen zu sein, bei anderen blieb die spirituelle Erfahrung verborgen in der Stille. Nach ihrem Tod von der Kirche als Heilige verehrt, wichen sie zu Lebzeiten in den Augen der kirchlichen Autoritäten oft von den "erlaubten Pfaden" ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Feldmann
Ein Gott zum Küssen
Wie Mystiker leben und was sie erfahren
15Porträts
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2012 Alle Rechte vorbehalten www.herder.de Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart Umschlagmotiv: Gian Lorenzo Bernini, Die Ekstase der heiligen Teresa von Ávila (1650), Detail Foto: © KNA-Bild ISBN (E-Book): 978-3-451-34664-4 ISBN (Buch): 978-3-451-32457-4
Inhalt
Widmung
EIN STÜCK HIMMEL AUF DER ERDE
Mystiker, was sind das für Leute?
1 ARBEIT AM INNEREN CHAOS
Antonios und die Wüstenmönche (3.–5. Jahrhundert): Aussteiger, die Gott in den eigenen Abgründen finden wollten
2 GOTTES GROSSE LIEBE: EIN STÜCK ERDENLEHM
Hildegard von Bingen (1098 –1179) war verliebt in die Schöpfung – und wusste, dass alles Leben auf der Welt voneinander abhängt
3 „IN DIR SELBER WOHNT DIE WAHRHEIT“
Meister Eckhart (um 1260 –1328) gab der Sehnsucht nach dem namenlosen Gott eine Stimme
4 DER WEG INS LAND DER FREIHEIT
Die Mystikerin Marguerite Porete (um 1260 –1310) wollte Gott ohne Vermittler finden
5 „ICH TANZE, WENN DU MICH FÜHRST“
Gertrud von Helfta (1256 –1301/02) und ihre Mitschwestern verkündeten einen menschenfreundlichen Gott – und zeigten, was Religion mit Erotik zu tun hat
6 EIN HEILIGER, DER FLIEGEN KONNTE
Filippo Neri (1515 –1595) und andere verrückte Spaßvögel lebten die herrliche Freiheit der Kinder Gottes – und führten vor, wie rebellisch das Lachen sein kann
7 DIE DUNKLE NACHT DES GLAUBENS
Die spanischen Mystiker und Klosterreformer Teresa von Ávila (1515 –1582) und Juan de la Cruz (1542–1591) erlebten Krisenerfahrungen als befreiend
8 TROST UND REBELLION
Melancholische Liederdichter wie Paul Gerhardt (1607–1676) oder Gerhard Tersteegen (1697–1769) machten ihre Lebenserfahrung zum gesungenen Glaubensbekenntnis
9 SCHUTZPATRONIN DES ZWEIFELS
Die kleine Nonne Thérèse de Lisieux (1873 –1897) kannte die Abgründe heutiger Gottesfinsternis
10 DER MENSCH AUF DER ACHSE DER EVOLUTION
Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) entdeckte die verachtete Materie als Wohnort des Göttlichen
11 GOTT SITZT IN DER LETZTEN U-BAHN
Madeleine Delbrêl (1904 –1964) verstand das Evangelium in einer glaubenslosen Umwelt zu leben
12 „JEDER IST MEHR ODER WENIGER EIN UNGLÄUBIGER“
Thomas Merton (1915 –1968) fand, Religion sei etwas für Leute, die einen tiefen Riss in ihrem Dasein erfahren haben
13 DER KLEINE FRÜHLING
Frère Roger von Taizé (1915 –2005) wollte „der Bruder aller Menschen ohne Unterschied“ sein
14 GOTTES GESICHT IN DEN ARMEN
Ignacio Ellacuría (1930 –1989) und andere Befreiungstheologen leben eine „Mystik der offenen Augen“
15 DEN AUFRECHTEN GANG ÜBEN
Dorothee Sölle (1929 –2003) war überzeugt, dass Mystik die Welt verändern kann
Anmerkungen
Tipps zum Weiterlesen
Für meine treuen Weggefährten Altabt Emmanuel Jungclaussen und Bischof em. Manfred Müller
EIN STÜCK HIMMEL AUF DER ERDE
Mystiker, was sind das für Leute?
„Der Fromme, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein.“
Karl Rahner
EINEN MYSTIKER STELLTman sich landläufig vor wie eine Mischung aus Derwisch, Klosterbruder und Autist: entweder in weltentrückter Trance oder in verzückter Ekstase. Es macht ihm nichts aus, anstrengende und zeitraubende Frömmigkeitsformen zu absolvieren, mit denen wir normalen Menschen wenig anfangen können. Mit einem Fuß ist er immer in einer anderen Welt. Was in seiner Umgebung vorgeht, was seine Mitmenschen umtreibt, interessiert ihn nicht besonders.
Aber wir ahnen, dass das ein Zerrbild ist – spätestens wenn wir das Glück haben, eine ganz in Gottes Nähe lebende alte Ordenschwester oder einen charismatischen Franziskaner kennenzulernen, der in seiner schäbigen Hauskapelle erst mal betend auf dem Boden gelegen hat, bevor er hinausgeht, um für seine Junkies, Strafentlassenen und Alkoholikerinnen zu kämpfen, in denen er hartnäckig Gottes Antlitz wahrnimmt. Vielleicht drängen wir die mystisch begabten Charaktere deshalb in eine wunderliche Sonderwelt ab, weil wir neidisch sind auf ihre Fähigkeit, zu träumen, Licht im Dunkel zu sehen, an einen Sinn zu glauben, Visionen zu haben – nein, keine Erscheinung von Engeln, die durch die Schlafzimmertür schweben, sondern Bilder von einer gerechten, glücklichen Welt, von einer Erde, auf der ein Stück Himmel sichtbar wird.
Man hat Mystik unterschiedlich definiert im Lauf der Religions- und der Christentumsgeschichte (nur um letztere geht es in diesem Buch). „Die unaussprechliche und mystische Betrachtung führt zu Verzückung und Enthusiasmus“, schwärmt der theologische Querkopf Origenes im dritten Jahrhundert von der Bibellektüre im stillen Kämmerlein. „Der Tanz der Gottesliebe kann nicht allein getanzt werden“, hält seine Kollegin Dorothee Sölle (gestorben 2003) dagegen: „Mystik muss und will heraus aus der Privatisierung der Freude, des Glücks, des Einsseins mit Gott.“
Was ist Mystik? Ganz knapp gesagt, eine Form, mich zu erkennen, meine Mitte zu entdecken, Gott in mir zu finden. Das „absolut Andere meiner selbst“ zu erfahren und es gleichzeitig als das „Innerste meiner selbst“ zu erleben, das im monotheistischen Kontext den Namen „Gott“ trägt – wie es die Fachfrau Saskia Wendel, eine niederländische Philosophieprofessorin, formuliert. Einfacher und salopp ausgedrückt: Mystik ist eine Abenteuerreise von der Erde zum Himmel und wieder zurück in die tiefsten Abgründe der Seele, und am Ende der Reise erkennt man fasziniert, dass Startpunkt und Ziel identisch sind.
Mystik ist der Mut, die zarten Antennen der Seele auszufahren, der Mut zu religiöser Empfindsamkeit und spiritueller Empfänglichkeit. Mystik ist die Lust, subjektive, persönliche, das eigene Leben durcheinanderwirbelnde Glaubenserfahrungen zu machen.
Nicht von ungefähr betrachten die etablierten Kirchen von jeher Propheten und Mystikerinnen nicht nur mit Bewunderung, sondern auch mit Misstrauen, weil sie mit ihrer Spontaneität Unruhe in die festgefügte Ordnung zu bringen pflegen und gefährliche Erinnerungen an die Ursprünge wachrufen. Und dabei oft genug das Mysterium und die Ungreifbarkeit Gottes vor den Glaubensbeamten in den Kirchenbehörden und vor den Verstandesfanatikern in einer verkopften Theologie retten.
Also nicht das Außergewöhnliche charakterisiert die Mystiker, nicht Trance und Hellsehen, nicht blutige Tränen oder der Blick in die himmlische Herrlichkeit, sondern die Tiefendimension des Gewöhnlichen. Nicht auf besondere Frömmigkeitspraktiken, Methoden, Tricks kommt es an oder auf die Härtedosis der diszipliniert gelebten Askese: „Geistliche Menschen“, so urteilt der ebenso fromme wie kämpferische Jesuit Ignacio Ellacuría, den die politischen Machthaber in El Salvador massakrieren ließen, „sind nicht die, die viele ‚geistliche‘ Übungen vollziehen, sondern diejenigen, die voll des Geistes den schöpferischen und erneuernden Elan Christi, seine Überwindung der Sünde und des Todes, seine Auferstehungskraft und größere Lebensfülle erfassen; diejenigen, die zur Fülle und Befreiung der Kinder Gottes gelangen; die, welche die anderen inspirieren und erleuchten und ihnen zu einem volleren, freieren Leben verhelfen.“1
In jüngster Zeit war es bei den lateinamerikanischen Befreiungstheologen, in Taizé oder bei den „Sisters of Charity“ der Mutter Teresa in Kalkutta zu beobachten: Eine vom Evangelium inspirierte Spiritualität schweißt „vita activa“ und „vita contemplativa“ – um in den alten Begriffen zu reden–, „Kampf und Kontemplation“ zu einer Einheit zusammen. Der Hunger nach geistigen Schätzen, die Sehnsucht nach Sinn bedeutet die kraftvolle Absage an die Götzen Geld und Besitz, Gewalt, Macht, Ego. Gott begegnet mir nicht nur tief in der Seele, sondern auch in Menschen, Elendsstrukturen, politischen Konflikten. Compassion ist gefragt, die Sensibilität für fremdes Leid – das plötzlich mein eigenes wird.
Dieses Buch hat ein Christ geschrieben, und es sind Christen, die es bevölkern. Der gerade moderne esoterische Einheitsbrei trägt nicht selten das Etikett „Spiritualität“ oder „Mystik“, aber er schmeckt nach Ichbezogenheit, Selbstverwirklichung, privater Innerlichkeit, seelischer Fitness, Konsum, sanfter Wellness. Nach Kuschelreligion, wo sich alle wohlfühlen sollen. Die stummen Schreie der kaputten Mitmenschen werden ebenso ausgeblendet wie das Elend der Welt, und harte Ansprüche an das enorm wichtige Ich braucht niemand zu stellen. Christen werden jedoch nie den Blick auf das Kreuz los, das unsere Träume von einem leidfreien Leben durchkreuzt – und wirklich zu trösten, zu befreien vermag, indem es die Angst vor dem Scheitern, ja sogar vor dem Tod nimmt.
1
ARBEIT AM INNEREN CHAOS
Antonios und die Wüstenmönche (3.–5.Jahrhundert): Aussteiger, die Gott in den eigenen Abgründen finden wollten
„Fliehe, schweige, bete!“
AUSGEMERGELTE, UNGEWASCHENEund zerlumpte Aussteiger waren die eigentlichen Väter der abendländischen Religiosität: Wüstenmönche, die in Höhlen und Gräbern lebten, aber über eine verblüffend robuste Gesundheit verfügten und ihren Mitmenschen mit frecher Provokation und barmherziger Weisheit Dienste erwiesen.
Nicht die Päpste in ihrer pompösen Machtentfaltung, nicht die großen Theologen der Frühzeit mit ihren himmelstürmenden Gedankengebäuden standen am Anfang der Christenheit in Ost und West, sondern die heruntergekommenen Eremiten der ägyptischen und syrischen Wüste. Zu Tausenden zogen sie hinaus in die Wildnis, Menschen, die der antiken Zivilisation mit ihrem dekadenten Lebensgenuss und ihrer blasierten Skepsis überdrüssig geworden waren.
Die Aussteiger führten ein hartes Asketenleben – und machten Erfahrungen, von denen ihre Nachfolger in den Klöstern späterer Jahrhunderte eine Menge lernen sollten und spirituell Suchende heute noch zehren: die Stille entdecken. Sparsam mit Worten umgehen. Gott in den eigenen Abgründen finden. Sich selbst aushalten lernen, schwach, gebrochen, verwundbar, voller Lebensnarben und müder Verzweiflung.
Wer sich von der Wüste verwandeln lässt, gewinnt eine Gelassenheit, die vor nichts in der Welt mehr Angst hat – und begegnet einem lebendigen, befreienden Gott.
Der „Stern der Wüste“
Irgendwann um das Jahr 270 machte ein zwanzigjähriger Ägypter eine tiefe persönliche Krise durch: Seine Eltern, vornehme, wohlhabende Leute, die aber als Angehörige der kleinen christlichen Minderheit sehr zurückgezogen lebten, waren kurz hintereinander gestorben. Nun suchte ihr Sohn in einer Kirche Trost. Das Evangelium erzählte von einem Menschen, der ebenfalls aus der besitzenden Klasse kam, aber höhere Interessen hatte. Fasziniert hörte der junge Mann, Antonios hieß er, was Jesus zu diesem Sinnsucher gesagt hatte:
„Es kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? (…) Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach.“
Matthäus 19,16.21
Antonios, so berichtet die Legende, ist wie vom Donner gerührt. Plötzlich sieht er am Horizont einen Lebensinhalt. Bald darauf verschenkt er seinen Grundbesitz, verkauft seine Habe, legt einen Teil des Geldes umsichtig als Mitgift für seine jüngere Schwester an und beginnt eine neue Existenz als einfacher Arbeiter in der Nähe seines Heimatdorfes.
Nicht lange, und er steigt völlig aus seinen bisherigen Bindungen aus. Antonios zieht sich in die Libysche Wüste zurück, wo er in totaler Einsamkeit in einer Felsengrabkammer lebt – Monate, Jahre, Jahrzehnte. Und all die endlosen Tage und Nächte kein Mensch, kein Freund, kein Gesprächspartner. Nur die eigene Seele mit ihren Ängsten und Abgründen, Sehnsüchten und Visionen.
Die Legende malt das in dem schaurigen Bild von den Dämonen aus, mit denen Antonios furchtbare Kämpfe auszufechten hatte. Matthias Grünewald lässt sie auf einem Flügel des Isenheimer Altars aus der Hölle steigen: fliegende Teufel, tückisch schnappende Reptilien, Tiermonster mit gehörnten Vogelköpfen, aufgerissenen Riesenmäulern und Fangzähnen, die den armen Einsiedler an den Haaren über den Boden schleifen und mit Knütteln verprügeln. An den unteren Bildrand hat der Maler einen Zettel drapiert mit dem zeitlosen Verzweiflungsschrei: „Wo warst du, guter Jesus? Warum bist du nicht gekommen, um meine Wunden zu heilen?“
Man erinnert sich, dass der Altar mit dem berühmten Gekreuzigten für die Kranken im Isenheimer Spital bestimmt war. Zu Beginn der Behandlung wurden sie vor diese Bilderwelt geführt. Der Gott, dem sie da begegneten, sah ihrem Schicksal nicht von einem fernen Himmel her zu: Er teilte Leid und Todesangst der Menschen.
Wir wollen hoffen, dass Antonios in seiner Isolationsfolter ähnlich tröstliche Erfahrungen machen durfte. Er scheint jedenfalls kein neurotischer, menschenfeindlicher Kauz geworden zu sein. Denn was geschah, als eine teils neugierige, teils nach geistlichem Zuspruch hungernde Menge gewaltsam in die Behausung des Eremiten eindrang, berichtet sein Biograf Athanasios:
„Weder war er aus Gram missmutig geworden noch vor Freude ausgelassen (…). Er war vielmehr ganz Ebenmaß und natürlich in seinem Verhalten. Viele von den Anwesenden, die ein körperliches Leiden hatten, heilte der Herr durch ihn, und andere befreite er von Dämonen. Er verlieh unserem Antonios auch die Freundlichkeit der Rede. Und so tröstete er viele Trauernde; andere, die im Streit miteinander lagen, versöhnte er, so dass sie Freunde wurden.“
Antonios wurde zu einem hochberühmten Heiligen; „Stern der Wüste“ nannte man ihn, und im Mittelalter beriefen sich zahllose Antonios-Bruderschaften in ihrem Dienst an Kranken und Armen auf den gutherzigen Einsiedler. Doch seine abenteuerliche Geschichte ist beileibe kein Einzelfall.
„Fliehe, schweige, bete!“
Es waren Scharen von Menschen, die damals an der Wende zum vierten Jahrhundert aus der müde gewordenen, degenerierten Zivilisation hinaus in die Wildnis flohen. Einen gewaltigen Auftrieb erhielt die merkwürdige Wanderungsbewegung, als das Christentum im Jahre 313 Staatsreligion im Römerreich wurde. Plötzlich gab es keine Wahl mehr; es galt als schick und karrierefördernd, Christ zu sein.
Da glaubten viele den radikalen Anspruch des Evangeliums nur noch retten zu können, indem sie die verlogene Gesellschaft verließen und buchstäblich in die Wüste gingen. Bald hatte sich die Bewegung über Palästina und Syrien bis ins Abendland ausgebreitet.
Die Wüstenväter und -mütter, Abbas und Amma heißen sie in den alten Überlieferungen, füllten ihre Tage mit Beten, Meditieren, Fasten und einfacher Handarbeit. Sie flochten Seile und stellten Körbe her, um sich ihren kargen Lebensunterhalt zu verdienen. Viele blieben als Eremiten ganz für sich allein, andere fanden sich zu kleinen Einsiedlerkolonien zusammen oder gründeten Häuser für das gemeinsame Leben: die ersten Klöster.
Theodosios baute bei Betlehem ein solches Kloster auf mit einem Hospiz für physisch und psychisch Kranke. Pachomios der Große gründete nördlich von Theben einen Verband von zwölf Klöstern, jeweils aus mehreren Häusern für bis zu vierzig Mönche oder Nonnen bestehend. In Nordafrika führte die Schwester des heiligen Augustinus, die Witwe Perpetua, eine Frauengemeinschaft. In Jerusalem rief eine gewisse Melania, die in Rom eine Menge vornehmer Senatoren für das Christentum gewonnen hatte und mit einundzwanzig ebenfalls Witwe geworden war, zwei Klöster ins Leben – eines für Frauen, eines für Männer. Die prominente Schauspielerin Pelagia riss, als Mönch verkleidet, aus Antiochia aus und ließ sich als Büßerin im Heiligen Land nieder.
Die Einsamkeit dieser Wüstenleute wurde immer wieder von Hilfesuchenden durchbrochen. Die Ratschläge, die sie mit nach Hause nehmen konnten, waren meist denkbar knapp und schlicht, aber sensibel und lebensklug. Spruchsammlungen wie die auf das vierte oder fünfte Jahrhundert zurückgehenden Apophthegmata Patrum („Aussprüche der Väter“) informieren uns darüber – und lassen diese frühchristlichen Gurus geradezu als Vorläufer moderner Therapeuten erscheinen.
Natürlich lässt sich die Lebenssituation der ägyptischen Wüste nicht unbedingt mit den Großstädten und Landgemeinden des beginnenden dritten Jahrtausends vergleichen. Wer heute einen spirituellen Anspruch zu verwirklichen sucht, dürfte sich kaum den kompletten Verzicht auf Besitz, Sexualität, zivilisatorischen Komfort einfallen lassen.
Oder doch?
Von ihren Zeitgenossen wurden die Wüstenmönche als Menschen wahrgenommen, die an vorderster Front gegen die Mächte des Bösen kämpften, die eine gefährliche Existenz auf sich nahmen, um betend und büßend ihre in der Welt gebliebenen Geschwister zu beschützen.
Arsenios war der Sohn eines römischen Senators und hoher Beamter am Kaiserhof zu Konstantinopel. Er wurde zum Wüsteneremiten, weil ihm eine himmlische Stimme geraten hatte: „Arsenios, fliehe die Menschen, und du wirst gerettet werden!“ – „Arsenios, fliehe, schweige, bete! Das sind die Wurzeln der Sündenlosigkeit.“
Einsamkeit. Schweigen. Gebet. Es sind die Zauberworte, die heute noch das Leben in den Klöstern bestimmen. Moderne Menschen entdecken die Abteien zusehends als Kraftquelle. Sollte sie doch zeitlos sein, die Spiritualität der Wüste?
Die Wirklichkeit hinter den Dämonen
Zeitlos wie die alten Geschichten aus den Mönchskolonien. Von drei Studenten wird berichtet, die Mönche wurden und sich vornahmen, ein gutes Werk zu tun. „Der erste wollte Streitende zum Frieden zurückführen. Der zweite wollte Kranke besuchen. Der dritte ging in die Wüste, um dort in Ruhe zu leben. Der erste, der sich um die Streitenden mühte, konnte jedoch nicht alle heilen. Von Verzagtheit übermannt, ging er zum zweiten, der den Kranken diente, und fand auch diesen in gedrückter Stimmung; denn auch er konnte sein Vorhaben nicht ganz ausführen. Sie kamen daher beide überein, den dritten aufzusuchen, der in die Wüste gegangen war. Sie erzählten ihm ihre Nöte und baten ihn, er möge ihnen aufrichtig sagen, was er gewonnen habe.
Er schwieg eine Weile, dann goss er Wasser in ein Gefäß und sagte ihnen, sie sollten hineinschauen. Doch das Wasser war noch ganz unruhig. Nach einiger Zeit ließ er sie wieder hineinschauen und sprach: ‚Betrachtet nun, wie ruhig das Wasser jetzt geworden ist.‘ Und sie schauten hinein und erblickten ihr Angesicht wie in einem Spiegel.“
Für die Wüstenväter bedeutete Einsamkeit offenbar mehr als ein ungestörtes Privatleben, mehr als die Muße, den eigenen Gedanken nachhängen und nach Herzenslust träumen zu können. Ihre Einsamkeit ist höchst produktiv, ist auf ein Ziel gerichtet: Selbsterkenntnis.
Sie gehen in die Wüste, um sich verwandeln zu lassen, um neue Maßstäbe zu gewinnen. Sie lassen alle Sicherheiten fahren, sie verzichten auf die gewohnten Lebenskonstrukte, um sich der Konfrontation mit dem nackten Ich auszusetzen. Sich selbst aushalten lernen, das kann ein grausamer Prozess sein.
Die alten Legenden und Gemälde illustrieren diesen inneren Konflikt mit den grässlichen Spukgestalten, die auf den Menschen eindringen: Symbole für all die Ängste und Zwänge, die ihn übergroß bedrängen, wenn er mit sich allein ist. Der Lohn solcher Schmerzen ist nicht nur eine souveräne Gelassenheit, die alle Furcht vertreibt; der Lohn ist vor allem die Begegnung mit einem lebendigen, befreienden Gott. Anfangs bedeutet die Einsamkeit Finsternis und beklemmendes Grauen, aber sie birgt eine lebenswichtige Einsicht: Der Mensch braucht Gott.
Vor seinen Abgründen muss der Mensch keine Angst mehr haben, denn in ihnen vermag er Gott zu finden. Der Altvater Elias – „Altväter“ nennen die Apophtegmata in zärtlichem Respekt die weisen Mönche in der Wüste – berichtet von einem Greis, der von einem scheußlichen Dämon verhöhnt und gequält wird, bis er endlich verzweifelt nach Christus schreit.
„Auf der Stelle floh der Dämon. Da begann der Greis zu weinen. Der Herr aber sprach zu ihm: ‚Warum weinst du?‘ Der Greis antwortete: ‚Weil sie es wagen, gegen den Menschen Gewalt zu brauchen (…)‘ Er aber erklärte ihm: ‚Du bist nachlässig gewesen. Als du nämlich nach mir suchtest, ließ ich mich finden.‘“
Wie viele Missverständnisse! Einsamkeit bedeutet offenbar nicht träge Ruhe, sondern inneren Kampf. Nicht Gottverlassenheit, sondern die Erfahrung seiner Nähe im Zentrum der Dunkelheit. Und die größte Überraschung: Einsamkeit bedeutet am Ende nicht Weltflucht, sondern die neugewonnene Fähigkeit zur liebevollen Solidarität, zum barmherzigen Umgang miteinander.
So erschüttert waren sie von der Erkenntnis ihrer eigenen Schwäche, die Wüstenväter, dass sie den Mitmenschen gar nicht mehr anders begegnen konnten als mit großer Milde. Ein Meister solch verstehender Güte muss der Altvater Poimen gewesen sein. Ein besonders sittenstrenger Mitbruder wollte sich bei Poimen einschmeicheln und erläuterte ihm Beifall heischend: „Wenn ich einen Bruder sehe, von dem ich einen Fehltritt erfahren habe, will ich ihn gar nicht erst in meine Behausung führen. Wenn ich aber einen sehe, der gut ist, dann freue ich mich mit ihm!“
Poimen zeigte sich wenig begeistert von so viel Selbstgerechtigkeit. Er gab seinem Besucher einen unerwarteten Rat: „Wenn du dem Guten ein wenig Gutes tust, dann tu dem anderen doppelt so viel. Denn er ist mit einer Schwäche behaftet.“
„Ein Bruder fragte den Altvater Sisoes: ‚Was soll ich tun, Vater, weil ich gefallen bin?‘ Der Altvater sagte ihm: ‚Steh wieder auf!‘ Der Bruder sagte darauf: ‚Ich bin aufgestanden, aber wieder gefallen.‘ Und der Altvater sagte darauf: ‚Dann steh wieder und wieder auf!‘ Der Bruder fragte: ‚Wie lange?‘ Der Greis antwortete: ‚Bis du aufgenommen bist, entweder im Guten oder im Falle. Denn in dem, worin der Mensch sich befindet, geht er hinüber.‘“
Apophthegmata Patrum
Die Wüstenväter nahmen in ihrer Schlichtheit die Forderung Christi wörtlich: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ Sie wollten offensichtliche Sünden lieber entschuldigen als jemandem mit einem vorschnellen Urteil Unrecht tun. In einem Wüstenkloster hatte man eine Verfehlung entdeckt, und man holte den berühmten Altvater Moses, der den Übeltäter richten sollte: „Moses nahm einen durchlöcherten Korb, füllte ihn mit Sand und nahm ihn auf die Schulter. Die Brüder gingen ihm entgegen und sagten zu ihm: ‚Was ist das, Vater?‘ Da sagte der Greis zu ihnen: ‚Das sind meine Sünden. Hinter mir rinnen sie heraus, und ich sehe sie nicht, und nun bin ich heute gekommen, um fremde Sünden zu richten!‘ Als sie das hörten, sagten sie nichts mehr zu jenem Bruder, sondern verziehen ihm.“
In uns selbst eine Wüste schaffen
Schöne Geschichten. Aber wer kann heutzutage schon in die Wüste auswandern? Ein zeitgenössischer Meister geistlichen Lebens, der 1996 gestorbene Henri Nouwen, empfiehlt die genau umgekehrte Methode: die Wüste zu uns zu holen. „Wir müssen uns tatsächlich unsere eigene Wüste schaffen, in die wir uns jeden Tag zurückziehen. Ohne solche Wüste verlieren wir unsere eigene Seele. (…) Das Wichtigste ist zunächst, uns eine Zeit und einen Ort festzusetzen, um bei Gott und allein bei ihm zu sein. Im konkreten Fall wird diese Übung der Einsamkeit für jeden anders aussehen und von dem Charakter des einzelnen, von seiner Tätigkeit und Umgebung abhängen. Aber eine wirkliche Übung bleibt nie im Ungefähren und Allgemeinen. Sie ist so konkret und bestimmt wie der Alltag selber.“
Die Wüste in uns selbst schaffen – das gilt für die produktive Einsamkeit genauso wie für das Schweigen, das die Altväter so wichtig genommen haben. Henri Nouwen glaubt zu wissen, warum: „In unserer Welt ständigen Redens, in der das Wort seine Kraft der Mitteilung vielfach verloren hat, hilft uns das Schweigen, unseren Geist und unser Herz in der kommenden Welt verankert zu halten.“ Ein solches Schweigen habe nicht nur in Exerzitienhäusern und hinter Klostermauern seinen Platz, sondern im ganz normalen Alltag mit seiner Betriebsamkeit. Nouwen: „Es ist wie eine Zelle, die wir aus unserer Einsamkeit forttragen und mitten in unsere Tätigkeit hineinstellen können. Schweigen ist Einsamkeit im Tun.“
An der Inflation der Worte und Wörter leiden nicht nur besonders sensible Gemüter. Es wird pausenlos diskutiert, erläutert und verlautbart, ohne zu merken, wie dünn und kraftlos dieses pausenlose Sprechen geworden ist. Zeitgenössische Therapeuten rücken dem Problem mit teuren Kommunikationstrainings zu Leibe. Die Wüstenväter hätten eine Behandlungsmethode anzubieten, die der Krankheit an die Wurzeln geht: Aus dem Schweigen heraus reden.
Das heißt, sparsam mit Worten umgehen. Nicht alles zwanghaft mitteilen müssen. Hilfreiche Rede vom leeren Geschwätz trennen. Mit Worten aufbauen statt zerstören, ermuntern statt kränken, frei machen statt vereinnahmen. Die fruchtbare Wüste des Schweigens – wieder einmal – in uns schaffen, wie die kluge Geschichte vom Altvater Makarios nahelegt: „Makarios sagte zu den Brüdern in der Wüste Sketis, als er aus der Kirche kam: ‚Flieht, Brüder!‘ Da fragte ihn ein alter Mönch: ‚Wo sollen wir denn anders hinfliehen als in die Wüste?‘ Er aber legte seinen Finger auf den Mund und sprach: ‚Dies sollt ihr fliehen.‘ Und er ging in seine Zelle, verschloss die Tür und setzte sich nieder.“
Schweigen üben, das geht hoffentlich auch ohne solche Gewaltkuren, wie sie der Altvater Agathon praktizierte. Drei Jahre lang soll er einen Stein von beträchtlicher Größe im Mund getragen haben, bis er nicht nur seine Rede beherrschte, sondern auch im Herzen keine Urteile mehr über Mitbrüder fällte.
„Ein Bruder befragte den Altvater Matoe: ‚Was soll ich tun? Meine Zunge macht mir Schwierigkeiten! Wenn ich mitten unter die Menschen gehe, dann kann ich sie nicht zwingen. Ich beurteile sie in jedem guten Werk und tadle sie. Was soll ich also tun?‘ Der Greis antwortete ihm: ‚Wenn du dich nicht beherrschen kannst, dann fliehe in die Einsamkeit. Denn es ist eine Schwäche. Wer mit den Brüdern zusammenwohnt, der darf nicht viereckig sein, sondern muss rund sein, damit er sich allen zuwenden kann.‘“
Apophthegmata Patrum
Wenn wir irgendwo schweigend warten müssen, wenn im Gespräch eine Pause eintritt, ist uns das unangenehm. Warum eigentlich? Hätten wir keine nervöse Angst vor der Stille mehr, so könnte sich das Schweigen füllen – und die Rede, die darauf folgt, Kraft gewinnen, Dichte, Tiefe.
Der Altvater Poimen warnt allerdings vor einer neuen Selbstgerechtigkeit, einem spirituellen Klassendenken, das die Menschheit in Könner und Versager aufteilt, in Schweiger und Geschwätzige: „Da ist ein Mensch, der scheint zu schweigen, aber sein Herz verurteilt andere. Ein solcher redet in Wirklichkeit ununterbrochen. Und da ist ein anderer, der redet von der Frühe bis zum Abend, und doch bewahrt er das Schweigen, das heißt, er redet nichts Unnützes.“
Wie das Schweigen zum Hören wird
„Fliehe, schweige, bete!“ hat die Stimme vom Himmel den Wüstenvater Arsenios ermuntert. Die dritte Empfehlung gibt den beiden vorausgehenden erst ihre Tiefendimension: Beten macht die Einsamkeit zum Alleinsein mit Gott, verwandelt das Schweigen in Hören. Beten hilft die Konflikte bewältigen, die mit der Einsamkeit und der Übung des Schweigens notwendig verbunden sind, wie schon die Wüstenmutter Theodora wusste:
„Wisse, wenn der Vorsatz auf die Herzensruhe gerichtet ist, dann kommt sofort der Böse und beschwert die Seele, in Unmut, in Kleinmut und Gedanken (…), und er bricht die Kraft der Seele und des Leibes. (…) Aber wenn wir wachsam sind, dann löst sich das alles auf.“
Und wachsam macht das Gebet. Denn vor Gott gibt es keine Masken und Lebenslügen mehr. Das Hören auf Gott, das Verweilen in seiner Nähe desillusioniert – aber es befreit auch. Es verwandelt die Persönlichkeit, schmilzt das Innere des Menschen in einem aufregenden, bisweilen auch schmerzlichen Prozess um. Im Herzen vollzieht sich dieser Prozess, im Zentrum der Person – nicht bloß im Kopf, nicht nur im Gefühl.
„Nur keine Angst, wenn ihr von Tugend hört, und reagiert nicht befremdet auf dieses Wort! Sie ist nichts, was von uns weit weg ist. Sie existiert nicht außerhalb unser. Sondern in uns selbst ist sie wirksam und ist etwas Leichtes, wenn wir nur wollen. (…) Wir brauchen nicht zu verreisen wegen des Himmelreiches noch übers Meer zu fahren nach der Tugend. Denn dem zuvorkommend sprach bereits der Herr: ‚Das Reich Gottes ist in euch.‘ (…) Denn wenn die Seele ihrer Natur gemäß das Vernünftige will, dann existiert die Tugend.“
Athanasius: Vita et conversatio S.P.N.Antonii
Wenn die Weisen der Wüste vom Beten reden, meinen sie keine betriebsame Aktivität und kein verstandesmäßiges Sprechen mit Gott. Nicht reden ist gemeint, sondern still werden und hören. Makarios der Große erklärt: „Die Hauptaufgabe des Athleten, das heißt des Mönches, ist es, in sein Herz einzutreten.“
Was keineswegs bedeuten soll, sich aus der bitteren Realität wegzuträumen, sondern am inneren Chaos zu arbeiten. Denn das Herz ist in der biblischen Tradition das Zentrum des Menschen, die Quelle all seiner Kräfte, der emotionalen wie der intellektuellen. „Mit dem Herzen beten“, das bedeutet dann einfach: Der ganze Mensch betet, mit Kopf und Gefühl. „Einige fragten Altvater Makarios: ‚Wie müssen wir beten?‘ Dieser antwortete: ‚Es ist nicht nötig, viel zu reden; sondern ihr sollt die Hände ausstrecken und sprechen: Herr, wie du willst und weißt, erbarme dich! Wenn aber eine Anfechtung kommt, dann: Herr, hilf! Er weiß, was wir brauchen.‘“
Einfach müsse so ein Gebet sein, schärft Makarios seinen Schülern ein. „Streng dich also nicht an, viel zu sagen. Wenn du nach Worten suchst, wird dein Geist nur zerstreut. (…) Ein Wort auf den Lippen des Zöllners versöhnte Gott; eine vertrauensvolle Bitte war genug, um den Schächer zu retten! Redet man viel im Gebet, so belästigen allerlei zerstreuende Bilder den Geist, aber die Andacht geht verloren. Redet man aber wenig oder spricht nur ein Wort im Gebet, so bleibt der Geist gesammelt.“
„Spiritualität von unten“
In anderen Religionen heißt das „Mantra“: ein Vers, eine Formel, ein Meditationsimpuls, der sich bei ständiger Wiederholung unauslöschlich einprägt und den Menschen an die andere Welt bindet. Wenn sich der Mönch auf das Beten mit dem Herzen einlässt, braucht er weder viele Worte noch viel ungestörte Zeit. Er lässt sein Herz beten, er öffnet sich Gott so vertrauensvoll, dass es in ihm betet und er gar nicht mehr viel dazu tun muss. Er trägt alles, was ihm begegnet, Pflichten, Sorgen, Menschen, vor Gott. Und sein Alltag wird zum Gebet, ganz von selbst.
Die Wüstenväter pochen darauf, dass Beten nicht zum Vorwand werden darf, die Nöte der anderen Menschen zu vergessen. „Man erzählte, dass Altvater Johannes Kolobos einmal zu seinem älteren Bruder sagte: ‚Ich will ohne Sorgen sein, so wie die Engel sorglos sind und nicht arbeiten, sondern unaufhörlich Gott dienen.‘ Er legte sein Kleid ab und ging in die Wüste. Nachdem er eine Woche dort verbracht hatte, kehrte er zu seinem Bruder zurück. Als er an die Tür klopfte, erkannte ihn sein Bruder, bevor er öffnete, und sprach: ‚Wer bist du?‘ Er antwortete: ‚Ich bin Johannes, dein Bruder!‘ Der Bruder antwortete: ‚Johannes ist ein Engel geworden und gehört nicht mehr zu den Menschen.‘ Da flehte er ihn an und sagte: ‚Ich bin es doch!‘ Der andere aber öffnete ihm nicht, sondern ließ ihn bis zum Morgen in dieser unbequemen Lage. Erst später öffnete er und sagte: ‚Wenn du ein Mensch bist, dann musst du arbeiten, damit du deine Nahrung findest.‘ Da bereute Johannes und sagte: ‚Verzeih mir!‘“
Die Wüstenmönche wissen, dass sie sich nicht einfach in den Himmel erheben und die eigenen Merkwürdigkeiten und Abgründe vergessen können. Vom Abba Antonios ist das Wort überliefert: „Wenn du siehst, dass ein junger Mönch mit seinem eigenen Willen nach dem Himmel strebt, halte seine Füße fest, ziehe ihn nach unten, denn es hat für ihn keinen Nutzen.“
„Spiritualität von unten“ nennt der Benediktiner Anselm Grün diese Frömmigkeit. Für die Wüstenväter beginne der spirituelle Weg bei den Leidenschaften der Seele. „Sie muss man erst beobachten, mit ihnen muss man kämpfen. Dann erst versteht man etwas von Gott. (…) Es ist eine große Gefahr, dass wir die Meditation dazu benutzen, den Problemen aus dem Weg zu gehen, die wir eigentlich lösen müssten, etwa die Probleme unserer verdrängten Sexualität, unserer unterdrückten Aggressionen und unserer Ängste. (…) Die Spiritualität von unten meint, dass ich Gottes Wille mit mir, dass ich meine Berufung nur entdecken kann, wenn ich den Mut habe, in meine Realität hinabzusteigen, mich mit meinen Leidenschaften, mit meinen Trieben, mit meinen Bedürfnissen und Wünschen zu beschäftigen, und der Weg zu Gott führt über meine Schwächen, über meine Ohnmacht.“
Zum Beispiel über die Wut, die in mir kocht. Die „Spiritualität von oben“, so Grün, reagiert darauf, indem sie die Emotion „unterdrückt oder verdrängt. ‚Die Wut darf nicht sein. Als Christ muss ich immer freundlich und ausgeglichen sein. Da muss ich meine Wut beherrschen.‘ Die Spiritualität von unten würde bedeuten, dass ich meine Wut befrage, was Gott mir darin sagen möchte. Vielleicht weist mich meine Wut auf eine tiefe Verletzung hin (…). Vielleicht zeigt mir meine Wut, dass ich andern zu viel Macht über mich gegeben habe. Dann wäre die Wut die Kraft, mich von der Macht der andern zu befreien. Die Wut ist dann nicht von vornherein schlecht, sondern sie wird für mich zum Wegweiser zu meinem wahren Selbst.“
Ein berühmter Theologe suchte den Altvater Poimen in der Wüste auf, um mit ihm über die Geheimnisse Gottes zu sprechen. Aber Poimen hörte gar nicht hin. Betrübt beschwerte sich der Besucher bei seinem Begleiter, der ihn hergebracht hatte. Dieser stellte Poimen zur Rede und fragte: „Vater, deinetwegen kam dieser große Mann, der in seiner Gegend ein so großes Ansehen besitzt. Warum hast du denn nicht mit ihm gesprochen?“
Der Greis gab zur Antwort: „Er wohnt in den Höhen und spricht Himmlisches, ich aber gehöre zu denen drunten und rede Irdisches. Wenn er von den Leidenschaften der Seele gesprochen hätte, dann hätte ich ihm wohl Antwort gegeben. Wenn er aber über geistliche Dinge spricht – davon verstehe ich nichts!“
2
GOTTES GROSSE LIEBE: EIN STÜCK ERDENLEHM
Hildegard von Bingen (1098–1179) war verliebt in die Schöpfung – und wusste, dass alles Leben auf der Welt voneinander abhängt
„Von der Tiefe bis hoch zu den Sternen überflutet die Liebe das All.“
DIE ELEMENTE DER WELTschreien wild auf und klagen: „Wir können nicht mehr laufen und unsere Bahn nach der Bestimmung unseres Meisters vollenden. Denn die Menschen kehren uns mit ihren schlechten Taten von ganz unten nach ganz oben wie in einer Mühle. Wir stinken schon wie die Pest und vergehen vor Hunger nach der vollen Gerechtigkeit.“ Und Gott gibt ihnen Recht. Er verspricht: „Mit den Qualen derer, die euch verunreinigt haben, will ich euch reinigen.“
Eine typisch mittelalterliche Vision kosmischer Unordnung, aufgezeichnet im zwölften Jahrhundert von der Ärztin, Äbtissin, Theologin und Komponistin Hildegard von Bingen. Dunkle Bilder – und doch sofort nachvollziehbar: Der Mensch ist in den Kosmos eingebunden, menschliches Fehlverhalten wirkt auf den Kosmos zurück. Modern ausgedrückt: Verantwortungslose Ausbeutung der Ressourcen stört das ökologische Gleichgewicht auf der Erde und die Ordnung des Alls, Profitsucht und Größenwahn der Macher lassen die Biosphäre kaputtgehen.
Hildegard von Bingen gilt vielen als frühe Kronzeugin der alternativen Szene: Hält sie nicht der Umweltzerstörung die unversehrte „Grünkraft“ entgegen? Gibt sie in ihren Büchern über Pflanzen, Tiere und Heilkräuter nicht erstaunlich treffsichere Ratschläge? Ganz abgesehen vom exotischen Reiz ihrer Küchenrezepte.
Zu wenig. Zerrbilder beherrschen die weitverbreitete Literatur mit Ernährungsratschlägen, Kräuterbeschreibungen und Küchentipps aus der „Hildegard-Medizin“. Mit Hildegard lässt sich ein gutes Geschäft machen – auf Kosten ihrer kraftvollen, vielschichtigen Persönlichkeit.
Konservative Reformerin
Sie war alles andere als eine schwärmerisch-überspannte Nonne, die in ihrem Klostergärtlein zufällig ein paar brauchbare Heilkräuter zog. Wer ihr begegnet, entdeckt ein Energiebündel voller Elan und Ideen, hellwach, emanzipiert und zugleich selbstkritisch. Hildegard leitete zwei Abteien gleichzeitig und führte einen der umfangreichsten Briefwechsel des Mittelalters. Sie übte ein halbes Dutzend Berufe auf einmal aus: Dichterin, Theologin, Naturwissenschaftlerin, Ärztin, Apothekerin. Ihre gewaltigen Visionen stoßen heute auf ein neues starkes Interesse, und die eigenwilligen Lieder und Singspiele, die sie für ihre Mitschwestern getextet und komponiert hat, gibt es längst auf CD.Pfalzgrafen, Gelehrte, Bischöfe und Bauern pilgerten an den Rhein, um Hildegards Rat einzuholen. Sie war einzigartig!
Und doch auch wieder nicht. Natürlich ist auch Hildegard ein Kind ihrer Zeit gewesen, keineswegs immer eine forsche Vordenkerin. An Politik und Gesellschaft ihrer Epoche hatte sie offensichtlich weniger zu kritisieren als andere religiös motivierte Autoren aus der damaligen Reformbewegung.
Gegen die Kreuzzüge zum Beispiel hatte sie nichts. Der angeblich so naive Francesco von Assisi sollte der fromm verbrämten Schlächterei wenige Jahrzehnte später die friedliche Mission gegenüberstellen, die Überzeugungskraft eines christlichen Lebens. Hildegard dagegen feuerte den Kreuzzugsprediger Bernhard von Clairvaux in einem devoten Brief voller Bewunderung an: „Mit dem Banner des heiligen Kreuzes fängst du erfüllt mit hohem Eifer in brennender Liebe zum Gottessohn die Menschen, damit sie im Christenheer Krieg führen wider die Wut der Heiden.“
Der Obrigkeit, ihren Ansprüchen und Parolen hat man sich eben einfach zu unterwerfen. „Denn vom Heiligen Geiste ist die Regierung über das Volk zum wirksamen Nutzen der Lebendigen eingesetzt“, heißt es in ihrem ersten großen Visionsbuch „Scivias“: „Wie sollten sonst die Menschen Gott erkennen und ehren, wenn sie nicht Menschen Ehre und Ehrfurcht zu erweisen hätten!“
Moralisch findet sie keineswegs alles in Ordnung, was die Obrigkeit so tut; die geschäftstüchtigen Verwalter geistlicher Ämter schickt sie ohne viel Federlesens in die Hölle. Ihrem von Gott zum Nutzen der Menschen so weise eingesetzten „Regiment“ sei dennoch zu gehorchen. Reformerisch war sie schon gesinnt, aber ihre Vorstellungen von einer kirchlichen und gesellschaftlichen Erneuerung hören sich erheblich konservativer an als die der zeitgenössischen Fortschrittskräfte: Rückkehr zu den Ursprüngen statt radikaler Neuorientierung.