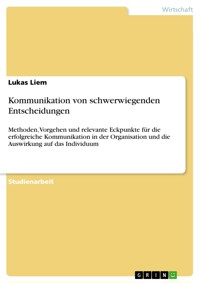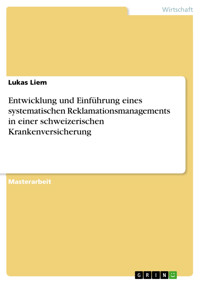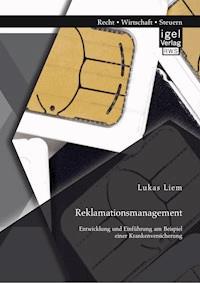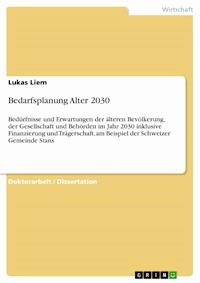
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Doktorarbeit / Dissertation aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: sehr gut (94%), , Veranstaltung: inter-university doctoral degree programme, Sprache: Deutsch, Abstract: Der demographische Wandel wird viele Lebensbereiche unserer Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten grundsätzlich verändern. Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme sind ebenso absehbar, wie auf politische Entscheidungen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Betroffen davon sind alle Bevölkerungsgruppen, ob alt oder jung. Die Entwicklungstrends des demographischen Wandels, ihre Folgen und mögliche Handlungskonzepte sind deshalb wichtige Themen. In der Altersbetreuung besteht in der Schweizer Gemeinde Stans ein zunehmender Bedarf nach Leistungen im präventiven, ambulanten und stationären Bereich. Damit dieser Bedarf abgedeckt werden kann, sind finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen rechtzeitig einzuplanen. Diese Planung soll die Grundlage schaffen, damit die erforderlichen Maßnahmen optimal aufeinander abgestimmt werden können. Durch eine langfristige und abgestimmte Planung können der Ressourceneinsatz optimiert und Planungsfehler vermieden werden. Mit dieser Arbeit wurden, basierend auf einer gross angelegten Bevölkerungsbefragung, Planungsgrundlagen für die Bedarfsplanung Alter 2030 der Gemeinde Stans erarbeitet und ein neues Altersleitbild geschaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Ich erkläre an Eides Statt, dass ich die Dissertation mit dem Titel „Bedarfsplanung Alter 2030. Bedürfnisse und Erwartungen der älteren Bevölkerung, der Gesellschaft und Behörden im Jahr 2030 inklusive Finanzierung und Trägerschaft, am Beispiel der Schweizer Gemeinde Stans“ selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt, alle den benutzten Quellen wörtlich oder sinngemäß entnommene Stellen als solche kenntlich gemacht habe und mich auch sonst keiner unerlaubter Hilfe bedient habe.
VORWORT
Unzählige neue Studien zeigen, dass mit 50 Jahren nicht der Höhepunkt des Lebens erreicht wird, sondern dass die Menschen ab 50 glücklicher und zufriedener werden. 340‘000 Amerikaner[1]zwischen 18 und 85 Jahren wurden über ihre Gefühle befragt. Der Psychologe und Studienautor Arthur Stone stellte verblüfft fest, dass das allgemeine Wohlbefinden der Befragten ab 30 bis Mitte 40 kontinuierlich abnahm, um dann wieder anzusteigen. Die Glückskurve stellte sich als U-Form-Kurve heraus, mit einem statistischen Tiefpunkt im Alter von 46. Stone zog daraus die Konsequenz, einen ‚U-Turn of Life‘ zu formulieren, die Kehrtwende zum besseren Leben. Denn die Lebenszufriedenheit ist im Alter noch weit höher als in der Phase der frühen Erwachsenenzeit. Diese Kehrtwende der Lebenszufriedenheit erweist sich in vielen Studien als globales Phänomen, indem wir immer sicherer durchs Leben gehen, weiser werden und uns besser fühlen.[2]
Mit diesen positiven Aussichten und dem vermuteten brachliegenden Potential bei der Alterspolitik wurde ich angespornt und motiviert meine Dissertation zum Thema Alter 2030 zu schreiben. Es geht darum einen relevanten Beitrag zu leisten, damit die wandelnde soziale Welt gerade zum Thema Alter und Altern verstehbar, sinnhaft und handhabbar wird. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema ist das Ergebnis nicht nur die vorliegende Arbeit – sondern ich kann auch viele fachliche und persönliche Erkenntnisse auf meinen weiteren Weg mitnehmen.
Ich danke den Verantwortlichen des Branch Campus Innsbruck der Universidad Azteca und Universidad Central de Nicaragua für die sehr lehrreiche Zeit. Im Besonderen danke ich meinem Betreuer Herr Prof. DDr. Gerhard Berchtold für seine Unterstützung, sowie für seine Zeit, die er mir zur Verfügung stellte.
Herzlich bedanke ich mich bei meiner Arbeitgeberin Politische Gemeinde Stans für die Möglichkeit ein aktuelles Projektthema im Rahmen dieser Arbeit zu bearbeiten und beim Sozialvorsteher Gemeindevizepräsident Gregor Schwander und der Gemeindeschreiberin Esther Bachmann für die große Unterstützung.
Zum Schluss bedanke ich mich ganz besonders bei meiner Familie, mit meiner Ehefrau Viktorija und unseren Kindern Darius, Jessica und Joel, welche mich mit großem Verständnis und Entgegenkommen unterstützte.
MANAGEMENT SUMMARY
Der demographische Wandel wird viele Lebensbereiche unserer Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten grundsätzlich verändern. Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme sind ebenso absehbar, wie auf politische Entscheidungen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Betroffen davon sind alle Bevölkerungsgruppen, ob alt oder jung. Die Entwicklungstrends des demographischen Wandels, ihre Folgen und mögliche Handlungskonzepte sind deshalb wichtige Themen.In der Altersbetreuung besteht in der Gemeinde Stans ein zunehmender Bedarf nach Leistungen im präventiven, ambulanten und stationären Bereich. Damit dieser Bedarf abgedeckt werden kann, sind finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen rechtzeitig einzuplanen. Diese Planung soll die Grundlage schaffen, damit die erforderlichen Maßnahmen optimal aufeinander abgestimmt werden können. Durch eine langfristige und abgestimmte Planung können der Ressourceneinsatz optimiert und Planungsfehler vermieden werden.
Mit dieser Arbeit wurden Planungsgrundlagen für die Bedarfsplanung Alter 2030 der Gemeinde Stans erarbeitet und ein neues Altersleitbild geschaffen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden folgende Fragestellungen bearbeitet?
Was sind die Bedürfnisse und Erwartungen der modernen älteren Bevölkerung, der Gesellschaft und Behörden im Jahr 2030 und wie ist das zu erwartende Mengengerüst?
Wie werden die veränderten Bedürfnisse und Erwartungen finanziert und welche Trägerschaften eignen sich dafür?
Es wird vermutet, dass die ältere Bevölkerung den Heimeintritt mit unterschiedlichen Maßnahmen so lange wie möglich herausschieben möchte.
Mit welchen Maßnahmen wird dies erreicht?
Welchen möglichen Einfluss hat dies auf die Finanzierung?
In welcher Höhe kann dies den öffentlichen Haushalt entlasten?
Welches sind darin die relevanten Faktoren und wie resp. mit welchen Maßnahmen lassen sich diese beeinflussen?
Welchen Einfluss hat die Migration aus Nachbargemeinden oder aus dem Ausland auf die Bedarfsplanung der Zentrumsgemeinde Stans?
Hiervon ließen sich folgende Hypothesen ableiten und wurden im Rahmen dieser Studie überprüft:
Die ältere Bevölkerung hat im Jahr 2030 im Bereich Wohnen, Mobilität und Sicherheit deutlich andere Bedürfnisse als die heutige ältere Bevölkerung.
Um die zukünftigen Bedürfnisse im Bereich Alter erfüllen zu können, sind erhebliche Anpassungen in den Strukturen und der Infrastruktur notwendig.
Die ältere Bevölkerung möchte einen Heimeintritt so lange wie möglich hinausschieben.
Die Bereitschaft zu Freiwilligenarbeit sinkt bei der älteren Bevölkerung.
Die WHO setzt sich seit Jahren für altersfreundliche Städte und Gemeinden ein. Ein lebenslanger und ganzheitlicher Ansatz für aktives und gesundes Altern steht auf vier Pfeilern:
1. Die Förderung einer guten Gesundheit und gesunder Verhaltensweisen in allen Altersgruppen, um chronischen Krankheiten oder ihrer Entstehung vorzubeugen oder sie zu verzögern.
2. Durch die Früherkennung und hochwertige Versorgung die Folgen chronischer Krankheiten minimieren.
3. Die Schaffung einer räumlichen und sozialen Umwelt, die Gesundheit und Teilhabe älterer Mitmenschen fördert.
4. Das Altern neu erfinden – gesellschaftliche Einstellungen verändern, um die Teilhabe älterer Mitmenschen anzuregen.
Gemäss WHO ist eine altersfreundliche Stadt eine integrative und zugängliche städtische Umgebung, welche das aktive Altern fördert.[3]
Im Durchschnitt 20 bis 25 gesunde Jahre erwarten Frauen und Männer nach der Pensionierung, bevor viele Mitte 80 fragiler werden und sich die gesundheitlichen Bedingungen zum Teil stark verändern. Die bisherige Einteilung des Erwachsenenlebens in bloß zwei Phasen – Erwerbs- und Pensionierungsphase – ist damit überholt. Das Gebrauchtwerden in der Zeit auch nach der Pensionierung ist ein Paradigmenwechsel, dessen Bedeutung man kaum überschätzen kann.[4] Zusätzlich zeigt sich, dass die Bevölkerungsgruppe der pensionierten und hochaltrigen Frauen und Männer ausgesprochen heterogen ist: Ihre Ressourcen und gesundheitlichen Bedingungen werden, je älter sie sind, desto unterschiedlicher. Hinsichtlich der Bedürfnisse, Eigenschaften und der Leistungsfähigkeit eines Menschen verliert das chronologische Alter zunehmend an Informationswert. Zurzeit findet ein bedeutender Generationenwandel statt: Wer vor dem 2. Weltkrieg aufgewachsen ist, hat im Alter andere Bedürfnisse als die Angehörigen der „Babyboom“-Generation, die in der Zeit des Wirtschaftsaufschwungs jung gewesen sind. Jetzt gehen diese Babyboomer in Pension – finanziell stärker und anspruchsvoller als ihre Eltern bei deren Pensionierung. So verfügen die Babyboomer beispielsweise über bessere Ausbildungen als ihre Eltern, und die Frauen sind im Gegensatz zu ihren Müttern fast seit ihrer Mündigkeit stimm- und wahlberechtigt.
Die Alterspolitik muss die Heterogenität dieser Bevölkerungsgruppe berücksichtigen. Um flexibel auf Entwicklungen und neue Voraussetzungen reagieren zu können, ist zudem der stete Generationenwandel vorausschauend in die Überlegungen einzubeziehen.
„Die große Herausforderung der Zukunft wird es sein, einerseits aktive ältere Menschen entsprechend ihren Kompetenzen anzuerkennen. … Andererseits geht es darum, pflegebedürftige bzw. demenzerkrankte Menschen würdevoll zu pflegen und zu behandeln. Die Gesellschaft der Zukunft benötigt zwei Alterskulturen: eine Alterskultur für aktive ältere Menschen und eine Alterskultur für pflegebedürftige Menschen gegen das Lebensende hin.“[5]
In den nächsten Jahrzehnten wird der demographische Wandel viele Lebensbereiche unserer Gesellschaft grundsätzlich verändern. Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme sind ebenso absehbar wie auf politische Entscheidungen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Davon sind alle Bevölkerungsgruppen betroffen, ob alt oder jung. Die Demografische Entwicklung wird durch folgende drei Faktoren beeinflusst: Fruchtbarkeit, Sterblichkeit und Internationale Wanderungen.
Für den Kanton Nidwalden, bei dem Stans der Hauptort ist, geht eine Studie der Volkswirtschaftsdirektion davon aus, dass die Bevölkerung bis 2030 dank Zuwanderung noch leicht wachsen wird, sie wird aber gleichzeitig markant älter.[6] Ohne weitere Zuwanderung ist nach 2030 zu erwarten, dass die Bevölkerung in Nidwalden leicht schrumpfen wird. Weil gleichzeitig auch die Erwerbs-Bevölkerung schrumpft, hat dies auch einen relevanten Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons.
Die soziale Errungenschaft der Renten in der Schweiz bringt es mit sich, dass die früheren und heutigen Generationen die Übergänge zwischen Ausbildungsphase, Erwerbsleben und Ruhestand als prägende Einschnitte empfinden. In Zukunft dürften sich Bildung, verschiedene Formen der Erwerbstätigkeit, das familiäre Leben und ihre Pflichten und Freizeitaktivitäten ein Leben lang in loser Folge abwechseln und verbinden.[7] Aktives Altern heißt daher auch Gesundheit als Lebensressource nutzen, seine Unabhängigkeit wahren und am sozialen Leben teilnehmen.[8]
Beim Wohnen ist gerade das unfreiwillige Wohnen in einem Alterssetting, in dem nicht gewählt werden kann und insofern nicht passungsfähig ist, Elemente eines verfehlten Daseins in der letzten Lebensphase.[9] „Wohnsituation und Wohlbefinden sind im Alter eng verbunden.“[10] Es geht letztlich um die gesellschaftspolitische Frage nach dem Separieren von andersartigen Menschen versus die größtmögliche Integration dieser Bevölkerungsgruppen, wie das der älteren, teilweise gebrechlichen Menschen in unserer Gesellschaft.
Bei der Gestaltungsanforderung an die Gemeinden betreffend das Wohnen im Alter lassen sich fünf Handlungsansätze benennen:[11]
1. Stärkung des normalen selbständigen Wohnens in der eigenen Häuslichkeit durch eine altersgerechte Gestaltung des räumlichen Umfeldes und der Wohnungen sowie durch den Ausbau einer sozialen Infrastruktur und niederschwelligen Alltagshilfen.
2. Verbreitung und Weiterentwicklung neuer alternativer selbständiger Wohnformen wie das betreute Wohnen und gemeinschaftlicher Wohnformen.
3. Entwicklung und Verbreitung selbstbestimmter Wohnformen für Pflegebedürftige und demenziell erkrankte Menschen mit Erleichterung der Umsetzungsverfahren für ambulant betreute Wohngemeinschaften.
4. Kleinräumige Organisation und Vernetzung der Wohn- und Betreuungsangebote in den Wohnquartieren.
5. Stärkung von Eigeninitiative und Eigenverantwortung sowie Förderung gegenseitiger Hilfe.
Um die verschiedenen Bedürfnisse zu erfüllen können zusammenfassend von den folgenden sechs Wohnformen im Alter ausgegangen werden:
1. bisherige Wohnung oder Haus
2. kleinere barrierefreie Wohnung (Alterswohnung)
3. Wohngemeinschaft mit gleichaltrigen Personen (Alters-WG, Betreuungs-WG oder Pflege-WG)
4. Wohngemeinschaft mit unterschiedlichen Generationen
5. Mehrgenerationenhaus
6. Zimmer im Pflegeheim
Welche Wohnform im Alter gewählt und die richtige sein wird, ist jedoch sehr individuell und hängt sehr stark von Fakten wie den finanziellen Möglichkeiten, von der Selbständigkeit respektive der Pflegebedürftigkeit, dem Wunsch nach Nähe und Distanz und den benötigten und verfügbaren Wohninfrastrukturen ab. Im Verlauf des Alterns ist ein Wechsel der Wohnform in vielen Fällen die Regel. Bei der Bereitstellung der Wohninfrastruktur muss nicht immer ein neues Gebäude gebaut werden. Mit einer Umnutzung und Umbau von bestehenden Gebäuden besteht die Möglichkeit relativ kostengünstig und zentrumsnah, ohne Verlust von Bauland den Bedarf decken zu können.
In vielen Bereichen der Gesellschaft wird es beim Thema Alter zu einem Umdenken kommen müssen, denn dieser Wandel sollte als Chance begriffen werden. Zentrale Herausforderungen sind die Etablierung einer Kultur des Alterns, ein neues humanes Verständnis des Lebens und der Möglichkeiten im Alter sowie eine familien- und altenfreundliche Gesellschaft und Wirtschaft. Dies erfordert Toleranz und die Bereitschaft zu einem Umdenken und der Veränderung von gesellschaftlichen und sozialen Strukturen, die angesichts der zukünftigen Zusammensetzung der Bevölkerung als nicht mehr tragbar einzuordnen sind.
Wenn eine Gemeinde Bedingungen zu schaffen vermag, welche die Bewohner möglichst lang gesund und fit halten, werden die Kosten für die Gemeinden und die Kantone nicht explodieren, sondern können unter Umständen stabil gehalten oder gesenkt werden. Wenn damit jetzt angefangen wird, können diese Veränderungen nach den Prioritäten der Gemeinde gestaltet werden. Beim Abwarten und Verdrängen, steigen die nicht nur materiellen Kosten des demografischen Wandels deutlich.[12]
Im Bereich öffentlicher Raum gilt es im Alter zu beachten, dass alle wichtigen Infrastruktureinrichtungen, inklusive Tagespflege, maximal 500 Meter entfernt liegen dürfen. Dies bedeutet maximal 1000 Schritte. Damit werden eine hohe Sicherheit und Selbständigkeit im Altersprozess erreicht. Konkret geht es um Anforderungen an die Qualität des öffentlichen Raums und die soziale, kulturelle und gemeinwesenbezogene Infrastruktur, wie zum Beispiel eine gute Nahversorgung, Gaststätten und Cafés, Post, Bank, Ärzte und Apotheken in der Nähe, dazu passende Verbindungen mit dem öffentlichen Verkehr und genügend Sitzbänke an den Wegen und auf Plätzen.[13] Dabei sind folgende Voraussetzungen für die Nutzung der Angebote zu erfüllen:[14]
Durchgängige Gebrauchstauglichkeit
Zugänglichkeit
Gute Orientierung in der Gemeinde
Praktisches Informationssystem auf unterschiedlichen Wegen und für alle Sinne
Dabei decken sich die Anforderungen sehr weitgehend mit denen anderer Gruppen, wie Familien mit Kindern, Behinderten und Touristen. Lebendige Plätze und Einrichtungen mit Ausstrahlung sorgen für Identifikation mit der Gemeinde und sind attraktiv für die dort Lebenden und auch nach außen. Aber wenn sich ältere Menschen nicht mehr aus ihrer Wohnung trauen, kann dies ein erster Schritt in die Einsamkeit bedeuten.
Seit den 1970er-Jahren haben sich in westlichen Gesellschaften zentrale demografische, sozialstrukturelle und sozialpolitische Veränderungen ergeben, die als Dimensionen der Modernisierung immer stärker auf das Verhältnis von Alter(n) und Gesellschaft eingewirkt haben:
1. Deutliche Veränderungen der demografischen Strukturen
2. Qualitativer Strukturwandel wie Verjüngung und Entberuflichung, Feminisierung, Singularisierung und Hochaltrigkeit
„Wenn es der Gesellschaft nicht gelingt, kreativ und proaktiv auf die Verlängerung der Lebensspanne einzugehen, verdammen wir die Älteren der Zukunft dazu, ein Leben wie das der Älteren heute zu führen – und das, obwohl sie gesünder, mental agiler und zu weit mehr fähig sind als die jetzigen Alten.“[15]
Ältere Arbeitnehmer brauchen noch mehr als die jüngeren Zeitsouveränität. Nicht das Unternehmen, sondern sie müssen bestimmen können, wann und wie sie arbeiten. Wo Ältere im Unternehmen geschätzt werden, profitieren die Firmen voll vom Erfahrungsschatz ihrer grauhaariger Mitarbeiter.[16]
Einrichtungen für Kinder und Senioren in enger räumlicher Nähe oder sogar zusammen zu bauen sind überzeugende Ansätze, weil kleine Kinder und Senioren sehr gut zusammen harmonieren und sich gegenseitig bereichern.[17] Die steigende Zahl aktiver und gesunder pensionierter Frauen und Männer ist eine bedeutsame gesellschaftliche Ressource. Aber die meisten älteren Menschen lassen sich nicht fremd bestimmen. Sie möchten die ‚späte Freiheit der Pensionierung‘ auch in der Freiwilligenarbeit genießen. Selbstbestimmtes Engagement älterer Menschen in seiner ganzen Vielfalt ist die Zukunft.[18]
In naher Zukunft muss die Solidarität als Wert neu verankert werden, und zwar mit jenen Menschen, die der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen, sodass er das gesellschaftliche und politische Wirken tatsächlich zu bestimmen vermag. Das erfordert eine deutlich stärkere Betonung folgender Prinzipien:[19]
1. Hilfe so rechtzeitig zu geben, dass größere Schäden vermieden werden, weil die Prävention besser ist als Reparatur.
2. Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, weil es menschlicher ist, Selbstbestimmung und Selbstständigkeit zu fördern.
3. Hilfe zur Gesundung der gesamten Lebenssituation zu geben, weil Menschen nicht nur an körperlichen Krankheiten, sondern auch an psychischen Problemen oder an Unzulänglichkeiten des Zusammenlebens leiden.
4. Hilfe zu einem menschenwürdigen Leben für jene zu leisten, die sich nicht selbst helfen können.
Die aktive Partizipation der Seniorinnen und Senioren im Projekt ‚Alter mit Wirkung‘ ermutigt Menschen in Alterseinrichtungen ihre Aktivitäten und ihre Lebenswelt aktiv mitzugestalten. Das Projekt animiert Menschen im hohen Alter, sich in die Gesellschaft einzubringen. Seine partizipative Arbeitsweise wirkt sich positiv auf die Selbstwirksamkeit aller Beteiligten aus und steigert das Wohlbefinden. Zusätzlich fördert das Programm den generationenübergreifenden Dialog und Begegnungen. Alter mit Wirkung zeigt auf, dass Seniorinnen und Senioren Ideen haben und voller Leben sind.[20]
Es besteht die Gefahr, dass die älteren Personen auf Grund ihrer gesunkenen Mobilität und Selbständigkeit von der Gesellschaft vergessen werden und dadurch vereinsamen. Die persönliche Selbstbestimmung, Stärkung der Selbständigkeit und Maßnahmen gegen die Vereinsamung sind gesellschaftliche Herausforderungen.
Bei der Situationsanalyse der Gemeinde Stans ist folgendes festzustellen: Gemäß Agglomerationsprogramm des Kantons Nidwalden aus dem Jahr 2011 ergibt sich auf Grund der Zentralitätsstruktur der Gemeinde Stans eine überdurchschnittliche Bevölkerungszunahme bis 2030 um Total 20 % auf einen Wert von 9400 Bewohnerinnen und Bewohner.[21] Dies würde bedeuten, dass im Jahr 2030 bereits 2287 Menschen respektive hohe 24 % der Stanser Bevölkerung 65 Jahre und älter wäre. Dieser Wert bedeutet eine leicht tiefere Zahl als der Schweizer Durchschnitt. Davon wären, je nach Berechnungsmethode, 251 bis 255 Personen pflegebedürftig.[22] Auf Grund der geschätzten Bevölkerungsentwicklung kann es sein, dass die Zahl an pflegebedürftigen Personen bis ins Jahr 2035 noch leicht ansteigt, danach zurück gehen könnte und damit nicht mehr alle Pflegebetten benötigt würden. Eine Umnutzung wäre hier anzustreben. Dieser Umstand der späteren Umnutzung sollte bereits in der Planung eines neuen Pflegeheims oder eines Umbaus einfließen.
In der Gemeinde Stans stehen 145 Pflegebetten und 20 Alterswohnungen zur Verfügung.[23] Hier zeigt sich eine leichte Unterversorgung bei den Pflegebetten und eine starke Unterversorgung bei den Alterswohnungen. Bei den Alterswohnungen besteht entsprechend hoher Handlungsbedarf.
Zu den wichtigsten Key-Players im Bereich Alter in der Gemeinde Stans gehören folgende: Pro Senectute, Spitex, Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land, Verein Wohnwandel Nidwalden, Atlantis Wohnbaugenossenschaft Stans, Haushaltring der Bäuerinnen Obwalden und Nidwalden, compagnia - Wir begleiten Senioren in Stans,Schweizerische Alzheimervereinigung Obwalden – Nidwalden und derVerein Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen in Nidwalden. Mit diesem breiten Angebot lässt sich der momentane Bedarf an Pflege, Betreuung und Unterstützung abdecken. Der steigende Bedarf kann mit zusätzlichem Personal und weiteren Angeboten gedeckt werden, ohne zusätzliche Institutionen gründen zu müssen.
Mit der großen Hilfe aller Art durch Freiwillige, Freunde und Verwandte werden jedes Jahr tausende von Stunden, in der Regel kostenlos, geleistet. Dies zeigt eine große Solidarität und verhindert eine Versorgungslücke.
Die Bevölkerungsbefragung, und somit die Partizipation der Bevölkerung an der Gestaltung der Zukunft, ist ein Hauptelement dieser Arbeit. Die Antworten dienen als Grundlage für die Erarbeitung der Bedarfsplanung für ein altersfreundliches Stans und für die Erarbeitung des Altersleitbildes 2030. Befragt wurden 1‘000 Personen,verteilt auf Schweizer und niedergelassene Ausländer (Verhältnis gemäß dem Ausländeranteil), pro Haushalt maximal 1 Fragebogen, Gender: 500 Frauen, 500 Männer, Alterssegment: 40 bis 99 Altersjahre. Die Befragung erfolgte von Januar bis Februar 2014. Von den 1‘000 versandten Frageboten wurden 618 retourniert. Davon waren 3 leer. 615 ausgefüllte Fragebogen konnten ausgewertet werden. Der älteste Teilnehmer ist 95 Jahre alt, die älteste Teilnehmerin ist 93 Jahre alt.
Mit dem sehr hohen Rücklauf von 61.8 % können die nachfolgenden Ergebnisse als repräsentativ betrachtet werden. Von den 40 bis 64-jährigen Personen haben 55.4 % den Fragebogen ausgefüllt und retourniert, bei den 65-jährigen Personen und älter waren es sehr hohe 63.9 %, obwohl bei den hochaltrigen Personen eine eher tiefe Antwortquote erreicht wurde. Dieser überraschend sehr hohe Rücklauf in der Bevölkerungsbefragung zum Thema Alter zeigt das hohe Interesse und die Aktualität dieser Thematik. Die Betroffenheit ist hoch. Gemäß der Erhebung sind die Top-Ten Aussagen für ein altersfreundliches Stans sind die folgenden:
1. Alterswohnungen / günstige Kleinwohnungen / betreut, zentrumnah
2. Rollstuhl / Rollator freundlich werden / Kopfsteinpflaster entfernen oder Asphaltstreifen / Trottoirabsenkungen bei den Fußgängerstreifen
3. Mehr Sitzbänke / Bäume / Parkanlagen
4. Fußgängerstreifen in der Tempo 30 Zone
5. Besserer Winterdienst
6. Besseres ÖV-Angebot / bessere Anbindung in den Quartieren / Ortsbus
7. Fördern von neuen Wohnformen
8. Erhalt Dorfläden
9. Bessere Straßenbeleuchtung
10. Mehr öffentliche, zugängliche WC’s
Die Stanserinnen und Stanser sind sehr mündig und wissen genau was sie wollen und benötigen. Ihre Anliegen und Ideen konnten sie mit der Teilnahme an der Befragung platzieren.Die total 49‘714 Antworten und davon die 2‘102 Antworten aus offenen Fragen, Bemerkungen und Kommentaren können als legitimer politischer Auftrag und Ausdruck der direkten Demokratie für die weitere Bearbeitung und Umsetzung betrachtet werden. In vielen Punkten gibt es eine hohe Übereinstimmung und es ist ein gemeinsames Verständnis erkennbar.
Hingegen sind sich die Stanserinnen und Stanser der demografischen Entwicklung und deren Folgen scheinbar noch nicht bewusst. Hier sollte man mit Vorteil kommunikative Maßnahmen zur Sensibilisierung getroffen und spezifische Maßnahmen umgesetzt werden. Ein positiver ungeplanter Nebeneffekt dieser Befragung ist, dass aus den Antworten viele wertvolle und kreative Impulse für andere Projekte und Vorhaben der Gemeinde Stans entnommen werden konnte.
Für den Bereich Alter besteht auf Gemeindeebene bislang noch kein Leitbild. In einer Synthese aus den theoretischen Aussagen und Erkenntnisse und den Aussagen und Erkenntnissen aus der Auswertung der Bevölkerungsbefragung wurde ein Altersleitbild für die Gemeinde Stans entwickelt. Das Stanser Altersleitbild 2030 besteht aus einer Vision und Leitsätzen.Die Vision beschreibt den übergeordneten Zweck der Alterspolitik 2030 der Gemeinde Stans und das angestrebte Zukunftsbild des Lebensraums der älteren Bevölkerung der Gemeinde. Sie dient als Leitplanke für die Formulierung und Umsetzung des Stanser Altersleitbildes 2030. Die Leitsätze enthalten die Grundwerte, an denen sich die Alterspolitik orientiert. Die Vision lautet wie folgt:
Stans ist eine generationenfreundliche Gemeinde. Das alters- und familienfreundliche Umfeld unterstützt eine große Selbständigkeit und aktive Teilnahme am sozialen Leben bis ins hohe Alter. Ältere Menschen können in Stans verschiedene Wohnformen wählen und sich dabei auf ein breites Angebot an Dienstleistungen und Betreuungsformen stützen. Stans fördert ein selbstbestimmtes Altern in Würde.
Abgeleitet vom Stand der Wissenschaft (Theorie), den konsolidierten Umfrageergebnissen und dem Altersleitbild 2030 konnte ein Entwurf für die Bedarfsplanung Alter 2030 der Gemeinde Stans erstellt und dargestellt werden. Diese Bedarfs- und Maßnahmenplanung enthält 50 Punkte und wird nach den vorgängig definierten 9 Handlungsfeldern strukturiert. Diese Handlungsfelder lauten wie folgt:
Versorgungssicherheit, Information/Öffentlichkeitsarbeit/Vernetzung, Existenzsicherung, Wohnen, Öffentlicher Raum und Quartiere, Ressourcen/Potentiale/Fähigkeiten und Freiwilligen-Engagement im Alter, Generationenbeziehungen, Gerontologische Zukunftsthemen, Gesundheitsförderung im Alter.
Dabei ziehen sich die fünf Querschnittthemen durch sämtliche Aufgabenbereiche hindurch und sind in jedem Handlungsfeld berücksichtigt: Heterogenität des Alters, Integration und Partizipation, Gender, Migration, Besonders verletzliche Personen.
Mit der Umsetzung dieses 50 Punkte Planes wird die Gemeinde Stans in einer Sublimierung einen großen Schritt in Richtung altersfreundliche und generationenfreundliche Gemeinde machen. Die Vision und die Ziele des Altersleitbildes 2030 werden damit in den wichtigsten Punkten erreicht.
Die Priorisierung und Einführung des neuen Maßnahmenplans für ein altersfreundliches Stans soll mit Vorteil im Rahmen eines Projekts umgesetzt werden. Die Projektgruppe soll von bestehenden und allenfalls neuen zu gründende Fach-Arbeitsgruppen unterstützt und entlastet werden. Im Rahmen des Umsetzungsprojekts sollen die Bearbeitung der Themen mit Vorteil in Teilprojekten und Arbeitspaketen erfolgen. Jede Dimension (Teilprojekt) muss dabei von einer zweckmäßigen internen und externen Kommunikation mit Unterstützung der Dimension Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung begleitet werden. Im Weiteren besteht die Gefahr, dass bei der Umsetzung eines umfassenden Maßnahmenplans für eine altersfreundliche Gemeinde eine Reihe von Akzeptanz-, Führungs-, Politik- und Organisationsbarrieren entgegen stehen, die wahrgenommen und mit geeigneten Gegenmaßnahmen überwunden werden müssen.
Die heute fehlende Wohninfrastruktur im Bereich Alterswohnungen und Wohngemeinschaften kann in Stans durch Neubauten oder einer Umnutzung respektive Umbau von bestehenden Gebäuden, welche nicht mehr in der bisherigen Form genutzt werden, in Stans mehr oder weniger zentrumsnah realisiert werden. Es gibt mehrere Gebäude in Stans welche in diesem Thema Potenzial haben.
Die Schaffung von Alterswohnungen kann am ehesten mit einer Stiftung oder Baugenossenschaft realisiert werden. Die Gemeinde und die Age Stiftung kann ein Bauvorhaben für Alterswohnungen insbesondere darum unterstützen, damit diese Wohnungen für die Mieter zu günstigen Konditionen angeboten werden können und damit der Bau dieser Alterswohnungen überhaupt realisiert wird. Günstige Konditionen sind wichtig, damit die Seniorinnen und Senioren überhaupt ihre bisherige, oft zu große Wohnung verlassen. Somit werden die Wohnungen für Familien frei. Deshalb ist der Bau von Alterswohnungen auch eine familienpolitische Maßnahme.
Zu den wichtigsten Anbietern zum Thema Alter im Kanton Nidwalden gehört die Pro Senectute Nidwalden und die Spitalexterne Krankenpflege (Spitex). Es gibt eine Vielzahl von weiteren Anbietern die in Vereinen, Stiftungen, juristischen Personen im Öffentlichen- oder Privatbesitz organisiert sind. Einige Anbieter verfügen über eine Leistungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Anbieter um die Erbringung von gewissen gewünschten Leistungen sicher zu stellen.
Wichtig zu erwähnen ist, dass die Altenpflege und Altersbetreuung für viele Arbeitsnehmer und Unternehmer sichere Arbeitsplätze garantiert und ein Wachstumsmarkt darstellt.
Der demographische Wandel wird viele Lebensbereiche unserer Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten grundsätzlich verändern. Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme sind ebenso absehbar wie auf politische Entscheidungen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Betroffen davon sind alle Bevölkerungsgruppen, ob alt oder jung. Die Entwicklungstrends des demographischen Wandels, ihre Folgen und mögliche Handlungskonzepte sind deshalb wichtige Themen in der Politik, welche viel Leidenschaft, Verantwortungsgefühlt und Augenmaß benötigt.
Das Thema Alter ist für Gemeinden wie auch für den Kanton Nidwalden eine große zukünftige Herausforderung. Viele Gemeinden haben erkannt, dass es sich lohnt, den älter werdenden Menschen das Wohnen zu Hause oder in Alterswohnungen möglichst lange zu erleichtern. Beide Wohnformen entlasten die stationären Einrichtungen. Ein vielfältiges, ausreichendes Angebot an altersgerechten Wohnungen wird zunehmend als Standortvorteil gesehen.
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
MANAGEMENT SUMMARY
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Tabellenverzeichnis
1. EINLEITUNG
1.1 Untersuchungsgegenstand
1.2 Forschungsfragen
1.3 Wissenschaftlicher Nutzen
1.4 Hypothesen
1.5 Bedeutsamkeit der Fragestellung
1.6 Ergebnisse
1.7 Theoretischer Kern der Arbeit
1.8 Neuigkeitswert
1.9 Verwendete Methoden
2. KURZVORSTELLUNG des Autors und der Gemeinde Stans
2.1 Vita und Publikationen des Autors
2.2 Politische Gemeinde Stans
3. Alter und altern – eine Theoretische Betrachtung
3.1 WHO für eine altersfreundliche Welt
3.2 Dublin Declaration für altersfreundliche Städte - Beispiel Bern
3.3 Alter und Überalterung
3.4 Demografische Entwicklung
3.5 Alter und Gesundheit - gesund altern
3.6 Alter und Wohnen
3.7 Alter und öffentlicher Raum
3.8 Alter und Gesellschaft
3.9 Fazit und Maßnahmen
4. Situationsanalyse zum Thema Alter in Stans
4.1 Demografische Entwicklung in Stans
4.2 IST-Situation über die vorhandenen Angebote zum Thema Alter
4.2.1 Pflegebettensituation in Stans
4.2.2 Key-Players zum Thema Alter in Stans
4.3 Fazit
5. BEVÖLKERUNGSBEFRAGUNG IN STANS
5.1 Vorbemerkung
5.2 Befragung für ein altersfreundliches Stans
5.2.1 Kennzahlen der Befragung
5.2.2 Antworten/Aussagen, Erkenntnisse und Konsequenzen
5.2.3 Kommentar zur Auswertung nach Alterssegmenten
5.2.4 Top-Ten der Aussagen aus den offenen Fragen
5.3 Fazit
6. Vision und STANSER ALTERSLEITBILD 2030
6.1 Leitbild der Gemeinde Stans
6.2 Stanser Altersleitbild 2030
7. BEDARFSPLANUNG ALTER 2030 DER GEMEINDE STANS
7.1 Maßnahmenplanung für ein altersfreundliches Stans
7.1.1 Versorgungssicherheit
7.1.2 Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung
7.1.3 Existenzsicherung
7.1.4 Wohnen
7.1.5 Öffentlicher Raum und Quartiere
7.1.6 Ressourcen, Potentiale, Fähigkeiten und Freiwilligen-Engagement im Alter
7.1.7 Generationenbeziehungen
7.1.8 Gerontologische Zukunftsthemen
7.1.9 Gesundheitsförderung im Alter
7.2 Umsetzung des Maßnahmenplans
7.3 Herausforderung der Zukunft im Bereich Wohnen
7.4 Finanzierung und Trägerschaft
7.4.1 Wohninfrastruktur
7.4.2 Aufenthalt im Pflegeheim
7.4.3 Maßnahmen und Angebote fürs Alter
8. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK
8.1 Überprüfung der Fragestellung und der Hypothesen
8.2 Ausblick
LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Lebenserwartung bei Geburt nach Geschlecht
Abbildung 2: Lebenserwartung mit 65 Jahren nach Geschlecht
Abbildung 3: Good health adds life to years: Global brief for World Health Day 2012. Seite 9
Abbildung 4: Prognose der Anzahl Hundertjähriger von 2010 bis 2100
Abbildung 5: Entwicklung der Anzahl der 65–79-Jährigen und der 80+-Jährigen gemäss den drei Grundszenarien
Abbildung 6: Jugend- und Altersquotient der Schweiz
Abbildung 7: Erwerbsbevölkerung 2010-2060. Mittleres Szenario
Abbildung 8: Wanderungssaldo der EWR-Staatsangehörigen
Abbildung 9: Wanderungssaldo der Nicht-EWR-Staatsangehörigen
Abbildung 10: Wanderungssaldo der Schweizer
Abbildung 11: Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz. Vergleich BFS, UNO und Eurostat
Abbildung 12: Bevölkerungsstruktur in Österreich
Abbildung 13: Demenzdorf De Hogeweyk. Luftbild
Abbildung 14: Demenzdorf De Hogeweyk. Situationsbild
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Stand und Prognose Bevölkerung 65-79, 80+ und 65+in der Gemeinde Stans
Tabelle 2: Prognose pflegebedürftiger Menschen 65+/80+ in der Gemeinde Stans
1. EINLEITUNG
1.1 Untersuchungsgegenstand
In der Altersbetreuung besteht in der Gemeinde Stans ein zunehmender Bedarf nach Leistungen im präventiven, ambulanten und stationären Bereich. Damit dieser Bedarf abgedeckt werden kann, sind finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen rechtzeitig einzuplanen. Diese Planung soll die Grundlage schaffen, damit die erforderlichen Maßnahmen optimal aufeinander abgestimmt werden können. Durch eine langfristige und abgestimmte Planung können der Ressourceneinsatz optimiert und Planungsfehler vermieden werden.
Damit der zu ermittelnde Bedarf gedeckt werden kann, müssen Leistungen (Heimplätze, Morgen-/Mittags-/Abendtische, Pflege intern/extern etc.) angeboten werden. Die Leistungen werden vom Angebotsmix beeinflusst. Existiert eine gut ausgebaute häusliche Pflege (Spitex) wird ein Heimeintritt nicht nötig oder zumindest erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die Herausforderung besteht nun darin, das Angebot so zu planen, dass der richtige Leistungsmix entsteht, welcher wiederum einen haushälterischen Einsatz der Ressourcen garantiert.
Mit dieser Arbeit sollen Planungsgrundlagen für die Bedarfsplanung Alter 2030 der Gemeinde Stans erarbeitet und ein neues Altersleitbild für die Gemeinde Stans geschaffen werden.
1.2 Forschungsfragen
1. Was sind die Bedürfnisse und Erwartungen der modernen älteren Bevölkerung, der Gesellschaft und Behörden im Jahr 2030 und wie ist das zu erwartende Mengengerüst?
2. Wie werden die veränderten Bedürfnisse und Erwartungen finanziert und welche Trägerschaften eignen sich dafür?
3. Es wird vermutet, dass die ältere Bevölkerung den Heimeintritt mit unterschiedlichen Maßnahmen so lange wie möglich herausschieben möchte.
a. Mit welchen Maßnahmen wird dies erreicht?
b. Welchen möglichen Einfluss hat dies auf die Finanzierung?
c. In welcher Höhe kann dies den öffentlichen Haushalt entlasten?
4. Welches sind darin die relevanten Faktoren und wie resp. mit welchen Maßnahmen lassen sich diese beeinflussen?
5. Welchen Einfluss hat die Migration aus Nachbargemeinden oder aus dem Ausland auf die Bedarfsplanung der Zentrumsgemeinde Stans?
1.3 Wissenschaftlicher Nutzen
Die Bedürfnisse und Möglichkeiten der älteren Bevölkerung stehen in einem stetigen Wandel. Dazu werden regionale Unterschiede erwartet. Der vorausschauende Blick ins Jahr 2030 als Grundlage für die weitere Planung im Kantonshauptort Stans im ländlichen Kanton Nidwalden ist einmalig und wissenschaftlich bislang noch nicht untersucht. Die geplante Bevölkerungsbefragung liefert verlässliche empirische Informationen für die Wissenschaft und zur Erarbeitung eines Maßnahmenplans.
1.4 Hypothesen
1. Die ältere Bevölkerung hat im Jahr 2030 im Bereich Wohnen, Mobilität und Sicherheit deutlich andere Bedürfnisse als die heutige ältere Bevölkerung.
2. Um die zukünftigen Bedürfnisse im Bereich Alter erfüllen zu können, sind erhebliche Anpassungen in den Strukturen und der Infrastruktur notwendig.
3. Die ältere Bevölkerung möchte einen Heimeintritt so lange wie möglich hinausschieben.
4. Die Bereitschaft zu Freiwilligenarbeit sinkt bei der älteren Bevölkerung.
1.5 Bedeutsamkeit der Fragestellung
Gegenüber anderen Gemeinden besteht bei der Gemeinde Stans unter anderem ein Aufholbedarf im Bereich hindernisfreier und altersgerechter Wohnraum mit Serviceleistungen. Damit diese Lücke geschlossen, auf die bedrohliche demografische Entwicklung rechtzeitig reagiert und allfällige bauliche Möglichkeiten koordiniert und bedarfsgerecht zur Umsetzung kommen, ist es notwendig, die Situation im Bereich Alter zu analysieren, verlässliche Fakten zu eruieren und einen entsprechenden Maßnahmenplan zu erarbeiten.
1.6 Ergebnisse
1. Bedarfsplanung Alter 2030 der Gemeinde Stans
a. Verlässliche Zahlen und Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung insbesondere zur Alterung der Gesellschaft
b. Ermittelte Problemfelder respektive Handlungsfelder als Folge der Alterung der Gesellschaft
c. Maßnahmenplan mit Blick auf das Jahr 2030 (Grobkonzept)
2. Stanser Altersleitbild 2030
1.7 Theoretischer Kern der Arbeit
Übersicht und Konzentrat zum Stand der Wissenschaft in Bezug zur Alterung der Gesellschaft und Altersplanung.
1.8 Neuigkeitswert
Bedarfsplanung Alter 2030 der Gemeinde Stans
Stanser Altersleitbild 2030
1.9 Verwendete Methoden
Internet- und Literatur-Recherche
Empirische Feldforschung: Bevölkerungsbefragung als Grundlage für die Bedarfsplanung und das Altersleitbild
Konzeptionelles Vorgehen in der Entwicklung der Bedarfsplanung und das Altersleitbild
2. KURZVORSTELLUNG des Autors und der Gemeinde Stans
2.1 Vita und Publikationen des Autors
Lukas Liem, Seestraße 113a, CH-6052 Hergiswil, [email protected], 42-jährig, arbeitet als Gemeindeschreiberin-Stellvertreter bei der Politischen Gemeinde Stans. In dieser Funktion ist er gleichzeitig Leiter der beiden Abteilungen Soziales/Gesundheit und Zentrale Dienste. Er verfügt über ein MBA in General Management und einen Master of Public Management, ist Sozialversicherungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis und bildete sich auf Fachhochschulniveau in Führung, Prozessmanagement und Projektmanagement weiter.
Vita
Publikationen
Liem, Lukas (2005). Kommunikation von schwerwiegenden Entscheidungen. Methoden, Vorgehen und relevante Eckpunkte für die erfolgreiche Kommunikation in der Organisation und die Auswirkung auf das Individuum. München: GRIN Verlag. ISBN (Buch): 978-3-640-95834-4 / ISBN (eBook) 978-3-640-95797-2 Liem, Lukas (2010). Entwicklung und Einführung eines systematischen Reklamationsmanagements. München: GRIN Verlag. ISBN (Buch): 978-3-640-79511-6 / ISBN (eBook): 978-3-640-79505-5 Liem, Lukas (2014). Reklamationsmanagement. Entwicklung und Einführung am Beispiel einer Krankenversicherung. Hamburg: Diplomica Verlag. ISBN 978-3-95485-067-9