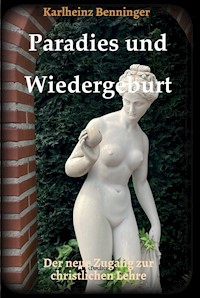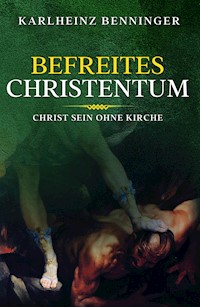
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch will die christliche Lehre in verständlicher Form darlegen. Diese Darlegungen wird kein kirchlicher Theologe widerlegen können. Der Autor will dabei niemanden zum Kirchenaustritt überreden. Er will mit seinem Buch vielmehr denen, die die Kirche aus Enttäuschung verlassen haben, Halt in der ursprünglichen christlichen Lehre geben. Das Buch befasst sich mit allen "Ketzern" und auch mit den von der Kirche verbotenen Evangelien - den Apokryphen. Es ist auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und Forschung, aber so geschrieben, dass es auch von theologischen Laien gut verstanden werden kann. Dieses Buch stellt das Christentum vom Kopf wieder auf die Beine.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Karlheinz Benninger
Befreites Christentum
Christ sein ohne Kirche
BEFREITES CHRISTENTUM
CHRIST SEIN OHNE KIRCHE
KARLHEINZ BENNINGER
© 2020 Karlheinz Benninger
Befreites Christentum – Christ sein ohne Kirche
Umschlaggestaltung: tredition GmbH
Titelbild: Michael, Wahrheit, zertritt der Schlange Religion den Kopf.
Nach einem Motiv von Guido Reni, „Der Kampf des Erzengels Michael mit dem Satan“, ca. 1636 (Wikimedia Commons)
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Taschenbuch:
978-3-347-07239-8
ISBN Hardcover:
978-3-347-07240-4
ISBN e-Book:
978-3-347-07241-1
Abbildungen aus: Othmar Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, 3. Aufl. 1984. Benzinger Verlag Zürich, Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Leitgedanken
Einladung
Prolog
1 Ein-Gott-Glaube und Monotheismus
2 Gott und die Gottesbilder
3 Die eine Bibel? – Zwei gegensätzliche Gottesbilder
4 Die christliche Lehre – Das neue Bild von Gott und Mensch
4.1 Himmelreich und Quantenphysik
4.2 Was nicht zur christlichen Botschaft gehört
4.3 Grundlagen des Verständnisses
4.4 Der Neue Weg
4.5 Was bedeutet »Glaube« in der Christlichen Bibel?
4.6 Die Weihnachtsgeschichte des Lukas – Der Geburtsmythos des Christus
4.7 Die jungfräuliche Geburt
4.8 Buße tun? – Das radikal neue Weltbild
4.9 Der Johannesprolog
4.10 Sündenschuld und Vergebung
5 Die Hieroglyphen – Die großen Symbole
5.1 Die großen Symbole des Alten Orient
5.2 Die sieben Namen Gottes
5.3 Die sieben Schöpfungstage als Schlüssel zum Verständnis der Christlichen Bibel
6 Proben aufs Exempel
6.1 Übersicht über die Ideen
6.2 Die Antwort an Johannes den Täufer
6.3 Psalm 23
6.4 Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
6.5 Stadt- und Turmbau zu Babel
7 Der Kern der christlichen Lehre
7.1 Die Bergpredigt
7.2 Die Seligpreisungen
7.3 Das Gebet des Herrn
7.4 Die Feindesliebe
8 Kein Tod am Kreuz?
9 Die Auferstehung
10 Der Satan und seine Dämonen
11 Gottesmutter Maria – Die weibliche Seite GOTTES
12 Die griechisch-christlichen Lehrer
13 Markion der Ketzer
14 Exkurse
Erläuterungen
Verzeichnis der zitierten Literatur
Der naive Glaube – darüber dürfen wir uns nicht täuschen – besteht heute nicht mehr, auch nicht in den breiten Schichten des Volkes, und er lässt sich auch nicht mehr durch rückwärts gerichtete Betrachtungen und Maßregeln wieder lebendig machen.
Max Planck, Religion und Naturwissenschaft
Eine Religion, die sich vor Wissenschaft fürchtet, schändet Gott und begeht Selbstmord.
Sobald wir unsere Augen gebrauchen, verlassen wir diese Sekten oder gedankenlosen Gemeinschaften und verbinden uns mit Gott in einer einzigen Gemeinschaft.
Ralph Waldo Emerson – Tagebücher
Es ist möglich, dass sich die Menschheit an der Schwelle eines goldenen Zeitalters befindet, wenn dies jedoch der Fall ist, muss zuerst der Drache getötet werden, der den Eingang bewacht, und dieser Drache ist die Religion.
Bertrand Russel
Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
Johannes 8, 32
Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen … und niedergeworfen wurde der große Drache, die alte Schlange, Diabolus und Satan geheißen, der die ganze Welt irreführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel mit ihm.
Offenbarung 12, 7 ff
Einladung
Sie haben die Kirche über Bord geworfen. Und Gott gleich hinterher? Keine besonders gute Idee! Denn was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nichts! Sinnlosigkeit gibt Ihnen aber weder Halt noch bietet sie Orientierung.
Das alte, von der Kirche vor Jahrhunderten festgeschriebene Gottesbild ist allerdings schon längst hoffnungslos veraltet und von der Wissenschaft in so gut wie allen Punkten als unstimmig widerlegt. Es taugt bestenfalls noch fürs Museum. Überdies hat es mit dem Gottesbild, das Jesus der Christus verkündete, herzlich wenig zu tun. Jesus wollte seine Lehre in keine religiös organisierte Form einzwängen.
Die christliche Lehre enthält eine Lebensphilosophie und fußt wie die platonische auf einem durch und durch positiven Bild von Gott und auf der Überzeugung, dass sich die Gotteserkenntnis stetig und unaufhaltsam weiterentfalten und der heilenden Wahrheit annähern wird. Diese Philosophie hat bis heute nichts von ihrem Wert, ihrer Schönheit und ihrer sinnstiftenden Kraft verloren, ja ihre Richtigkeit wird gerade heute durch die Erkenntnisse der Quantenphysik bestätigt und erhält durch sie eine ganz neue Aktualität.
Die Lektüre dieses Buches kann eine erhellende und befreiende Wirkung für Sie haben: Sie werden erkennen, dass der »Vater«, von dem Jesus spricht, alles andere als ein strafender Gott, sondern ein Gott der Liebe ist. Diese Erkenntnis macht Sie frei für die Kraft einer LIEBE, die Sie zu immer höherer geistiger Entfaltung und in die Freiheit der Kinder GOTTES führen will.
Ein Hinweis an den Leser
Alle Kapitel wurden so verfasst, dass sie, auch wahlweise gelesen, leicht verständlich sind.
Prolog
Wenn wir die menschliche Geschichte betrachten, beobachten wir vordergründig, wie große Reiche und Staatsideologien entstehen, wachsen, blühen und untergehen. Hinter all diesen Kreisläufen des Rades der Fortuna sahen die Griechen ein Naturgesetz am Wirken, das sie anánke (Gesetz) oder díke (Gerechtigkeit) nannten. Die Babylonier hatten es me, die Ägypter ma’at genannt. Platon definiert dieses Gesetz so: Gott hält, wie ja auch ein alter Spruch sagt, Anfang und Ende wie auch die Mitte aller seienden Dinge, und er kommt geradewegs zum Ziel auf einer Kreisbahn, wie es seiner Natur entspricht. Ihn begleitet aber stets Dike als rächende Strafe für die, die vom göttlichen Gesetz abweichen. An sie hält sich demütig und in die Ordnung eingefügt, wer glücklich sein will. Wer aber in Starrsinn sein Haupt hebt,… der bleibt von Gott verlassen und allein.
In dieser Verlassenheit aber zieht er noch andere, die seinesgleichen sind, auf seine Seite. Er tanzt aus der Reihe und bringt damit zugleich die gesamte Gesellschaftsordnung ins Wanken. Und auf viele macht er großen Eindruck. Es dauert aber gar nicht lange, und er zahlt an Dike eine empfindliche Strafe: Er hat sich persönlich, sein Haus und den Staat von Grund auf ruiniert (Nomoi/Gesetze 716).
Auf der Metaebene ist die göttliche Kybernetik der Philosophia Perennis zu erkennen, die die geistige Evolution steuert. Das ganze Geschehen lässt sich mit dem Jahreszyklus eines Apfelbaumes vergleichen: Im Frühling entfalten sich die Knospen, im Sommer wachsen die Früchte, sie reifen im Herbst, und im Winter fallen Früchte und Blätter ab und er steht wieder kahl da – ein sich immer wiederholender Kreislauf. Und doch, beim näheren Hinsehen sind Stamm und Äste gewachsen.
Dike ist auch der Name für eine Göttin. Göttin deshalb, weil das kybernetische Gesetz als ein universales, unentrinnbares Naturgesetz erkannt wurde.
(Euer Vater im Himmel) lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und spendet Regen für Gerechte wie Ungerechte, heißt es in der Christlichen Bibel. Weiter bei Paulus: All das wird vom Licht aufgedeckt und offenkundig gemacht; denn alles, was zu Tage kommt, ist Licht.
Dieses Gesetz des Wachstums gilt also für Gerechtes und Ungerechtes, für Gutes und Böses. Das eine wird zu weiterer Entfaltung angespornt, das andere wie eine Seifenblase in die Selbstzerstörung getrieben.
Alle Menschen streben von Natur aus nach Erkenntnis (Aristoteles, Metaphysik). Ihnen kommt der göttliche Logos zu Hilfe. Dieser Logos war schon zu Anfang da. Er bringt für den menschlichen Verstand das Licht der Einsicht, und das mentale Dunkel kann ihm keinen Widerstand entgegensetzen (nach Johannes 1, 1 ff).
Zu jeder Zeit und in jeder Tradition gab und gibt es für die WAHRHEIT empfängliche Denker und Seher. Der Hindu Ram Adhar Mall sagt es so: Die göttlichen Seher sind gleichsam sehr feine Empfangsstationen für die ewige Offenbarung, die unaufhörlich ausströmt (Mall, Hinduismus 24). Die zentrale Behauptung der Philosophia Perennis lautet, dass der Mensch wachsen und sich über die ganze Hierarchie bis hin zu GEIST entwickeln kann, wo er die »höchste Identität« mit der Gottheit verwirklicht, dem ens perfectissimum, dem alles Wachstum und alle Evolution zustrebt (Wilber, Das Wahre 77).
Die großen Seher, von Platon Propheten genannt, haben sich aus der Grauzone menschlichen Wissens hinauf zu mehr Licht bewegt. Sie haben gewisse Einsichten in die WAHRHEIT gewonnen und veraltete Vorstellungen abgeworfen. Um sich ihren Zeitgenossen verständlich zu machen, mussten sie dabei zur Bilder- und Vorstellungswelt ihrer Gegenwart greifen, wollten damit aber keineswegs ein Weltbild festschreiben.
Da ihre Aussagen inzwischen oft Jahrtausende zurückliegen und das zugrunde liegende Weltbild von der modernen Physik in vielem berichtigt worden ist, weisen ihre Darlegungen inzwischen zwangsläufig eine veraltete, zum Teil unverständlich gewordene Bildhaftigkeit auf – sie begegnen uns gewissermaßen in sehr altertümlicher Kleidung, die schon lange aus der Mode gekommen ist. Wird die Jahrtausende alte Bilderwelt jedoch in die moderne Semantik übersetzt, vielleicht in die philosophischen Begriffe, so ergeben die alten Erkenntnisse zusammen mit unserem heutigen Wissen ein zusammenhängendes, stimmiges Gesamtbild. So gleicht die Philosophia Perennis einem Fackellauf, bei dem große Seher das Licht ihrer Erkenntnis an den nächsten, der dafür empfänglich ist, weiterreichen.
Auf diesem langen Stufenweg hin zu Geist ist auch die christliche Lehre des Evangeliums ein bedeutendes, fortschrittliches Glied und eine der schönsten Perlen in der langen Kette der philosophischen Tradition, weil sie bereits vom griechisch-hellenistischen Geist beeinflusst ist und von seinem wissenschaftlich-philosophischen Instrumentarium Gebrauch machen konnte.
Überall da, wo eine Wahrheit als zündende Idee bei einem empfänglichen Geist einschlägt, schafft sie Licht. Und dieses Licht bleibt jetzt in seinem Wirken irreversibel wie der Stern von Bethlehem, der ein völlig neues Paradigma von Gott und Mensch aufleuchten ließ.
Kapitel 1
Ein-Gott-Glaube und Monotheismus
Obwohl sich der Ein-Gott-Glaube immer als Monotheismus ausgibt, müssen beide strikt auseinandergehalten werden. Der Ein-Gott-Glaube, griechisch Henotheismus, geht davon aus, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Zur Zeit gibt es drei Religionen, die diesen Ein-Gott-Glauben unter dem Namen Monotheismus verfechten. Aber siehe da – sie haben von diesem einzigen Gott jeweils ein völlig anderes Bild entworfen. Ihre Gottesbilder berufen sich jeweils auf Offenbarungen, die seit vielen Jahrhunderten in ihren heiligen Schriften fixiert sind. Dem steht aber das Wesen des GEISTES gegenüber: Die Offenbarwerdung des Absoluten, besser: die Selbstpräsentation des GEISTES (Erich Jantsch), dauert zeitlos an. Es ist eine Sünde wider den GEIST (Mt 12, 31), Offenbarung jemals für abgeschlossen zu erklären: Der GEIST weht, wo er will … aber man weiß nicht, woher er kommt und wohin er weht (Joh 3, 8). Zudem sind diese altüberlieferten Gottesbilder keineswegs untereinander kompatibel. Können denn ganz und gar gegensätzliche Gottesvorstellungen oder Gottesbilder denselben Gott abbilden? Wohl kaum. Wir erleben die Anhänger des Ein-Gott-Glaubens als intolerant, denn sie lassen nur ein einziges Gottesbild gelten, nämlich ihr eigenes.
In einem Punkt stimmen die gegenwärtigen Formen des Ein-Gott-Glaubens allerdings überein: In jeder hat Gott noch eine andere Macht als Gegenspieler, einen Widersacher, Teufel oder Satan genannt. Wo geglaubt wird, dass es neben dem einen Prinzip des Guten auch ein Prinzip des Bösen gebe, neben der Allmacht noch ein weitere Macht, weil es zu allem auch ein Gegenteil geben müsse, dort liegt kein Monotheismus vor, sondern eine Spielart des Dualismus.
In einem regelrechten, noch nie erlebten Rausch der Zerstörung – den viele Nichtchristen voll Entsetzen beobachteten – richtete die christliche Kirche im 4. und 5. Jahrhundert eine schier unfassbare Anzahl von Kunstwerken zugrunde. Klassische Statuen wurden von ihren Sockeln gestoßen und verunstaltet, Arme und Beine abgeschlagen. Tempel wurden eingerissen und niedergebrannt. Einen Tempel, der weithin als prächtigster im ganzen Imperium galt, machten die Christen buchstäblich dem Erdboden gleich. … Auch Bücher, die damals vielfach in Tempeln aufbewahrt wurden, blieben nicht verschont. Die Relikte der größten Bibliothek der Antike, die einst an die 700 000 Bände umfasst hatte, wurden ebenfalls von den Christen vernichtet. Es sollte mehr als tausend Jahre dauern, bevor es wieder eine Bibliothek mit auch nur annähernd so vielen Büchern geben sollte. Die Werke der zensierten Philosophen waren verboten, und im ganzen Reich brannten Scheiterhaufen, auf denen die verbotenen Bücher landeten. … Gerade einmal ein Hundertstel der lateinischen Literatur überlebte die Jahrhunderte. 99 Prozent sind für immer verschwunden (Nixey, Zorn 19 bis 21). Mit Äxten bewaffnete Mönche hatten ein Haus überfallen, das als Schrein
„dämonischer“ Götzenbilder galt, und es vollkommen zerstört. Die Gewalt hatte sich rasch ausgebreitet. In ganz Alexandria hatten die Christen sämtliche Darstellungen der alten Götter beschlagnahmt; sie hatten sie aus Thermen und Privatwohnungen geholt, mitten in der Stadt zu einem großen Scheiterhaufen aufgetürmt und in Brand gesteckt … In Alexandria hatten die Christen mit Folter, Mord und Zerstörung dafür gesorgt, dass das geistige Leben mehr oder weniger zum Stillstand gekommen war … (Nixey, Zorn 318 und 320).
Die Legitimation für ihre Zerstörungswut holten sich die Christen aus dem Alten Testament: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. … Du sollst sie nicht anbeten noch ihnen dienen. Denn ich, der HERR dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der das Vergehen der Väter heimsucht bis in die dritte und vierte Generation an den Kindern derer, die mich hassen (5 Mos 5, 7 und 9). Zerstört alle heiligen Stätten, wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen, und reißt um ihre Altäre und zerbrecht ihre Steinmale und verbrennt mit Feuer ihre heiligen Pfähle, zerschlagt die Bilder ihrer Götzen und vertilgt ihren Namen von jener Stätte (5 Mos 12, 2 f) .
2015 begann der IS – der sogenannte Islamische Staat – im Irak die in seinen Augen „gottlose“ altassyrische Stadt Nimrud südlich von Mossul zu zerstören. Die Bilder, die um die Welt gingen, zeigten IS-Kämpfer, die drei Jahrtausende alte Statuen von den Sockeln stürzten und mit dem Hammer bearbeiteten: Die „Götzenbilder“ mussten zerstört werden. In Palmyra wurde die große Athenestatue, deren Überreste Archäologen sorgsam restauriert hatten, erneut attackiert. Wieder wurde die Göttin enthauptet; wieder wurde ihr der Arm abgehackt (Nixey, Zorn 24).
Der reine Monotheismus lässt keinerlei Dualismus zu. Das griechische monos bedeutet »allein« oder »nur«. Monotheismus bedeutet: Es gibt nur Gott, nur eine einzige Macht, das Gute. Warum das Gute? Weil das Wirkliche oder seiende das Positive oder Gegebene ist. Das, was das seiende negiert, ist per definitionem das Negative. Das Negative hat keine Eigenexistenz, es ist lediglich die Verneinung des Positiven, ersetzt es aber nicht. Wer auf Nichtwirkliches, also Nichtseiendes setzt, mit illusionen statt mit ideen das Haus seines Bewusstseins baut, macht böse Erfahrungen (Erfahrungen mit dem Bösen), denn er steht, wenn er Halt und Schutz sucht im Nichts – im Nihilismus.
Der erste reine Monotheist, von dem wir wissen, war der Pharao Amenophis IV. Echnaton (1365-1347 vor). Für ihn und Zarathustra (~ 800 vor) gibt es als Wirklichkeit nur das allgegenwärtige Licht, neben dem es keine Finsternis geben kann. Die nächsten Monotheisten sind Parmenides von Elea (ca. 515-445 vor), Platon (427-347 vor), für den Gott das Gute ist, und Jesus von Nazareth. Der reine Monotheismus hat in keiner der Religionen überlebt, die sich auf sie als Gründer berufen.
Die reinen Monotheisten greifen zur Verdeutlichung ihrer Einsicht und Lehre zur »Licht-Finsternis«-Symbolik1. Sie sehen jedoch »Licht« und »Finsternis« nicht als Dualismus von Gott und einem Teufel, nicht als Kampf zweier widerstreitender Mächte, des Guten und des Bösen, die sich auf Augenhöhe im Kampf gegenüberstehen. Was sich da gegenüberzustehen scheint, ist Seiendes und Nichtseiendes.
Es gibt eine Lichtquelle, aber keine Quelle, die Finsternis verströmt. Man kann in einem riesigen dunklen Raum ein kleines Licht anzünden: auch die größte Finsternis kann das kleinste Licht nicht zum Verlöschen bringen: Das Licht erleuchtet in der Finsternis, und die Finsternis kann es nicht überwältigen (Joh 1, 5).
Auch kann man in einen hellen Raum keine Finsternis einleiten und so das Licht schwächen oder zum Verlöschen bringen. »Raum« ist wie »Haus« ein Symbol für Bewusstseinskapazität: sie kann erleuchtet sein, dann ist es hell; sie kann unterbelichtet sein, dann herrscht mentale Finsternis.
Auch kann GOTT, die Quelle des Guten, nicht gleichzeitig die Quelle des Bösen sein. Lässt denn die Quelle aus demselben Loch Süßwasser und Meerwasser fließen (Jak 3, 11)? Gott ist nach Paulus Alles in Allem (1 Kor 15, 28). GOTT ist Licht und in ihm gibt es keinerlei Finsternis (1 Joh 1, 5). – wenn der Unwissende belehrbar ist. Er kann auch kein Vergehen gegen seine Gesetze bestrafen, indem er Unheil schickt, um den Übeltäter zu züchtigen und krank zu machen.
Im monotheistischen Gottesbild kennt Gott das sogenannte Böse gar nicht, weil es nicht zur Wirklichkeit, sondern in die Nicht-Wirklichkeit gehört. Ebenso kann die Mathematik keine Fehler kennen oder bestrafen, weil Fehler in der Mathematik nicht enthalten sind. Sie sind außerhalb, in einer sogenannten mutmaßlichen Nicht-Mathematik.
Monotheisten aus wissenschaftlicher Überzeugung kennen keine militante Intoleranz. Sie wissen: Wer da behauptet, 2 x 2 sei 5, ist einfach unwissend. Unwissenheit kann aber nicht mit physischer Gewalt bekämpft werden, sie kann nur durch das Licht der Erkenntnis Aufklärung erfahren und verschwinden – wenn sich der Unwissende belehren lässt. Aus der Toleranz würde aber Tollheit werden, würde man sein Schicksal einem Überseeschiff anvertrauen, das von einem blinden oder in der Seefahrtkunst unkundigen Kapitän gesteuert wird. In ein Haus, dessen Bau auf einer falschen Statik beruht, sollte man klugerweise nicht einziehen.
1 Vgl. Exkurs Licht und Finsternis
Kapitel 2
GOTT und die Gottesbilder
Du sollst dir kein Bild noch irgend ein Gleichnis machen,
-weder von dem, was oben im Himmel ist,
noch von dem, was unten auf Erden ist, …
bete sie nicht an und diene ihnen nicht!
2 Mos 20, 4 (Luther 84)
Das Göttliche oder Unvergängliche, wie Epikur es ausdrückt, ist ein Neutrum, d.h. es ist keinem menschlichen Geschlecht zuzuordnen.
Der Lehre der Sophisten, dass der Mensch das Maß aller Dinge sei, tritt Platon entgegen mit dem Wort, dass Gott das Maß aller Dinge sein müsse und nicht ein Mensch. Und mit Gott meint Platon das Absolute, die Trinität des Guten, Wahren und Schönen.
Gibt es aber ein Absolutes, einen ewig unveränderten Maßstab für alles menschliche Handeln? Wer sich nach Gott umschaut, dem halten tausend verschiedene Religionen ihr jeweiliges Gottesbild vor Augen und fordern Anbetung. Und verwirrt fragt man sich mit Horaz: Belua multorum es capitum, nam quid sequar aut quem – Du bist ein Ungeheuer mit vielen Gesichtern, was soll ich annehmen, auf wen soll ich hören?
Die Psyche schafft einen Gott nach ihrem Bild und Gleichnis: das Gottesbild, das sie entwirft, spiegelt den psychischen Zustand eines Einzelnen oder einer Gruppe wider. In einem Brief an einen Anhänger seiner Lehre schrieb Epikur (341 - 270 vor): Halte Gott für ein unvergängliches und glückseliges Wesen, wie die allgemeine Gotteserkenntnis vorgeprägt wurde. Schreibe ihm nichts zu, was mit seiner Unvergänglichkeit und Glückseligkeit unvereinbar ist. … Denn Götter gibt es; ihre Erkenntnis ist ja evident. Wofür sie aber die Masse hält, so sind sie nicht. Denn die hält sich nicht an die Vorstellung, an die sie glaubt. Ein Gotteslästerer aber ist nicht, wer die Götter [Gottesbilder] der Masse beseitigt, sondern wer die Auffassungen der Masse den Göttern anhängt. Denn die Aussagen der Masse über die Götter sind keine echten Intuitionen, sondern irrige Annahmen. Von ihnen zieht man sich den größten Schaden und Nutzen von Seiten der Götter zu. Denn indem die Masse ihre eigenen Eigenschaften völlig richtig und gut findet, schließt sie auf ebenso geartete Götter, denn alles, was nicht so ist wie sie selbst, hält die Masse für abwegig (Epikur an Menoikeus 123 f).
Die Psyche produziert viele Gottesbilder nach dem Grundsatz: divide et impera – spalte und herrsche: Mittelfristig wird die parallele Entwicklung der religiösen Bewegungen, die alle die Welt zurückerobern wollen, unvermeidlich zur Konfrontation führen. So scheint der Konflikt zwischen den »Gläubigen« vorprogrammiert, die das Wiedererstarken ihrer religiösen
Identität zum Maßstab ihrer ebenso ausschließlichen wie begrenzten Wahrheiten machen (Kepel, Rache 289).
Wenn ich als Gast in einer Moschee bete, bete ich zu dem Gott, der sich in der Bibel offenbart. Er ist derselbe, zu dem Juden und Muslime beten, alle mit ihren Worten, ich mit dem christlichen Vaterunser (Ehrhardt Körting, Berliner Innensenator (SPD), in der Berliner Zeitung vom 15. Oktober 2010) Doch ist dem so?
Aus Indien kommt ein Gleichnis: Ein König versammelte einst alle Blinden der Stadt an einem Platz und ließ ihnen einen Elefanten vorführen, damit sie sich ein Bild von ihm machen könnten. Die Blinden standen um den Elefanten herum und betasteten ihn: die einen den Kopf, die anderen das Ohr, andere den Stoßzahn, den Rüssel, den Rumpf, den Fuß, das Hinterteil und die Schwanzhaare. Darauf fragte der König diese Blinden: Was für einen Eindruck habt ihr? Wie sieht der Elefant aus? Und je danach, welchen Teil sie betastet hatten, antworteten sie: Er ist wie ein geflochtener Korb! … Nein, er ist wie ein Topf! … Nein, er ist wie eine Pflugstange! … Nein, er ist wie ein Speicher! … Nein, er ist wie ein Pfeiler! … Nein, er ist wie ein Mörser! … Nein, er ist wie ein Besen!
Darüber gerieten die Blinden untereinander in heftigen Streit, und mit dem Geschrei, er sei so oder so und nicht anders, stürzten sie sich aufeinander und schlugen sich mit Fäusten.
Der König soll sich mit zynischem Lachen abgewandt und entfernt haben.
Neidisches Vorenthalten ist mit dem göttlichen Wesen unvereinbar, schreibt auch Aristoteles in seiner Metaphysik (982 b). GOTT ist offenbar, die einzige Gegenwart, doch die Menschen sehen es nicht (Log 113). Das menschliche Bewusstsein macht sich ein Bild von ihm und kann mit wachsender geistiger Kapazität immer mehr von ihm erfassen.
Wenn wir diese geistige Evolution, wie sie Leben erzwingt, erfasst haben, ist uns klar, dass kein Gottesbild als ewig oder endgültig festgeschrieben werden darf. Wie das Gottesbild der Vorfahren uns heute nicht mehr genügen kann, so wird auch unser Gottesbild die Fragen der Zukunft nicht mehr beantworten.
Die Starrheit unserer Religionen; die Annahme, dass die Zeit der Inspirationen vorüber und die Bibel abgeschlossen sei; die Furcht, Jesus herabzusetzen, wenn man ihn als Menschen auffasst: alles dies zeigt klar genug, welch falsche Wege unsere Theologie wandelt. Des wahren Predigers Aufgabe ist es, uns zu zeigen, dass Gott ist, nicht dass er war; dass er spricht, nicht dass er gesprochen hat (Ralph Waldo Emerson, Essays 46).
Kapitel 3
Die eine Bibel? – Zwei gegensätzliche Gottesbilder
Mose nahte sich dem Dunkel, darinnen der HERR war.
2 Mos 20, 21
Der Herr aller Herren … wohnt in einem Licht,
zu dem niemand kommen kann.
1 Tim 6, 16
Das Gottesbild der Jüdischen und das der Christlichen Bibel könnten verschiedener nicht sein. Zwei so gegensätzliche Bilder können aber nicht denselben Gott abbilden.
Die beiden religiösen Strömungen unter den Juden zur Zeit von Jesus waren die Pharisäer und die Sadduzäer. Matthäus, der selbst aus dem Judentum kam, erkannte die Gefahr, die von hier aus auf die neue Lehre ausging, und überliefert die Warnung Jesu: Augen auf und habt Acht auf den Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer (Mt 16, 6). Ein wenig Sauerteig durchsäuert und verändert den ganzen Teig (1 Kor 5, 6). Doch wie Matthäus gleich im Anschluss berichtet, kapierten seine Schüler die Warnung nicht und meinten, sie hätten Brot vergessen. Sie waren nicht die letzten, die diese Warnung nicht verstehen sollten. So nahm auch die werdende Kirche in ihrer Überzeugung, die ganze Entwicklung Israels laufe auf sie hinaus, die alten Schriften für sich in Anspruch und fügte aus den zwei unverträglichen Teilen ein unstimmiges Ganzes zusammen. In den Gottesdiensten der Kirchen werden bis heute Lesungen aus beiden Testamenten verwendet.
Indem die christliche Kirche das unheilvolle Erbe dieses Aspektes von Religion samt seinem Gottesbegriff aus dem Judentum übernahm, waren praktisch Gewaltanwendungen in der Kirche vorprogrammiert, wobei die Kriegstheologie des Alten Testaments als Vorbild diente. Und bis heute scheint das Gottesbild der christlichen Kirchen noch stark von dem Gewalt anwendenden Gott des Alten Testaments vorgeprägt zu sein, dem ohne Widerrede zu gehorchen sei. Aber wie soll ein solcher Gott in unseren demokratischen Traditionen und dem hier stark verankerten Toleranzbegriff ein Zuhause finden? (Lüdemann, Unheilig 117)
In seiner vielbändigen Kriminalgeschichte des Christentums sagt Karlheinz Deschner vom Gottesbild des Alten Testaments: Dieser Gott aber, von Absolutheit besessen wie keine Ausgeburt der Religionsgeschichte zuvor und von einer Grausamkeit, die auch keine danach übertrifft, steht hinter der ganzen Geschichte des Christentums. … Dieser Gott genießt nichts so wie Rache und Ruin. Er geht auf im Blutrausch. Seit der „Landnahme“ sind die geschichtlichen Bücher des Alten Testaments „auf lange die Chronik eines immer erneuten Gemetzels ohne Grund und Schonung“ (Brock) „Sehet nun, dass ich’s allein bin und kein Gott neben mir! …So wahr ich ewig lebe: wenn ich mein blitzendes Schwert schärfe und meine Hand zur Strafe greift, so will ich
mich rächen an meinen Feinden … will meine Pfeile mit Blut trunken machen, und mein Schwert soll Fleisch fressen, mit dem Blut von Erschlagenen und Gefangenen, von den Köpfen streitbarer Feinde.“5 Mos 32,39 ff (I 75).
Die Jüdische Bibel enthält Bücher, die mit Recht zu den großen Weisheitsbüchern der Menschheit zählen. Doch das Gottesbild, besonders ab dem zweiten Mosebuch, ist mit dem christlichen Gottesbild keineswegs kompatibel.
Der HERR des Alten Testaments wohnt im Dunkeln (2 Mos 20, 21), er bereut seine Schöpfung, weshalb er sie von der Erde vertilgen will, was indes misslingt (1 Mos 6, 7). Er führt Abraham in Versuchung, indem er von ihm verlangt, seinen lang ersehnten Sohn und Erben auf einem Opferaltar zu töten.
Er ruft auf zum heiligen Krieg: Ich will alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Joschafat (= Gott richtet) hinabführen. … Bereitet euch zum heiligen Krieg! … Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße. … Die Heiden sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Joschafat; denn dort will ich sitzen und richten alle Heiden ringsum. Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif! Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll, die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. … Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden (Joel 4)2.
Der HERR ist zornig über alle Heiden … er wird an ihnen den Bann vollstrecken und sie zur Schlachtung hingeben. Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden, dass der Gestank von ihren Leichnamen aufsteigen wird und die Berge von ihrem Blut fließen…. Des HERRN Schwert ist voll Blut (Jes 34, 2 ff).
Der HERR ist der rechte Kriegsmann, HERR ist sein Name (2 Mos 15, 3). Der HERR dein Gott ist in deiner Mitte, der große und schreckliche Gott (5 Mos 7, 21). Er ist auch ein großer und furchtbarer Gott (Neh 1, 5).
Er fordert die Ausrottung vieler Völker und verlangt, dass der Bann an ihnen vollstreckt wird: So spricht der HERR Zebaoth … So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und allem, was er hat; verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel (1 Sam 15).
Als der HERR Mose zum Pharao schickt mit der Aufforderung, die Israeliten auswandern zu lassen, sagt er: Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde … ich aber will das Herz des Pharao verhärten … und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen … (2 Mos 7, 2 ff). Es folgen 10 schreckliche Plagen für die Ägypter. Demnach hätte also Gott den ägyptischen König absichtlich verstockt, so dass er nicht auf Mose hörte, um ihn und dessen Volk dann für diesen Ungehorsam grausam bestrafen zu können.
Ist das mit dem christlichen Gottesbild kompatibel?
Auch seinem eigenen auserwählten Volk gegenüber ist er ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen (2 Mos 20, 5). Er kennt keine Vergebung, sondern nur blutige Rache nach dem Talionsgesetz: Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde (2 Mos 21).
Jeden Ungehorsam seines Volkes bestraft er grausam. Es hat die Wahl zwischen Gehorsam und Ungehorsam, zwischen Segen und Fluch: Wenn du nun der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum höchsten aller Völker der Erde machen, und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen: Gesegnet wirst du sein … Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes … Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen … Der Herr wird dich zum heiligen Volk für sich erheben … und alle Völker auf Erden werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt ist, und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem haben wirst … und du wirst immer aufwärts steigen und nicht herunter sinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes … und nicht abweichst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, und nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen.
Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, … so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen: Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf dem Acker … Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes … Der Herr wird unter dich senden Unfrieden, Unruhe und Unglück in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt bist und bald untergegangen bist… Der Herr wird dir die Pest anhängen … Der Herr wird dich schlagen mit Aussatz, Entzündung und hitzigem Fieber, Getreidebrand und Dürre … Der Herr wird dich vor deinen Feinden schlagen … Der Herr wird dich schlagen mit ägyptischem Geschwür, mit Pocken, mit Grind und Grätze, dass du nicht geheilt werden kannst. Der HERR wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und Verwirrung des Geistes … Den Ertrag deines Ackers und alle deine Arbeit wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst, und du wirst geplagt und geschunden werden ein Leben lang und wirst wahnsinnig werden bei dem, was deine Augen sehen müssen. … Der Fremdling, der bei dir ist, wird immer höher und über dich emporsteigen; du aber wirst immer tiefer herunter sinken … er wird der Kopf sein, und du wirst der Schwanz sein. Alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und treffen, bis du vertilgt bist, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht und seine Gebote und Rechte nicht gehalten hast, die er dir geboten hat (5 Mos 28, 145, Luther 84).
Die vom römischen Papst ausgerufenen Kreuzzüge gegen die südfranzösischen Ketzer und die Hexenverbrennungen finden keinerlei
Legitimation in den Schriften der Christlichen Bibel, wohl aber im Gottesbild des Alten Testamentes. Sich einer anderen Religion, d.h. einem anderen Gottesbild zuzuwenden hat Steinigung zur Folge. Der Freund muss den Freund, der Gatte die Gattin denunzieren: Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter Sohn, oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Frau in deinen Armen oder dein Freund, der dir so lieb ist wie dein Leben, heimlich überreden würde und sagen: Lass uns hingehen und andern Göttern dienen, die du nicht kennst noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien dir nah oder fern, von einem Ende der Erde bis ans andere, so willige nicht ein und gehorche ihm nicht. Auch soll dein Auge ihn nicht schonen, und du sollst dich seiner nicht erbarmen und seine Schuld nicht verheimlichen, sondern sollst ihn zu Tode bringen. Deine Hand soll die erste wider ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volks. Man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat dich abbringen wollen von dem Herrn, deinem Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt hat, auf dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte und man nicht mehr solch Böses tue unter euch (5 Mos 13, 7-12; Luther 84).
Die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. Wer einem Vieh beiwohnt, der soll des Todes sterben. Wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem Bann verfallen (2 Mos 20. 17 ff Luther 84). Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll des Todes sterben. … Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben (3 Mos 20, 8 f Luther 84). Wenn jemand bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist, und sollen beide des Todes sterben (3 Mos 20, 13 Luther 84). Wenn ein Mann oder eine Frau Geister beschwören oder Zeichen deuten kann, so sollen sie des Todes sterben; man soll sie steinigen, ihre Blutschuld komme über sie (3 Mos 20, 27 Luther 84).
Auch die Psalmen, unter denen sich viele herrliche Stücke wie z.B. Ps 23, 27, 91 und viele andere finden, sind nicht alle erhebend. So heißt es in Psalm 149: Der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk… Die Heiligen sollen fröhlich sein… Ihr Mund soll Gott erheben; sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben ist. Solche Ehren werden alle seine Heiligen haben. Halleluja!
In den Fluchpsalmen Ps 69, Ps 109 und Ps 137 werden schreckliche Wünsche ausgesprochen wie: An den Wassern Babylons saßen wir und weinten. … Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast! Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert! (Ps 137 Luther 84)
Die Bibel des Alten Testaments und des Neuen Testaments hat ihren Mittelpunkt in Jesus Christus als der Mitte der Zeiten. … Dabei darf nicht übersehen werden, dass das Alte Testament eine eigenständige Gottesoffenbarung enthält, die durch Christus anerkannt und aufgenommen und
bestätigt worden ist (Calwer 160). Letztere Behauptung stimmt absolut nicht. Das Gottesbild der Jüdischen Bibel ist mit dem der Christlichen Bibel in keiner Weise vereinbar. Jesus sprach selbst davon, dass seine Lehre als skandalös empfunden werden könnte (Mt 11, 6). Als gotteslästerlich wurde sie sowieso ausgelegt, was denn auch zu seiner Hinrichtung führte.
Besonders das Matthäus-Evangelium, das sich bekanntlich an die Juden richtet, stellt gleich zu Anfang viele Unterschiede deutlich heraus. Schon in der Bergpredigt (Mt 5) sagt Jesus sechs Mal: Ihr habt gehört … Ich aber sage euch. Auch widerspricht er der im Alten Testament oftmals geforderten Steinigung (Joh 8, 3 ff).
Sicher überliefert ist auch, dass Jesus oftmals am Sabbat heilte, was nach dem Gebot in der Thora mit dem Tode bestraft werden sollte (2 Mos 31, 14 f). Allgemein als echt anerkannt wird die Bemerkung Jesu dazu: Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat (Mk 2, 27). An die Kolosser schreibt Paulus: Keiner soll euch kritisieren beim Essen oder Trinken oder wegen eines Feiertags, eines Neumondes oder Sabbats. All das ist ein Schatten der zukünftigen Dinge, das Substantielle gehört zum Christus (Kol 2, 16 f).
Auch die Tieropfer finden sich nicht mehr: Denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken die Sünden wegnimmt (Hebr 10, 4).
Jesus der Christus bezeichnet alle, die vor ihm gekommen waren, als Diebe und Raubmörder. … Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er errettet werden (Joh 10, 8 f). Der Weg zu Gott führt nur über seinen Christus, keineswegs über die Werkgerechtigkeit nach jüdischer Lehre: Weh euch Pharisäern! Denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und von jedem einzelnen Kohlkopf. Aber am entscheidenden Punkt, nämlich der Liebe Gottes, daran geht ihr vorbei. Aber nein: das hier hätte man tun und jenes dort nicht unterlassen sollen. … Weh euch Schriftgelehrten! Denn ihr ladet den Menschen Lasten auf, die kaum zu tragen sind. Und ihr selbst rührt sie mit keinem Finger an. … Weh euch Theologen! Denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis fortgenommen. Selbst seid ihr nicht eingetreten, und die eintreten wollten, habt ihr daran gehindert (Lk 11, 42-52).
Der jüdische Gelehrte Ben Chorin bemerkt dazu: Die Pharisäer bildeten die Partei der Schriftgelehrten. … Ihr Streben war die Einheiligung des ganzen Lebens, das in Gesetz und Brauch dem geoffenbarten Willen Gottes unterstellt werden sollte. Nichts lag außerhalb dieser einzuheiligenden Sphäre: Essen und Trinken, Arbeit und Ruhe, Geschlechtsleben und Hygiene, Kleidung und Haartracht, und nichts war zu gering, um nicht mit letztem Ernst in den Dienst Gottes mit hineingenommen zu werden. Damit wurden die Pharisäer … zu den geistigen Vätern der späteren jüdischen Orthodoxie.
Wir können an der Realität und Problematik der heutigen jüdischen Orthodoxie die Pharisäer des Neuen Testamentes wie in einem Spiegel erkennen. Tiefer Ernst, bedingungslose Hingabe an das Gesetz Gottes, minutiöse Pflichttreue gegenüber diesem Gesetz zeichnen die Enkel der Pharisäer noch heute aus.
Andererseits sehen wir bei ihnen die Gefahren einer Entartung, von der das Neue Testament fast ausschließlich spricht. Diese Entartung besteht darin, dass der Gläubige in einen Panzer von 613 Geboten und Verboten eingeschnürt wird, so dass der Regung des lebendigen Glaubens nicht mehr der nötige Raum gegeben ist (Ben Chorin, Jesus 17 f).
Der christliche »neue Weg zu GOTT« geht von einem völlig neuen Gottesbild aus. Aus dem alttestamentlichen »HERRN« ist der liebende »Vater« geworden, im philosophischen Sinne also das schöpferische Prinzip, das zugleich Leben und Liebe ist. Als Geist ist dieser Vater und Schöpfer unendlich, allgegenwärtig. Er ist uns immer nah, untrennbar mit uns verbunden wie die Lichtquelle mit dem Licht. Unsere einzige Aufgabe ist es, sich dies bewusst zu machen. Falsche Gottesbilder führen in die Irre. Sie sollen Gott suchen, ob sie ihn fassen und ihn finden können, ihn, der ja nicht weit entfernt von jedem einzelnen von uns ist. Denn in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, und in ihm sind wir, wie es auch einige von den Dichtern bei euch ausgesprochen haben: “Denn wir stammen von ihm“ (Apg 17, 27 f).
Gott ist nicht mehr der Verborgene, der im Dunkeln wohnt. Matthäus berichtet vom Tode Jesu und schreibt: Und siehe, der Vorhang des Tempels riss entzwei von oben bis unten (Mt 27, 51). Wohl kein historischer Vorgang, wohl eher sinnbildlich gemeint: Die neue Lehre verkündet, dass jeder Mensch freien Zutritt zu Gott hat (Eph 3, 11 f). Gott wohnt im Licht: Und die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, besteht in folgendem: Gott ist Licht und in ihm ist keinerlei Finsternis (1 Joh 1, 5).
Der Jahwe des alten Gottesbildes fordert von seinem Volk geliebt und gefürchtet zu werden: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein! Und du sollst den HERRN deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft (5 Mos 6, 4). So hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, … , sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen … Denn der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott in deiner Mitte, dass nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, über dich entbrenne und dich vertilge von der Erde (5 Mos 6, 12 ff).
In starkem Gegensatz dazu will der christliche Gott nicht gefürchtet werden. Er ist sogar die primäre, vorbehaltlose und unverlierbare Liebe (1 Joh 4, 19), die nur absolute Zuwendung kennt: Furcht gibt es nicht in der LIEBE, sondern die vollkommene LIEBE treibt die Furcht aus, weil Furcht mit Strafe rechnet. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollendet in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt (1 Joh 4, 17 ff). Dieser Gott kennt auch keine Strafe. Jakobus bekräftigt: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk stammt von oben; es kommt herab vom Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt noch Verschattung im Wechsel (Jak 1, 17). Jakobus bringt hier noch eine Präzisierung, wenn von Gott als dem Vater der Lichter spricht. Vater bedeutet Schöpfer und Ursache, hier also Lichtquelle: GOTT ist die Lichtquelle, die das Licht schafft. Und deswegen lässt Johannes den Christus sagen: Ich bin für die Welt das Licht.
Wer sich mir anschließt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des LEBENS haben (Joh 8, 12). Licht ist auch das Symbol für den Logos der griechischen Kirchenlehrer.
Gott führt auch niemanden in Versuchung: Keiner soll in der Versuchung sagen: Von Gott werde ich versucht, denn Gott ist nicht versuchbar zum Bösen, und er selbst versucht niemanden. Jeder, der versucht wird, wird es, weil er sich von seiner eigenen Begierde fortreißen und ködern lässt (Jak 1, 13 f).
Die reine Liebe kennt nur Vergebung, sie ist nicht eifersüchtig und rechnet das Böse nicht zu. Sie kennt es ja gar nicht. Als Petrus Jesus fragt, ob es genügt, siebenmal zu vergeben, antwortet ihm der Meister: Ich sage dir: Nicht bis zu 7 mal, sondern bis zu 77 mal (Mt 18, 22).
Als verbindend wird auch gerne ein Wort aus Levitikus zitiert: Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR (3 Mos 19, 18). Doch wird hier meist übersehen, dass hier nur die Kinder deines Volks gemeint sind. Shlomo Sand, Professor für Geschichte in Tell Aviv, sagt dazu: Bekanntlich studierten die Juden über Jahrhunderte viel intensiver den Talmud als die hebräische Bibel. … Die Zurücksetzug des nichtjüdischen Anderen kommt kaum irgendwo so deutlich zum Ausdruck wie in dem talmudischen Satz „Ihr werdet Mensch genannt und nicht die Völker der Welt werden Mensch genannt“ (Babylonischer Talmud, Jevamot 61a). Nicht von ungefähr schreibt Abraham Isaak Kook, Architekt der Nationalisierung der jüdischen Religion im 20. Jahrhundert und erster Oberrabbiner der sich in Palästina ansiedelnden Gemeinde, in seinem berühmten Werk »Lichter«: „Der Unterschied zwischen der israelischen Seele, ihrem Wesen, ihren inneren Wünschen, ihrem Streben, ihrer Beschaffenheit und ihrer Haltung, und der Seele der Gojim, ungeachtet ihrer Entwicklungsstufe, ist größer und tiefer als der Unterschied zwischen der Seele des Menschen und der Seele des Viehs. Zwischen Letzteren nämlich besteht ein quantitativer, zwischen Ersteren aber ein qualitativer Unterschied.“ Hierbei ist zu bedenken, dass die Schriften Kooks den nationalreligiösen Siedlern in den besetzten Gebieten bis heute als geistiger Leitfaden dienen (Sand, Jude 113 f). Weil diese Auffassung von Gott und Mensch bis heute ihre negative Auswirkung zeigt, erklärt Shloma Sand am Ende seines Buches: Jetzt, da ich klar erkenne, dass man mich in Israel per Gesetz einem fiktiven Ethnos von Verfolgern und deren Unterstützern zuschlägt und überall auf der Welt einem geschlossenen Club von Auserwählten und deren Bewunderern, möchte ich nun aus diesem austreten und aufhören, mich selbst als Juden zu betrachten (Sand, Jude 148).
Jacob Neusner arbeitet in seinem Buch Ein Rabbi spricht mit Jesus – ein jüdisch-christlicher Dialog, von Josef Kardinal Ratzinger beurteilt als das bei weitem wichtigste Buch für den jüdisch-christlichen Dialog, das in den letzten zehn Jahren veröffentlicht worden ist, noch viele andere Unterschiede heraus, die seine Aussage untermauern, dass Judentum und Christentum gänzlich unabhängig voneinander zu sehen sind. Das Christentum ist nicht die
„Tochterreligion“, und es gibt keine gemeinsame fortlaufende „jüdischchristliche Tradition“.
Ihm stimmt der Theologe Nikolaus Walter zu, indem er betont, dass zwischen Altem und Neuen Testament ein Paradigmenwechsel liegt. … Dieser Paradigmenwechsel macht eine glatte, ungebrochene Übernahme oder Weiterführung alttestamentlicher Glaubensaussagen in die christliche Theologie unmöglich. Auch der Versuch, hier mit einer durchgehend allegorischen Auslegung alttestamentlicher Texte weiterzukommen (wie Paulus an einem Beispiel in 1 Kor 10, 1-11 vorführt), scheint mir nicht angemessen zu sein, da auf diese Weise das hermeneutische Problem nicht gelöst, sondern nur verschleiert wird (Dohmen/Söding, Zwei Testamente 312).
1961 formulierte der Deutsche Evangelische Kirchentag folgende Feststellung: Da die Juden Gottes Volk sind, bedürfen sie der Botschaft von Jesus Christus nicht (Judentum 181). Jesus Christus muss also in argem Irrtum befangen gewesen sein, als er gerade den Juden seine neue Botschaft verkündete. Oder hat sich die Evangelische Kirche so weit von der genuinen christlichen Lehre verabschiedet, als sie doch den jüdischen Sauerteig verwendete?
Jedenfalls missachtet sie die Mahnung des Meisters, ein altes Kleid nicht mit neuem Stoff zu flicken und keinen frischen Most in alte Schläuche zu füllen, weil sonst die Gärung die alten Schläuche zerreißt und der Wein verschüttet wird. Vielmehr müsse neuer Wein in neue Schläuche gefüllt werden, damit beide heil bleiben (Mt 9, 16 f).
Die christliche Lehre wächst zweifellos auf jüdischer Wurzel und ist ohne diese wissenschaftlich nicht zu verstehen. Die neue Lehre wendet sich ja an Juden und muss an deren Vorstellungswelt ansetzen. Doch, vergleichbar mit den heutigen europäischen Kulturreben, die nicht „wurzelecht“ sind, ist am von Paulus und Johannes gezogenen Weinstock ein vollkommen neuer griechisch-christlicher Wein gereift, wie das Johannes-Evangelium (Kap. 2, 6-10) gleichnishaft lehrt.
Ein Christ, der beide Gottesbilder miteinander vermengt und vom »Herrgott«, dem Jahwe-Elohim der Paradiesparabel, spricht statt vom »Vater«, hat den Aufruf Jesu zum Umdenken nicht verinnerlicht und vollzogen. Er wandelt in einem religiösen Irrgarten.
2 Dieses und die folgenden Zitate aus dem Alten Testament aus Luther 84
Kapitel 4
Die christliche Lehre – Das neue Bild von GOTTund Mensch
Die Lehre des Wanderpredigers Jesus von Nazareth ist der Funke, der die Idee des Christustums3 wie eine Morgensonne aufgehen ließ. Von seiner Abstammung berichten zwei mit einander unvereinbare Stammbäume. Biographisch Verwertbares finden wir in den vier Evangelien nur über seine letzten drei Lebensjahre, so seine Taufe durch Johannes, seine Lehrtätigkeit und seine Hinrichtung am Kreuz um etwa 30 nach. Für seine berichtete Auferstehung gibt es keine Zeugen, nur für das leere Grab. Seine Himmelfahrt vierzig Tage nach seinem Tode wollen Augenzeugen gesehen haben.
Die Frage, ob Jesus Jude war, wird von den allermeisten mit einem rückhaltlosen Ja beantwortet; denn wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde, ist damit offiziell Jude. Tatsächlich wurde der Neugeborene nach dem Gesetz am achten Tag beschnitten (Lk 2, 21), allerdings ohne dafür befragt worden zu sein. Paulus meint dazu: Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht (Röm 2, 28 f). Auch sollte uns die Antwort des atheistischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins nachdenklich machen: Unsere Gesellschaft einschließlich ihrer nicht religiösen Teile hat den absurden Gedanken akzeptiert, dass es normal und richtig sei, kleine Kinder mit der Religion ihrer Eltern zu indoktrinieren und ihnen religiöse Etiketten anzuhängen – »katholisches Kind«, »protestantisches Kind«, »jüdisches Kind«, »muslimisches Kind« und so weiter. Andere vergleichbare Etiketten dagegen gibt es nicht: keine konservativen Kinder, keine liberalen Kinder, keine republikanischen Kinder, keine demokratischen Kinder. … Ein Kind ist weder ein christliches noch ein muslimisches Kind, sondern es ist ein Kind christlicher oder muslimischer Eltern (Dawkins, Gotteswahn 472).
Was sicher ist: Jesus wurde von jüdischen Eltern geboren und ist in Nazareth in Galiläa in einer jüdischen Umgebung aufgewachsen. Sicher ist auch, dass sich Jesus anfangs als Prophet verstand, der nur zu den Juden gesandt war. Im ältesten Evangelium, dem des Markus (Mk 7, 24 ff), bittet ihn eine syrophönizische Griechin um die Heilung ihrer Tochter. Jesus wies die Frau zu seinen Füßen zunächst schroff ab mit dem Hinweis, dass er zu den Kindern Israels gesandt sei und nicht zu den Heiden. Die Frau entgegnete, dass doch auch die Kinder vieles unter den Tisch fallen ließen, was die Hunde dann fräßen. Da lobte Jesus ihre kluge Antwort, korrigierte seine bisherige Ansicht und heilte ihr Kind.
Das Markus-Evangelium beginnt mit den Worten: Anfang der Botschaft von Jesus dem Christus, dem Sohn Gottes. Hier steht bereits eindeutig zu lesen, dass die vier Evangelisten an persönlichen Daten über Jesus wenig interessiert sind. Sie wollen lediglich sein dreijähriges Wirken und seine Christus-Lehre darlegen. Der Geburtsmythos bei Lukas schildert in schönen Bildsymbolen die strahlende Ankunft der Christus-Idee in der finsteren Welt, einer Welt ohne Wissen um die Wahrheit.
Von einer jungfräulichen Geburt des kleinen Jesus weiß Paulus noch nichts. Allgemein galt Jesus als der Sohn des Josef. Die Stammbäume bei Matthäus und Lukas sind frei erfunden und später manipuliert worden, und dies noch sehr ungeschickt. Dies erkennt man daran, dass beide Stammbäume Josef als einen Nachkommen aus dem Hause Davids darlegen wollen, da ja der Messias aus dem Hause Davids kommen sollte, um dann am Ende zu sagen, dass Josef aber doch nicht der leibliche Vater von Jesus war!
Jesus war nicht verheiratet, denn Ehe und Familie binden. Große Seher wie Zarathustra, Buddha, Platon und viele andere sehen ein Ziel vor Augen, auf das sie unbehindert zueilen wollen. Der Weg, auf dem sie voranstürmen, trennt sie unausweichlich von rein leiblicher Verwandtschaft (Mt 10, 36 f).
In Platons Symposion spricht die Priesterin Diotima von Menschen, die eher Lust haben, in Seelen zu zeugen als in Leibern, und zwar das, was der Seele zukommt, zu zeugen und zu gebären. Und das sind: Vernunft und andere geistige Fähigkeiten. Auch die Dichter sind alle solche Schöpfer und die kreativen von den Künstlern. Die weitaus größte und schönste Weisheit ist die, die den Staat und das Hauswesen ordnet. Ihr Name ist Besonnenheit und Gerechtigkeit. Wer nun diese von Jugend auf in seiner Seele trägt, ist ein göttlicher Mensch. Er wird, wenn er ins rechte Alter kommt, befruchten und zeugen wollen (Symp 209 a/b).
Die Schriften
Keine von den Schriften der Christlichen Bibel behauptet, das »Wort GOTTES« oder durch göttliche Verbalinspiration, d.h. göttliches Diktat, übermittelt worden zu sein.
Die Jesus-Worte, wie wir sie in den vier kanonischen Evangelien und im Thomas-Evangelium lesen, geben weniger den originalen Wortlaut wieder als vielmehr den später erinnerten Wortsinn. Sie sind durch hellenistische Ohren gegangen. Sie verdolmetschen die neue Lehre für ein mit griechischer Philosophie weniger oder tiefer vertrautes Bewusstsein bei Juden und Heiden.
Gerd Lüdemann4 hat in seiner subtilen Arbeit gezeigt, dass nur wenige überlieferte Jesus-Worte so aus seinem Mund stammen können.
Die Bibelwissenschaft unterscheidet längst zwischen „echten“ und „unechten“ Jesus-Worten. Mit vollem Recht kann man sagen, dass sich im Johannes-Evangelium so gut wie gar kein „echtes“ Jesus-Wort findet. Ist also die Christus-Lehre bei den Evangelien durchweg gefälscht? Wer diesen Vorwurf erhebt, hat einen Denkfehler begangen und zwar folgenden: Es wird in den Evangelien nicht unterschieden zwischen Worten, die der historische Jesus von Nazaret tatsächlich gesagt hat und dem, was das durch Jesus ans Licht gekommene neue Christus-Paradigma lehrt.
Ein schwerer Fehler – auch die meisten Theologen begehen ihn – ist der, zu glauben, dass alle Jesus-Worte persönliche Aussagen aus dem Munde des galiläischen Propheten sein wollen. Es ist vielmehr fast immer der Christus5, der spricht. So lehrt bei Johannes, dem philosophischen Evangelium, durchweg der Christus. Und dieser Christus benutzt den historischen Jesus als Sprachrohr.
Auch aus dem Munde des Königs Ödipus spricht in der Tragödie nicht ein mythischer König, sondern der altersweise Sophokles, aus dem Munde des Sokrates spricht in den Dialogen Platon, aus dem Munde Hamlets spricht Shakespeare, aus dem Munde Fausts spricht die Lebenserfahrung Goethes. Wer würde denn da: Fälschung, Fälschung! rufen?
Ich bin schon, bevor es Abraham gegeben hat (Joh 8, 58). Ich bin das Licht der Welt. Wer sich mir anschließt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des LEBENS haben (Joh 8, 12). Das kann doch nicht Jesus über Jesus gesagt haben, hier spricht die Christus-Idee, so alt wie Gott. Wem sie im Bewusstsein aufleuchtet, dem zeigt sie den Ausweg aus der irdischen Misere.
Die Paulus-Briefe sind die ersten schriftlichen Zeugnisse für die christliche Lehre. Sie wurden zwischen 38 und 50 in griechischer Sprache geschrieben.
Paulus wurde unter dem jüdischen Namen Schaul in Tarsus, Kilikien (heute Türkei), geboren. Er hatte durch seine Eltern das römische Bürgerrecht. Aus frommem jüdischen Hause und eifriger Rabbinenschüler verfolgte er mit ganzem Widerwillen die neue Lehre als irrlehre. So wohnte er auch der Steinigung des jungen Christen Stephanus durch die Juden bei. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode, heißt es in der Apostelgeschichte des Lukas. Paulus selbst berichtet im Lehrbrief an die Galater: Ihr habt ja von meinem früheren Leben im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu zerstören suchte und im Judentum viele meines Alters im Volk weit übertraf und über die Maßen für die Satzungen der Väter eiferte (Gal 1, 13 f).
Nach seiner Bekehrung zum Christustum wurde er der eifrigste Verfechter und Propagandist dieser neuen geistigen Bewegung. Er
unternahm ausgedehnte Reisen im gesamten Mittelmeerraum, bei denen er jüdische Gemeinden aufsuchte, um bei ihnen die Ankunft des erwarteten Messias zu verkünden. Doch trug er seine Botschaft auch zu Nichtjuden. Er setzte gegen die Gesetzesgerechtigkeit, die die peinliche Einhaltung aller Gebote der Thora fordert, den befreienden Glauben an den Christus. Dank seiner umfassenden hellenistischen Bildung wurde er zum bedeutendsten Theologen der christlichen Frühzeit.
Bei seinen Zitaten aus der Schrift benutzt Paulus die Septuaginta (LXX), also die im dritten vorchristlichen Jahrhundert in Ägypten ins Griechische übersetzte Hebräische Bibel.
Von der jüdischen Tradition herkommend, ist er als Exponent eines einflussreichen gebildeten Hellenismus zu verstehen, der das Christentum in Sprache und Stil, in Theologie und Bildung zur Vollendung geführt hat. Paulus ist in seiner Person ein typisch hellenistischer Denker gewesen, der in seiner Wirksamkeit wie kein anderer das Christentum als Heidenmissionar im Römischen Reich gelehrt und verbreitet hat (Richert, Christus 45).
Nicht alle unter dem Namen des Paulus überlieferten Briefe stammen aus seiner Feder. Mindestens drei sind von Paulusschülern verfasst. Gemeinsam ist allen diesen Schriften, dass sie die Autorität des Paulus in Anspruch nehmen. Ihre Verfasser wollen damit nicht täuschen,… sondern zum Ausdruck bringen, wie ihr Wort verstanden und aufgenommen werden soll – nämlich als verbindliches, der Sache nach von der Autorität des Apostels getragenes Wort. Paulus war ihnen der Garant der Wahrheit, sein Name das Siegel, das sie legitimieren sollte. … Klingt der Kolosserbrief noch gut paulinisch, lassen die Briefe an Timotheus und Titus das theologische Profil des Apostels nur noch schwach erkennen (Iber, NT 329 f).
Die vier kanonischen Evangelien. Nach dem neuesten wissenschaftlichen Stand beruhen alle Evangelien auf einem Ur-Evangelium, das nach mancherlei Bearbeitungen und Erweiterungen zum heutigen Lukas-Evangelium wurde. Sie liegen allesamt nicht in der Urfassung vor, vielmehr wurden sie in den folgenden Jahrhunderten mehrfach überarbeitet, das Johannes- und das Markus-Evangelium um einen Schluss erweitert. Die Evangelien haben auch sonst erläuternde Erweiterungen erfahren, zum Teil verhängnisvolle. Die Endfassung hat wohl um das Jahr 150 vorgelegen.
Das Markus-Evangelium galt lange als das älteste der Evangelien. Es endete ursprünglich nach Kap. 16, 8 und wurde später erweitert mit den Erscheinungen des Auferstandenen und der Himmelfahrt. Die Endredaktion erfolgte um 70 nach, vermutlich in Rom.
Markus war mit Paulus bei dessen erster Missionsreise unterwegs, er gehört aber zum Kreis um Petrus, dessen Lehre das Evangelium in der Hauptsache wiedergibt.
Das Matthäus-Evangelium erfuhr seine Endredaktion um 80 nach. Es wurde wohl nicht vom Jünger geschrieben, sondern ist hervorgegangen aus der Katechetenschule des Apostels Matthäus. Der Verfasser hat das Markus-Evangelium benutzt und eine Quellenschrift (Q), die überlieferte Jesus-Worte enthielt.
Die Adressaten sind Juden in der syrischen Diaspora. Mit vielen Zitaten aus der Jüdischen Bibel soll der Nachweis geführt werden, dass Jesus der verheißene Messias und Davidsohn ist.
Wie kein anderes Evangelium verwendet Matthäus die altorientalische Zahlensymbolik, so besonders die »7« und die »4«. Ein deutlicher Hinweis auf die Sieben Schöpfungstage, deren Gottesbild die Lehre Jesu übernimmt.
Als der Fels, auf den die christliche Gemeinde gebaut ist, wird Petrus herausgehoben.
Das Lukas-Evangelium. Nach Klinghardt6 entstand nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 90 ein Ur-Evangelium, schlicht »Evangelium« geheißen. Es ist die erste Fassung des späteren Lukas-Evangeliums. Dieses Ur-Evangelium lag Markion vor. Seine Urfassung wurde zusammen mit den drei übrigen Evangelien in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts in Rom überarbeitet. Bei dieser Überarbeitung kam es zu vielen Einfügungen, die einen Bezug zum Alten Testament herstellen sollten. Diese überarbeitete und erweiterte Form liegt uns heute als Lukas-Evangelium vor. Heute gilt … das Evangelium des Markion als grundlegende Basis der drei Synoptiker (Fried, Tod 51).
Das Johannes-Evangelium wird allgemein dem Apostel Johannes aus dem von Jesus berufenen Zwölferkreis zugeordnet. Es ist von Anfang an in griechischer Sprache abgefasst und ist die erste philosophisch gehaltene Schrift des Neuen Testaments, die das theologische Gespräch mit den hellenistisch Gebildeten seiner Zeit gesucht hat. … Hatte doch die Hellenisierung, so kann man allgemein sagen, sowohl im Juden- als auch im Christentum alle Bereiche des politischen, kulturellen und alltäglichen Lebens weit und tief durchdrungen. Infolge dessen ist die damalige geistige Welt in Literatur, Religion, Philosophie, Kunst und Gesellschaft ohne die vorherrschende griechische Sprache, Koine genannt, nicht zu denken (Richert, Christus 34).
Die Datierung der kanonisierten Version, in der auch das Markus- und das Lukas-Evangelium verbreitet wurden, schwankt zwischen dem frühen zweiten Jahrhundert und der definitiven Redaktion des neutestamentlichen Kanons (zwischen 144 und 155). Umstritten ist, wie viele Autoren diesem »Johannes« die Feder führten. Prolog und Schlusskapitel verweisen auf je unterschiedliche Verfasser; der Passions- oder der Kreuzigungsbericht will dem Augenzeugnis
des Jüngers, „den Jesus liebte“, folgen; die Abschiedsreden und weitere Anekdoten verdanken sich vielleicht noch anderen Mitwirkenden (Fried, Tod 19 f).
Es stammt also nicht von einer Hand. Einzelne Schichten der Bearbeitung sind leicht zu erkennen. Da ist einmal die von Paulus inspirierte Schicht, die noch vom Opfertod Jesu für die Sünden der Welt spricht, und die andere Schicht, die wohl die spätere sein dürfte. Diese neue theologische Sicht verkündet die Erlösung durch die Erhöhung der Christus-Idee. Diese theologische Sichtweise kommt dem platonischen Denken sehr nahe. Als Griechisch sprechende Juden sich für die Lehre Jesu interessieren, lässt das Johannes-Evangelium Jesus in Jubel ausbrechen (Joh 12, 23). Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Juden in der griechischen Philosophie bewandert waren. Ein jüdischer Zeitgenosse von Jesus, Philon von Alexandrien, war ja mit Platon ebenso vertraut wie mit den jüdischen Schriften.
An einer Stelle legt das Evangelium Jesus die Worte in den Mund, alles Heil käme von den Juden (Joh 4, 22), obwohl das Evangelium im wohl spätesten Teil des Werkes, dem Prolog, die Gegensätzlichkeit des christlichen Paradigmas zum jüdischen betont. Drei Kapitel später wird auch der jüdische Lehrer Nikodemus von Jesus als unwissend bezeichnet (Joh 3, 10).
Doch um die einzelnen Schichten klar von einander zu trennen, bedürfte es einer tiefer gehenden Untersuchung, wofür hier nicht der Ort ist.
Deutlich wird jedoch: Zwischen den Paulus-Briefen und dem Johannes-Evangelium liegen mehr als 50 Jahre. Auch wenn Paulus die Christus-Lehre als das Ende des Alten Testamentes bezeichnet hatte (Röm 10, 4), blieb er in vielem den alten Vorstellungen verhaftet, so dass seine Aussagen oft widersprüchlich bleiben. So besonders deutlich in der Aussage, Gott erbarme sich der einen und verstocke die anderen, wie er will (Röm 9, 18), ein eindeutiger Hinweis auf die Worte des alttestamentlichen Herrn, dass er die Ohren des Pharao absichtlich taub machen werde gegen die Worte des Mose, nur um die Ägypter dann mit schrecklichen Strafen heimsuchen zu können (2 Mos 7, 3). Ein schlimmer Fehler des Paulus, auf den sich die Prädestinationslehre des Kirchenlehrers Augustinus und später Calvin berufen werden.
Die Schule des Johannes wird sich mehr und mehr davon lösen, bis im ersten Johannes-Brief die reine Lehre am klarsten zum Ausdruck kommt. Das Johannes-Evangelium richtet sich in der Hauptsache gegen die Lehre der christlichen Gnosis und polemisiert gegen den Apostel Thomas (Thomas-Evangelium, Thomasakten), den es als den „Ungläubigen“ bezeichnet, weil er die leibliche Auferstehung anzweifelt.
Johannes selbst wird – nur in diesem Evangelium – mehrmals als der „Lieblingsjünger“ von Jesus bezeichnet, als der also, der dem Meister besonders am Herzen lag, weil er seine Lehre am besten verstanden hatte.
Auch Petrus und seine Schule werden in Joh 21, 15 ff abgewertet, als hätten sie die neue Lehre nicht in allem richtig verstanden.
Obwohl das Johannes-Evangelium mit Sicherheit die wenigsten authentischen Jesusworte enthält, hat es die neue Lehre am besten erfasst und sie für die hellenistische Umwelt begreiflich dargestellt. Die Jesusworte bei Johannes wollen nicht sagen: „Jesus selbst hat es gesagt“, sondern: „Der Christus lehrt“. Nicht Jesus spricht bei Johannes, sondern so gut wie immer der Christus.
Das Johannes-Evangelium wendet sich an die hellenistische Ökumene und ist mit der griechischen Philosophie eng vertraut, wie insbesondere der LOGOS-Prolog seines Evangeliums zeigt. Ein deutlicher Hinweis auch, dass er die Christus-Lehre als philosophischen Weg versteht.
Johannes betont, dass nur die Erkenntnis der Wahrheit frei macht (Joh 8, 32). »Wahrheit«, »wahr« und »wahrhaftig« kommen bei Johannes insgesamt 83 mal vor, »erkennen« 87 mal. Leicht ist hier in der Theologie des Johannes die geistige Nähe zur Philosophie Platons und den Gnostikern zu erkennen. Das Johannes-Evangelium wollte die früheren Evangelien ersetzen.