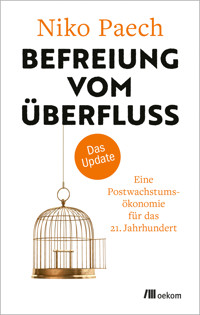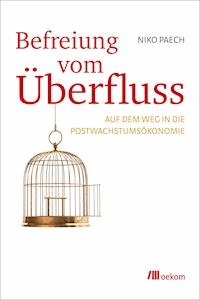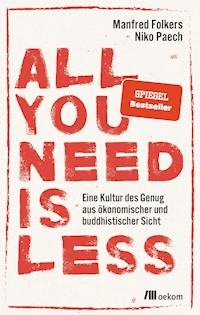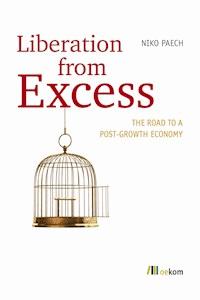Vorwortder aktualisierten Auflage
Auch wenn Wachstumskritik keineswegs in aller Munde ist, breitet sich der Diskurs um dieses heiße Eisen kontinuierlich aus. Welchen Anteil daran das 2012 erschienene Büchlein »Befreiung vom Überfluss«, aber auch andere, demselben oder ähnlichen Themen gewidmete Literatur hat, ist schwer auszumachen. Woran ließe sich die Relevanz wachstumskritischer Tendenzen bemessen: an deren Präsenz in Politik, Wissenschaft und Medien als wohlfeiler, wenngleich wirkungsloser Gesprächsstoff? An materiellen Veränderungen des Wirtschafts- und Lebensstils, die bei hinreichender Vervielfältigung zu einer Überwindung des Wachstumsstrebens beitragen könnten? Oder an multiplen Krisen, die sich derart zuspitzen, dass eine Postwachstumsstrategie absehbar die einzig logische Antwort darauf wäre?
Ein flüchtiger Blick auf die erste der drei genannten Ebenen lässt Indizien für einen Bedeutungszuwachs erkennen, etwa festgemacht an Buchpublikationen, Dokumentationen, Reportagen, Interviews, Medienevents und vielfältigsten Veranstaltungsformaten. Ganz zu schweigen von Preisverleihungen und Ehrungen, die an explizit wachstumskritische Akteure*) aus Wissenschaft und Praxis vergeben wurden. Viele öffentliche und private Einrichtungen, insbesondere im Bildungsbereich, aber auch gesellschaftspolitisch engagierte Interessengruppen widmen sich längst diesem Thema. An manchen Hochschulen hat die Wachstumsfrage Eingang in Lehre und Forschung gefunden, beispielsweise als Postwachstumsökonomik-Modul im Masterstudium der Pluralen Ökonomik an der Universität Siegen oder als kompletter Degrowth-Studiengang an der Universität Barcelona. Erwähnenswert ist auch ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft üppig gefördertes Forschungskolleg an der Universität Jena, betitelt mit »Postwachstumsgesellschaften«. Immer mehr Lehrstühle der Wirtschaftswissenschaften, aber auch anderer sozialwissenschaftlicher Disziplinen scheinen nicht mehr umhinzukommen, wachstumskritische Analysen und Implikationen in ihre Formate einfließen zu lassen, und sei es nur, um sich davon zu distanzieren.
An der Universität Oldenburg, also dort, wo das Konzept der Postwachstumsökonomie seinerzeit entstanden ist, hatte sich die gleichnamige Ringvorlesung zu einer Diskussionsplattform entwickelt, die für mehr als ein Jahrzehnt enorme Resonanz erfuhr und europaweit Kreise zog. Aber ausgerechnet an dieser Hochschule vollzog sich auch, was jemandem im Extremfall widerfahren kann, der sich als profunder Wachstumskritiker um eine ordentliche Professur bewirbt, nämlich dass er zum Politikum wird, dem die Universitätsleitung gegebenenfalls mit drastischen Mitteln entgegentritt. Immerhin: Dem Bekanntheitsgrad der Postwachstumsdebatte hatte dieser Skandal nur genutzt – die Ökonomie der Aufmerksamkeit lässt grüßen. Ähnliches gilt für mediale Hetzkampagnen und Diskreditierungen mittels verzerrter Darstellungen, die von der Titelseite der BILD-Zeitung bis zu Wikipedia (einem übrigens alles andere als politisch neutralen oder demokratischen Medium) reichen. Dies zu verarbeiten, erfordert ein dickes Fell, vor allem eine reichhaltige Ausstattung mit jener Ressource, die sich Humor nennt. Denn abgesehen davon, dass Kritik, wenn sie willkürlich und ideologisch motiviert ist, oft mehr über den Kritiker als den Kritisierten verrät: Aus einer sozial- und geisteswissenschaftlichen Beobachtungsperspektive eignen sich die Reaktionen auf wachstumskritische Impulse hervorragend, um Erkenntnisse über den mentalen Zustand einer Gesellschaft zu gewinnen, die – wohlgemerkt wachstumsbedingt! – am Abgrund steht.
Wer sich der zweiten Ebene zuwendet, also nach tatsächlichen Konsequenzen der Postwachstumsdebatte Ausschau hält, steht vor einem diffusen Bild. Unverkennbar vollzieht sich eine Ausbreitung unterschiedlichster Projekte und Praktiken, die, jeweils für sich betrachtet, ein veritables Element der Postwachstumsökonomie darstellen. Dazu zählen Ansätze der Nutzungsdauerverlängerung und -intensivierung, die sich sowohl nicht kommerziell als auch marktbasiert während der letzten zwei Jahrzehnte zunehmend etablierten. Auch wenn die dringend erforderliche Reparaturrevolution noch nicht eingetreten ist, ihre Anfänge nehmen derzeit gewaltig an Fahrt auf. Ähnliches gilt für gemeinschaftliche Wohnformen, die suffizienz- und subsistenzbasierte Versorgungsformen inkludieren, ganz gleich ob als Ökodörfer im ländlichen Raum oder in urbaner Ausprägung. Vielfältige Projekte der Selbstversorgung mausern sich zu einem dezentralen Entwicklungsstrang postwachstumskompatibler Aktivitäten. Sie reichen von Gemeinschaftsgärten über die Transition-Town-Bewegung bis hin zu kommunalen Ressourcenzentren wie jenem in Oldenburg, das zugleich als Lernort für zukunftsbeständige und resiliente Lebenspraxis fungiert. Nicht minder präsent sind in den Medien porträtierte Personen, die sich einer suffizienten, oft als »frugal« bezeichneten Daseinsform verschrieben haben … Kurz und gut: Eine Liste konkreter Beispiele für genügsame und subsistente Daseinsformen, die weltweit zu beobachten ist, wäre schier endlos.
Das gilt ebenfalls für Entwicklungen der Regionalökonomie, sowohl bezüglich einzelner Unternehmen als auch von Netzwerken. Allein die Ausbreitung der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) erstaunt, beträgt doch die Anzahl der in Deutschland beheimateten Betriebe dieser Art inzwischen etwa 500. Die Übertragung eines derartigen gemeinschaftsgetragenen Unternehmertums auf andere Versorgungsbereiche erfolgt bereits in ersten Ansätzen. Auch durch das Genossenschaftsprinzip, das Verantwortungseigentum oder Gemeingüter werden interessante Unternehmensformen und Institutionen hervorgebracht, die mit Versorgungssystemen einer nicht wachsenden Ökonomie vereinbar wären. Mittlerweile sieht sich die Nachhaltigkeitsforschung sogar mit dem Phänomen suffizienter Unternehmensstrategien konfrontiert. Dabei tritt eine erstaunliche Bandbreite an Handlungsebenen zutage, auf denen sich Betriebe in Selbstbegrenzung üben oder dazu beitragen, eine Reduktion der industriellen Wertschöpfung meistern zu können.
Der vielgliedrige Kosmos an ökonomischen relevanten Gegenkulturen ist von unschätzbarem Wert. Ihn nach Kräften zu stabilisieren und auszubauen, dürfte sich als unabdingbar erweisen, allein um damit Blaupausen und übertragbares Erfahrungswissen für kommende, sicherlich weniger prosperierende Entwicklungen bereitzuhalten. Aber ein gezielt oder freiwillig eingeleiteter Strukturwandel zum Weniger lässt sich daraus nicht ableiten, denn diese Dynamik verharrt noch in Nischen, weiterhin darauf lauernd, sich bei geeigneter Gemengelage umfassend auszubreiten. Wie weit entfernt ein solcher Wendepunkt noch ist, zeigen Exzesse an Zerstörung, die parallel dazu wüten. Nun verbietet es sich, daraus voreilige Schlüsse, insbesondere Schuldzuweisungen, abzuleiten. Denn auch für Handlungsmuster, die isoliert betrachtet noch so ruinös erscheinen mögen, gelten Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, die sich aus ihrem historischen, ökonomischen und sozialen Kontext ergeben können. Solange Normen der Aufklärung und des Humanismus gelten, sollte ein essenzieller Unterschied beachtet werden, nämlich zwischen Situationen, in denen jemand aus Unwissenheit, Not, Alternativlosigkeit oder gar unter Zwang handelt, und eben solchen, in denen rücksichtsloser Hedonismus oder Luxusbegierde wider besseres Wissen handlungsleitend sind.
Aber gerade deshalb: Was sagt es über das kulturelle und moralische Niveau einer Zivilisation aus, die in einem historisch einmaligen Wohlstand schwelgt, vom Untergang bedroht ist, aber ausgerechnet dort stetig neue Rekorde an ökosuizidalem Gebaren zelebriert, wo es um den unnötigsten Pomp geht, der noch vor Kurzem undenkbar war? Dies betrifft den Konsum und den damit verbundenen Güterverkehr infolge des ausufernden Internethandels, aber erst recht die globale Mobilität und den Tourismus, insbesondere Kreuzfahrten und Flugreisen. Vor allem diese Entwicklung ist ein starker Indikator für eine grassierende Wohlstandsverwahrlosung, zumal hier das Verhältnis zwischen bewusst verursachter Schadenswirkung und begründbarer Notwendigkeit ins Absurde driftet. Und dies ist beileibe kein Elite-, sondern ein Mittelschichtphänomen, das im Übrigen längst nicht mehr nur den Globalen Norden betrifft. Aber natürlich, wie sollen all diese armen Opfer des Kapitalismus und sonstiger Systemzwänge denn – Achtung: Übergang in den Alibimodus! – anders handeln, solange die Politik sie nicht dazu veranlasst?
Während dieses Vorwort entsteht, wird im Radio berichtet, dass die umstrittene Genehmigung für Erdgasbohrungen nahe Borkum nun tatsächlich erteilt wurde und – in derselben Nachrichtensendung! – dass die Bundesregierung Subventionen und astronomische Bürgschaften für die Meyer-Werft übernehmen will, damit dort neue Kreuzfahrtschiffe für den Disney-Konzern fertiggestellt werden können. Was durch staatliche Interventionen und Förderprogramme zerstört wird, bildet eine Galaxie, die von industrieller Landwirtschaft, Flüssigerdgasterminals, absurden Flughäfen (etwa Calden bei Kassel), Autobahnen (etwa der A22 oder der A49), der Expansion neuer Baugebiete und -projekte, einer (nicht nur ökologisch) ruinösen Digitalisierung bis zu massivsten Landschaftszerstörungen infolge einer entgleisten Energiewende reicht. Die Liste ließe sich fortsetzen. Demokratischen Regierungen vorzuwerfen, sie würden sich nicht für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen, ist schamlos untertrieben. Vielmehr ebnet die Politik systematisch den Weg für Verwüstungen selbst dort, wo eine unregulierte Marktdynamik, die Neoliberale begeistern müsste, dergleichen nie entstehen ließe. Auf dieses Politikversagen wird in einem gesonderten Abschnitt eingegangen, der dieser Auflage neu hinzugefügt wurde.
Immerhin sind inzwischen neue Protestbewegungen entstanden, die sich anschicken, dieses Ungemach durch Druck von der Straße zu korrigieren. Sie nennen sich Fridays/Parents/Omas/Scientists for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände oder Aufstand der Letzten Generation. Bei allem Respekt, den diese Initiativen verdienen, können sie nur dann problemlösend wirken, wenn sie nicht in alten Mustern verharren. Um aus dem Scheitern vorangegangener Aufbrüche zu lernen, reicht es nicht, einen politischen Aktivismus zu entfachen, der nicht explizit wachstumskritisch ist, sondern nur eine Beschleunigung dessen fordert, was die technologischen Klimaschutzprogramme etablierter Parteien ohnehin vorsehen. Wirksam sind derartige Bewegungen immer genau dort, wo deren Träger glaubwürdig vorleben – »walk the talk«, wie es angelsächsisch heißt –, was auf jede und jeden Einzelnen zukäme, wenn eine Transformation jenseits technologischer Irrwege realisiert würde. Denn ein Programm zur Wiedererlangung der ökologischen Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation käme niemals ohne merklich veränderte Lebensführungen zustande.
Die Frage, welche Szenarien eines Wandels nun überhaupt noch denkbar sind, verweist auf die dritte der oben genannten Betrachtungsebenen. Wer weiterhin annimmt, es bestünde noch die Wahl zwischen einem Übergang »by design or by disaster«, leidet unter gediegenem Realitätsverlust. Seit Erscheinen der ersten Auflage des vorliegenden Buches haben sich alle ökologischen Schadensdimensionen nicht nur ausnahmslos intensiviert, sondern es sind weitere hinzugetreten. Außerdem haben andere Krisen, etwa Fukushima, Corona und der Ukrainekrieg vor Augen geführt, wie verletzlich ein auf Wachstum, somit notwendigerweise auf globalen Produktions- und Lieferketten beruhendes Wohlstandsmodell ist. Gleichwohl hält sich hartnäckiger Berufs- und Zweckoptimismus, der jedoch insoweit fatal ist, als er nicht nur technologische Durchbrüche, sondern einen Staat beschwört, der alle ökonomischen Verluste finanziell ausgleicht. Diese Selbsttäuschung kann ganze Gesellschaften lähmen, weil sie deren Mitglieder darin bestärkt, alle Verantwortung abzuwälzen – obendrein auf Instanzen, die wirkungslos (Technologie) oder handlungsunfähig (Politik) sind.
Waren die Zukunftsentwürfe und jahrzehntelangen Anstrengungen, um das Chaos noch rechtzeitig abzuwenden, somit vergeblich? Im Gegensatz zu anderen Nachhaltigkeitskonzeptionen würde die Postwachstumsökonomie nichts an Relevanz verlieren, wenn sich Kollapsszenarien näherten und intensivierten. Verändern würde sich allenfalls die Begründung ihrer Notwendigkeit. Denn sie verkörpert nicht nur das, was bei rechtzeitiger Umsetzung den Best Case hätte ermöglichen können, sondern auch das, was als einzig tragfähige Reaktion noch plausibel ist, wenn der Worst Case eintritt. Ab einer gewissen Verschärfung ökologischer Miseren – wenn nicht sogar früher – verliert auch die aktuelle Lebens- und Wirtschaftsweise ihre substanzielle Basis. Was dann noch an Optionen verbleibt, um die hereinbrechende Knappheit zu meistern, entspricht exakt dem Maßnahmenspektrum der Postwachstumsökonomie. Schließlich gründet sie auf Versorgungsmustern, die auch jenseits des derzeit noch hegemonialen Industrie- und Technikkomplexes umsetzbar sind, und zwar unabhängig davon, ob dieser vorsorglich zurückgebaut wird oder allmählich zusammensackt. Wenn eine Grundidee der Postwachstumsökonomie darin besteht, Genügsamkeit zu organisieren, und zwar demokratisch, freiheitlich und unter Wahrung menschlicher Würde, dann eben auch aus dem pragmatischen Grund, auf diese Weise autonom und krisengeschützt existieren zu können.
Dieser Doppelcharakter des Postwachstumskonzepts folgt logisch daraus, dass die hierzu notwendige Transformation rein äußerlich kaum von dem zu unterscheiden wäre, was tradierte Ökonomen unter »Krise« verstehen würden. Im Worst Case trifft sie schicksalsgleich auf eine vulnerable Gesellschaft; im Best Case könnte sie ihren Schrecken verlieren, wenn die vorherrschende Wirtschafts- und Lebensweise darauf vorbereitet wurde. Die panische Angst vor jeglicher Wohlstandsreduktion wird interessanterweise auch von Linksintellektuellen geschürt, die einen allmächtigen Staat herbeifantasieren, der den Verlust ausgleichen müsse, indem er die Konsumversorgung durch Rationierung sicherstellt. Dieser hehre Wunsch könnte von Pippi Langstrumpf stammen, vor allem ist er kontraproduktiv, entspräche gar einer Problemverschleppung. Denn er konserviert gerade jene Konsumorientierung, die zu überwinden wäre, um auch unter Kollapsbedingungen überlebensfähig zu sein. Die bisherige Abhängigkeit vom Markt würde lediglich durch eine solche vom Staat ersetzt, der komplett damit überfordert wäre, die Wirtschaft zentral zu planen.
Wer krisenbedingte Verteilungskonflikte vermeiden will, sollte Menschen dazu befähigen, unabhängiger zu leben und sich teilweise selbst zu versorgen, sodass sie weniger auf staatliche Hilfe oder finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Um Verlustängste zu bändigen, die mit dem Wohlstand systematisch steigen, hilft keine Hoffnung auf ein politisches Wunder, sondern nur die konkrete und kleinteilige Arbeit an der menschlichen Kompetenz, sich eigenständig und in Gruppen mit Knappheit zu arrangieren, also resilient zu werden. Dafür bedarf es geeigneter Übungsprozesse und -umgebungen, vor allem aber glaubwürdiger Vorbilder.
Was zwingt Wissenschaftler und Nachhaltigkeitsakteure überhaupt dazu, ausschließlich Politikberatung zu betreiben oder noch so gut begründete Forderungen an hochrangige Entscheidungsinstanzen zu adressieren? Statt weiterhin das große Rad drehen zu wollen, erscheint es aussichtsreicher, sich auf eine transformationsaffine Minderheit zu fokussieren, damit diese das Veränderungswissen für einen Plan B hervorbringen und diesen durch vorgelebte Praxis dem Rest der Gesellschaft vermitteln kann. So bliebe wenigstens die bescheidene Chance gewahrt, aus dezentralen Experimentierfeldern heraus das vorhandene Durchdringungspotenzial zukunftsbeständiger Daseinsformen auszuschöpfen, bevor absehbare Zusammenbrüche entsprechende Handlungsmuster ohnehin erzwingen. Real existente Gegenkulturen bilden ein lebendiges Archiv, auf das notfalls auch jene zurückgreifen können, die jetzt noch von einer Zukunft als Optimierung des aktuellen Wohlstands träumen. Möglicherweise könnte der Aufprall so gedämpft werden. Es stellt sich längst nicht mehr die Frage, ob Krisen zum Motor des Wandels werden, sondern nur noch, wie diese gemeistert werden können. Die viel zitierte Formel »by design or by disaster« bedarf also einer Korrektur, nämlich »by decentralized design and disaster«. Zu mehr Hoffnung besteht derzeit kein Anlass.
Niko Paech
10. Februar 2025
*) Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch das generische Maskulinum verwendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.
Einleitung
Wohlstandsdämmerung – Aussicht auf mehr Lebensqualität
Dieses Buch dient einem bescheidenen Zweck. Es soll den Abschied von einem Wohlstandsmodell erleichtern, das aufgrund seiner chronischen Wachstumsabhängigkeit unrettbar geworden ist. Darauf deuten verschiedene Entwicklungen hin, die lange verdrängt wurden. Aktuelle Verschuldungs- und Finanzkrisen, für die keine Lösungen in Sicht sind, werfen die Frage auf: Wie viel unseres Reichtums hätte je entstehen können, wenn sich moderne Staaten nicht permanent und mit steigender Tendenz verschuldet hätten? Noch prägnantere Grenzen setzt die Verknappung jener Ressourcen, aus deren schonungsloser Ausbeutung sich das Wirtschaftswachstum bislang speisen konnte, nämlich fossile Rohstoffe, seltene Erden, Metalle und Flächen.
Mit dem immensen Konsum- und Mobilitätsniveau wuchs im Zuge der Globalisierung zugleich die Abhängigkeit von überregionalen Versorgungsketten und Marktdynamiken. Ohne deren komplexe, faktisch unbeherrschbare Verflechtung wäre die Wohlstandsexpansion nie zu haben gewesen, denn nur so lassen sich die Potenziale der industriellen Arbeitsteilung ausschöpfen. Andererseits liegt darin der Keim für viele Bruchstellen. Dass die Verletzlichkeit unserer Lebensweise längst keine Theorie mehr ist, zeigten die jüngste Holz- und Chipkrise ebenso wie die ökonomischen Folgen der Coronapandemie sowie des Ukrainekriegs. Der zu schwindelerregender Höhe aufgetürmte Wohlstand gleicht einem Kartenhaus, das eine fatale Unvereinbarkeit heraufbeschwört: Zunehmende Fallhöhe trifft auf zunehmende Instabilität. Je höher das Stockwerk, desto tiefer der Fall, wenn alles zusammenstürzt. Und das Fundament bröckelt bereits.
Aber ist das überhaupt eine schlechte Nachricht? Schließlich bräuchte die geschundene Ökosphäre ohnehin dringend eine Verschnaufpause. Die bekommt sie nicht, solange die Wirtschaft weiter wächst. Wird innerhalb eines expandierenden ökonomischen Systems versucht, einen bestimmten ökologischen Schaden zu beheben, entstehen anderswo neue Probleme. Das grandiose Scheitern bisheriger Anstrengungen, ökologische Probleme anstatt durch einen Rückbau des ruinösen Industriemodells mithilfe technischer Innovationen zu lösen, ähnelt einer Hydra, der für einen abgeschlagenen Kopf zwei neue nachwachsen. Denn wenn die Schadensbehebung das Wachstum nicht gefährden soll, muss es sich um addierte Maßnahmen oder Objekte handeln, welche die in Geld gehandelte Wertschöpfung, das sogenannte Bruttoinlandsprodukt (BIP), hinreichend steigern.
Die seit Jahrzehnten ermüdend diskutierte Feststellung, dass das Bruttoinlandsprodukt kein geeigneter Maßstab für das Wohlergehen moderner Gesellschaften sein kann, ist schlicht eine Verharmlosung. Vielmehr müsste das Bruttoinlandsprodukt als Maß für ökologische Zerstörung betrachtet werden. Enthalten sind darin all jene Leistungen, die als Resultat geldbasierter Arbeitsteilung zustande kommen. Das sind grundsätzlich Dinge, die produziert werden, um sie dann als geldwerte Leistung an jemand anderen zu übertragen. Genau dieser Leistungstransfer kann nicht ökologisch neutral sein. Einen CO2-neutralen Euro, Dollar oder Yen kann es schon deshalb nicht geben, weil er den Anspruch auf materielle Werte verkörpert.
Worin könnte ein Zuwachs an Nutzen oder Lebensqualität letztlich bestehen, der stofflich und energetisch neutral ist, aber dennoch produziert, transportiert und erworben werden muss – und zwar in steigendem Maße, sonst entfiele ja das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts? Wie kann der Ursprung für die von einem Individuum empfundene Nutzensteigerung einerseits außerhalb seiner selbst liegen, aber andererseits jeglicher Materiebewegungen und Energieflüsse enthoben sein? Wenn ein Zuwachs an Wohlbefinden tatsächlich rein qualitativer, also vollständig entmaterialisierter Art wäre, könnte seine Quelle nur im Subjekt selbst liegen. Nicht arbeitsteilige Produktion nebst dazu notwendiger Raumüberwindung wäre der Ursprung, sondern die eigene Leistung und Imagination, mit der dem materiell Vorhandenen zusätzliche Befriedigung abgerungen oder neuer Sinn eingehaucht wird.
Aber dieser Vorgang kann weder als monetär zu beziffernde Wertsteigerung ausgedrückt werden, noch ist er kompatibel mit dem, was unter Wirtschaft verstanden wird. Vor allem: Seine Resultate können kaum über eine bestimmte Menge hinauswachsen. Wachsen im ökonomischen Sinn kann also nur das, was mittels Geld und Energie von außen zugeführt werden muss und deshalb nie ohne Zerstörung zu haben ist. Anstatt die Beziehung zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit mit Anspruch auf Vollständigkeit aufzuarbeiten, sind es im Wesentlichen drei Thesen, auf die sich das vorliegende Buch konzentriert.
Erstens: Der aktuelle, nur durch Wachstum zu stabilisierende Wohlstand ist nicht zufällig das Resultat einer umfassenden ökologischen Plünderung. Versuche, die vielen materiellen Errungenschaften einer Abfolge von Effizienzfortschritten oder anderweitiger menschlicher Schaffenskraft zuzuschreiben, beruhen auf einer Selbsttäuschung. Dies soll anhand dreier Entgrenzungsvorgänge dargestellt werden, die für das moderne Dasein prägend sind. Demnach leben die Menschen in modernen Konsumgesellschaften auf dreifache Weise über ihre Verhältnisse, denn sie eignen sich Dinge an, die in keiner äquivalenten Beziehung zu ihrer eigenen Leistungsfähigkeit stehen. Sie entgrenzen ihren Bedarf erstens von den gegenwärtigen Möglichkeiten, zweitens von den eigenen körperlichen Fähigkeiten und drittens von den lokal oder regional vorhandenen Ressourcen (Kapitel I–III).
Zweitens: Jegliche Anstrengungen, wirtschaftliches Wachstum durch technische Innovationen von ökologischen Schäden zu entkoppeln, sind bestenfalls zum Scheitern verurteilt. In allen anderen Fällen kommt es sogar zu einer Verschlimmbesserung der Umweltsituation (Kapitel IV).
Drittens: Das Alternativprogramm einer Postwachstumsökonomie würde zwar auf eine drastische Reduktion der industriellen Produktion und des Technologieeinsatzes hinauslaufen, aber zum einen die ökonomische Stabilität der Versorgung (Resilienz) stärken und zum anderen keine Verzichtsleistung darstellen, sondern sogar die Aussicht auf mehr Lebensqualität eröffnen (Kapitel VI).
Derzeit verzetteln sich moderne Gesellschaften in einer reizüberfluteten Konsumsphäre, die deren knappste Ressource aufzehrt, nämlich Zeit. Durch den Abwurf von Wohlstandsballast bestünde die Chance, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, statt im Hamsterrad der käuflichen Selbstverwirklichung zusehends Schwindelanfälle zu erleiden. Wenige Dinge intensiver zu nutzen und zu diesem Zweck bestimmte Optionen einfach souverän zu ignorieren, bedeutet weniger Stress und damit mehr Lebenszufriedenheit. Und überhaupt: Das einzig noch verantwortbare Gestaltungsprinzip für Gesellschaften und Lebensstile im 21. Jahrhundert heißt Reduktion – und zwar verstanden als Befreiung von jenem Überfluss, der nicht nur das Leben verstopft, sondern die aktuelle Daseinsform so verletzlich werden ließ.