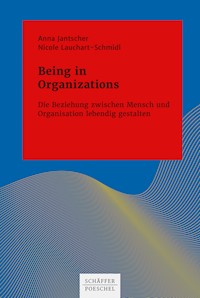
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Systemisches Management
- Sprache: Deutsch
Führungskräfte im Spannungsfeld zwischen den persönlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden und den Interessen der Organisation: Der Wunsch von Mitarbeitenden, weniger als reines Humankapital bzw. Mittel zum Zweck von Organisationen betrachtet zu werden, wird immer lauter. Die Organisation wiederum strebt nach Funktionalität – Ziele und Aufgaben müssen erreicht werden. Dieses Spannungsfeld zwischen persönlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden und den Interessen der Organisation überfordert Führungskräfte, die als Bindeglied zwischen beiden agieren müssen. Noch gibt es wenige Antworten auf die Frage, wie eine sinnvolle, leistungsbereite und realisierbare Beziehung zwischen Organisationen und Menschen aussehen kann. Es braucht daher neue Ideen und alternative Modelle. In diesem Buch beschreiben die Autorinnen auf Basis des Phänomens der Resonanz von Hartmut Rosa eine sinnvolle Alternative zu bestehenden Konzepten der Beziehungsgestaltung zwischen Menschen und Organisation. Inhalt: - Die Sehnsucht nach der Ganzheit - Die Logik der Organisation - Das menschliche Potenzial - Die Beziehung ist kompliziert: Der Zwischenraum - Neue Lösungsmöglichkeiten für eine lebendige Beziehung - Die resonanzfähige Organisation - Der resonanzfähige Mensch - Resonanz erzeugen als Führungskraft - Die Wirkung von Resonanz in Veränderungsprozessen - In die Umsetzung kommen: Ein Leitfaden - Transformation: heute und in Zukunft
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[5]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumAbbildungsverzeichnis1 Die Suche nach der Ganzheit1.1 Sehnsuchtsort Organisation1.2 Megatrend New Work und der Anspruch auf Ganzheit1.3 Wie viel Ganzheit ist realistisch?1.4 Die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung: Was Sie in diesem Buch erwartet2 Die Logik der Organisation2.1 Das Zusammenspiel von Sinn, Mitgliedschaft und Hierarchie2.1.1 Der Sinn von Organisationen2.1.2 Arbeitskraft durch Mitgliedschaft2.1.3 Die »heilige« Ordnung2.1.4 Das Zusammenspiel der drei2.2 Die menschenleere Organisation2.3 Was erwarten Organisationen von Menschen?3 Das menschliche Potenzial3.1 Wie ticken Menschen?3.1.1 Lebensprinzipien des Menschen3.1.2 Die menschlichen Grundbedürfnisse3.1.3 Die menschlichen Gefühle3.1.4 Die menschliche Wahrnehmung3.2 Systemisch betrachtet: Der Mensch und seine verschiedenen Ganzheiten3.3 Was suchen Menschen in Organisationen wirklich?4 Die Beziehung ist kompliziert: Der Zwischenraum4.1 Einstellige und zweistellige Beziehungen4.2 Die Asymmetrie4.3 Die Gurke im Essig4.4 Wie die Umwelt die Beziehung zwischen Mensch und Organisation beeinflusst4.5 Was ist der menschliche Anteil an der Kompliziertheit?4.5.1 Fehlende bewusste Wahrnehmung4.5.2 Teamdynamik als Stolperstein4.6 Was ist der organisationale Anteil an der Kompliziertheit?4.6.1 Augenhöhe ist nicht möglich: Die Verwechslung4.6.2 Die Organisation wird instrumentalisiert4.6.3 Einfacher wäre es mit trivialen Maschinen4.7 Womit ist die Führungskraft im Zwischenraum konfrontiert?4.7.1 Das Spannungsfeld gegensätzlicher Interessen aushalten4.7.2 Die gesamte Klaviatur beherrschen4.7.3 Den Zwischenraum in selbstorganisierten Teams gestalten5 Neue Lösungsmöglichkeiten für eine lebendige Beziehung5.1 Standortbestimmung: Die Schieberegler5.1.1 Die menschenzentrierte Organisation5.1.2 Die funktionszentrierte Organisation5.2 Annäherung in der Mitte: Die zweistellige Beziehung5.2.1 Die Position neuer Organisationskonzepte5.2.2 Die Mitte ist dynamisch5.3 Eine lebendige Beziehung gestalten: Die Resonanztheorie von Hartmut Rosa5.4 Die Organisation als Resonanzraum5.4.1 Die Resonanzachsen5.4.2 New Work und die Sehnsucht nach Resonanz6 Die resonanzfähige Organisation6.1 Setting the stage: Klarheit als Basis für eine lebendige Beziehung6.1.1 Der Purpose als Leitstern6.1.2 Rollen und Verantwortlichkeiten schaffen Erwartungsklarheit6.1.3 Handlungsprinzipien als wichtige Leitplanken6.1.4 Wer entscheidet hier was?6.1.5 Transparenz als wichtige Basis6.2 Sicherheit als Basis für Entwicklung auf beiden Seiten6.2.1 Die Sicherheits-Performance-Korrelation6.2.2 Eine Kultur der Sicherheit etablieren6.3 Planung und Kontrolle reduzieren6.4 Remove the fence7 Der resonanzfähige Mensch7.1 Die Kompetenz der Selbst-Differenzierung7.2 Sich erreichen lassen7.2.1 Zuhören7.2.2 Wertschätzung und Empathie üben7.3 Darauf antworten: Selbstwirksamkeit erleben7.3.1 Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung7.3.2 Die Stille durchbrechen: Feedback geben7.4 Sich immer wieder öffnen, heißt verzeihen können7.5 Sich für die Transformation öffnen7.6 Sich auf Ungewisses einlassen7.6.1 Improvisationskompetenz entwickeln7.6.2 Lösungsbegabung trainieren7.7 Den eigenen Purpose entdecken, die eigenen Werte kennen7.7.1 Mit den eigenen Werten arbeiten7.7.2 Einen persönlichen Purpose Quest durchführen8 Resonanz erzeugen als Führungskraft8.1 Resonantes Führen in der menschenzentrierten Organisation8.1.1 Die Realität anerkennen8.1.2 Achtsam sein und alte Muster aufbrechen8.1.3 Klarheit über die eigene Führungsverantwortung gewinnen8.1.4 Wirksame Kommunikation schaffen8.2 Resonantes Führen in der funktionszentrierten Organisation8.2.1 You are always on stage!8.2.2 Arbeiten Sie an Ihrer Vorbildwirkung8.2.3 Übernehmen Sie Ihre Führungsrolle8.3 Soziale Räume eröffnen8.3.1 Psychologische Sicherheit fördern8.3.2 Verbindung schaffen: Matrix Leadership9 Die Wirkung von Resonanz in Veränderungsprozessen9.1 Die vier Räume der Veränderung9.2 Resonante Führung in Veränderungsprozessen10 In die Umsetzung kommen: Ein Leitfaden10.1 Analysephase10.2 Der Blick aufs Ganze10.3 Hypothesen bilden10.4 Stoßrichtungen festlegen und Prototypen entwickeln11 Transformation: Heute und in ZukunftDanksagungLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnisDie AutorinnenHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft - Steuern - Recht GmbH
[4]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-5258-8
Bestell-Nr. 10669-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-5259-5
Bestell-Nr. 10669-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-5260-1
Bestell-Nr. 10669-0150
Anna Jantscher/Nicole Lauchart-Schmidl
Being in Organizations
1. Auflage, August 2021
© 2021 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
www.schaeffer-poeschel.de
Illustrationen: Jara Lauchart
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Lektorat: Jana Fritz – TEXTECHT, Stuttgart
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
Ein Unternehmen der Haufe Group
[9]Abbildungsverzeichnis
Abb. 1:Die verschiedenen Seiten der OrganisationAbb. 2:Nested WhyAbb. 3:Das Neuwaldegger DreieckAbb. 4:Die menschlichen BedürfnisseAbb. 5:Wahrnehmung vs. WahrgebungAbb. 6:Das biologische und das psychische SystemAbb. 7:Das soziale System entstehtAbb. 8:Das soziale SystemAbb. 9:Das menschliche Potenzial – eine BlackboxAbb. 10:Die menschliche SichtAbb. 11:Die organisationale SichtAbb. 12:Das Spannungsfeld zwischen innen und außenAbb. 13:Das Beziehungskreuz von Mensch und OrganisationAbb. 14:Neuwaldegger KomplexitätsmatrixAbb. 15:Rangdynamik-ModellAbb. 16:Das Wechselspiel zwischen Individuum, Organisation und GesellschaftAbb. 17:FührungskontinuumAbb. 18:Das Sensorium der Organisation vergrößert sichAbb. 19:Der Schieberegler MenschAbb. 20:Die gegengleichen Schieberegler Mensch und OrganisationAbb. 21:Mensch und Organisation in ResonanzAbb. 22:Die Hebel der resonanzfähigen OrganisationAbb. 23:Die vier Räume von TeamsAbb. 24:Der Eisberg der OrganisationAbb. 25:Mögliche EntscheidungsvariantenAbb. 26:EntscheidungskontinuumAbb. 27:Psychologische Sicherheit und PerformanceAbb. 28:Die resiliente Organisation nach DenyerAbb. 29:Das Cynefin Framework nach Snowden/BooneAbb. 30:Remove the fenceAbb. 31:Die Hebel für den resonanzfähigen MenschenAbb. 32:ErfahrungswürfelAbb. 33:Über und unter der WasseroberflächeAbb. 34:Radical CandorAbb. 35:Die fünf Level des ZuhörensAbb. 36:Die menschenzentrierte OrganisationAbb. 37:Leadership Pipeline[10]Abb. 38:Die Systemische Schleife der KommunikationAbb. 39:Das ResonanzdreieckAbb. 40:Die funktionsorientierte OrganisationAbb. 41:Die RollenlandkarteAbb. 42:Ein Healthy Ground entsteht durch unterschiedlich viele VerbindungenAbb. 43:Die vier Räume der VeränderungAbb. 44:Der stetige WandelAbb. 45:Einsatz der Schieberegler bei Veränderungen[11]1Die Suche nach der Ganzheit
1.1Sehnsuchtsort Organisation
Wenn Sie dieses Buch zur Hand nehmen, sind Sie vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit, lesen es auf der Fahrt nach Hause oder sind in Ihren eigenen vier Wänden und denken an die Arbeit. Die Arbeit und die Liebe sind zwei der wichtigsten Säulen unseres Lebens. Das soll auch Sigmund Freud schon gesagt haben. Denn in beiden Bereichen erleben wir unsere Identität, eine Form von Zugehörigkeit, Sicherheit und unseren Selbstwert.
In der heutigen Zeit gewinnt die Aussage von Freud zunehmend an Bedeutung, denn wir befinden uns in einem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel, der auch einen Wandel von Organisationen verlangt. Kommende Generationen, die ins Arbeitsleben einsteigen, setzen immer mehr auf Sinn und streben danach, etwas Sinnvolles zu tun. Aus reinen Karrieregründen oder lediglich zum Zweck des Geldverdienens bleibt heute kaum noch jemand in einem Unternehmen.
Willkommen in der Identitätsökonomie
Unsere Großeltern haben in einer Produktionsökonomie und unsere Eltern in einer Dienstleistungsökonomie gelebt. Wir selbst arbeiten hingegen in einer Identitätsökonomie, wie Esther Perel es nennt (vgl. Raptopoulus 2019). Viele fragen sich weniger, »Was werde ich als Nächstes tun?«, sondern vielmehr, »Wer möchte ich als Nächstes sein?« Überspitzt gesagt bedeutet dies: Viele Menschen suchen heutzutage einen Job, der ihnen Flexibilität gibt, zur Einzigartigkeit ihrer persönlichen Situation passt, zu ihrem emotionalen und physischen Wohlbefinden beiträgt, ihnen bei ihrer psychologischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung hilft und noch dazu Sinn stiftet. Die Wissenschaftlerinnen und Autoren Keagan und Laskow Lahey sprechen in diesem Zusammenhang von einem »neuen Einkommen«, das Angestellte beziehen wollen. Früher haben die monatliche Gehaltszahlung, die Nebenleistungen und die begrenzten Stundenvorgaben als Entlohnung gereicht. Heute geht es um persönliche Erfüllung, Sinnhaftigkeit und das Glücklichsein am Arbeitsplatz. Natürlich werden Gehalt, Prämien und Nebenleistungen immer eine Rolle spielen; vielen von uns sind sie jedoch nicht mehr genug (vgl. Keagan et al. 2016, S. 8). Vor nicht allzu langer Zeit haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Firma verlassen, wenn sie in Rente gingen oder das Unternehmen Insolvenz anmelden musste. Heute gehen sie, weil sie ihr Potenzial nicht richtig entfalten können oder nicht genug gefördert werden. Wir sehen unseren Job somit als eine Gelegenheit, unsere Identität zu finden und auszuleben (vgl. Raptopoulus 2019).
[12]Wer heutzutage Bewerbungsgesprächen beiwohnt, hört mitunter Sätze wie: »Meine Freizeit ist mir sehr wichtig, flexible Zeiteinteilung ist sowieso schon Standard. Ich achte sehr auf meine Gesundheit, bilde mich regelmäßig weiter und will Zeit für meine Familie haben. Das lässt sich mit einem 24/7-Job nicht bewältigen. Welche alternativen Arbeitsmodelle bieten Sie an?« Die Verblüffung der rekrutierenden Führungskräfte ist dann immer groß, vor allem wenn es sich um eine Bewerbung für eine Managementposition handelt.
VUKA, Arbeitswelt 4.0 und New Work – eine neue Komplexität
Doch nicht nur die individuellen und gesellschaftlichen Vorstellungen von Arbeit verändern sich, sondern auch die Anforderungen an viele Organisationen – bedingt durch den sich stetig wandelnden wirtschaftlichen Kontext, in dem sie sich bewegen. Bekannte Schlagworte wie VUKA (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität), Arbeitswelt 4.0 und New Work beschreiben, dass Organisationen häufig Wege finden müssen, um mit steigender Komplexität wirksam umzugehen. Spezifische menschliche Potenziale wie Kreativität, Eigeninitiative und die Fähigkeit zur Selbstorganisation rücken in den Fokus. Insbesondere hochqualifizierte Arbeit in flexiblen und innovativen Kontexten ist zunehmend an menschliches Arbeitsvermögen und Kooperationsfähigkeit gebunden. Organisationen sind daher gezwungen, die verschiedensten Fähigkeiten in ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszubilden, um den neuen Herausforderungen der Digitalisierung, des disruptiven Wandels und der Schnelllebigkeit zu begegnen (vgl. Geramanis/Hutmacher 2020, S. VI).
All diese Entwicklungen verstärken sich gegenseitig und führen unserer Ansicht nach dazu, dass der Mensch in seiner Entfaltung und mit seinen Bedürfnissen immer mehr in den Mittelpunkt von Organisationen rückt.
1.2Megatrend New Work und der Anspruch auf Ganzheit
New Work stellt den Überbegriff für diesen Umbruch der Arbeitswelt dar. Es ist ein Trend, der aus unterschiedlichen Richtungen getrieben wird: von den technologischen Entwicklungen, von einem sich verändernden Wertebewusstsein der Mitarbeiterinnen, der Kunden und der Gesellschaft sowie von der Digitalisierung, die die Wertschöpfung in Unternehmen massiv verändert. New Work wird mittlerweile sogar als Megatrend bezeichnet. Das heißt, dass er für mehrere Jahrzehnte als Entwicklungskonstante gesehen wird, die jeden einzelnen Menschen betrifft und auf allen Ebenen der Gesellschaft wirkt (vgl. Zukunftsinstitut 2020).
New Work beschreibt einen epochalen Umbruch, der mit der Sinnfrage beginnt und die Arbeitswelt von Grund auf umformt. Das Konzept stellt die Potenzialentfaltung eines jeden Einzelnen in den Mittelpunkt. Denn New Work zufolge steht die Arbeit im Dienst des Menschen: »Wir arbeiten nicht mehr, um zu leben, und wir leben nicht mehr, um zu arbei[13]ten. In Zukunft geht es um die gelungene Symbiose von Leben und Arbeiten.« (vgl. Zukunftsinstitut 2020).
Besondere Aufmerksamkeit genießt in diesem Kontext der belgische Berater und Bestsellerautor von Reinventing Organizations, Frederic Laloux. Er gilt als Vordenker der New-Work-Bewegung und ist einer der Autoren, die diesen Stein noch mehr ins Rollen gebracht haben. Aufbauend auf unterschiedlichen Ansätzen hat er ein Modell entwickelt, das die Entwicklungsstufen von Organisationen abbildet. Laut seinem Ansatz stehen wir vor einer neuen Stufe, die er »Teal« nennt. Laloux vertritt die These, dass die heutige Organisationsführung ihre Grenzen erreicht hat und viele das Leben in Unternehmen als desillusionierend, unerträglich und sinnlos erfahren. Neben neuen Strukturen und Steuerungslogiken, die die Selbstorganisation fördern und es Organisationen ermöglichen, in einer immer komplexer werdenden Welt zu überleben, nimmt er auch auf den Menschen Bezug.
TEAL ORGANISATIONEN
Laloux beschreibt die drei großen Durchbrüche von Teal Organisationen folgendermaßen (Laloux 2014, S. 56):
In diesen Organisationen ersetzen Selbstmanagement und verteilte Führung die hierarchische Struktur.Im Vordergrund stehen das Streben nach innerer Stimmigkeit und die Entfaltung des eigenen Potenzials. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden eingeladen, mit ihrer Ganzheit (Wholeness) zur Arbeit zu kommen und nicht nur mit ihrem professionellen Selbst.Der Sinn und Zweck der Organisation wird zu einem primären Motivator und Orientierungspunkt für die Mitglieder.Laloux definiert das Prinzip der Ganzheitlichkeit des Menschen in Organisationen und betrachtet es als mindestens so wirkmächtig wie die Selbstorganisation – viele würden seine Wichtigkeit jedoch unterschätzen. Er beschreibt, dass wir uns in konventionellen Organisationen häufig gezwungen fühlten, eine professionelle Maske zu tragen. Wenn wir so viel von dem, was uns ausmacht, hinter einer Maske versteckten, würden wir uns auch von einem Großteil unserer Energie, Kreativität und Leidenschaft trennen. Das Persönliche werde vom Beruflichen abgeschnitten, dabei würden das Ego und der rationale Verstand überbetont, während die emotionalen und spirituellen Aspekte negiert würden. Wenn Menschen maskenfrei – das heißt: ganz – auftreten könnten, würden Beziehungen tiefer und reicher. Das wiederum führe zu einer außerordentlichen Lebendigkeit in Organisationen (vgl. Laloux 2014, S. 44). Damit folgt die New-Work-Bewegung weiterhin den Überlegungen von Frithjof Bergmann, der als ihr Begründer gilt und in seinem Werk Neue Arbeit, Neue Kultur der Arbeit die Fähigkeit zuschreibt, den Menschen noch lebendiger machen zu können (vgl. Bergmann 2004).
[14]1.3Wie viel Ganzheit ist realistisch?
So sehr die Sehnsucht nach und der Anspruch auf Ganzheit in Organisationen verständlich ist, so sehr erleben wir in unserem Beratungsalltag eine offensichtliche Unvereinbarkeit mit der erlebten Realität und eine Unrealisierbarkeit der Wünsche, die hinter dieser Sehnsucht stecken. Oft scheint es nämlich so, dass die Entfaltung des Menschen zum einzigen Organisationzweck mutiert. »Der Mensch soll ganz in der Organisation sein können« – Sätze wie diese liest man in Managementbüchern und -zeitschriften mittlerweile häufig. Dieser Wunsch scheint angesichts der oben dargestellten Entwicklungen der individuellen Haltung und des Megatrends New Work nachvollziehbar. Wir fragen uns jedoch: Ist er tatsächlich realistisch, und sind Organisationen wirklich der richtige Ort dafür? Wie auf einer Waage entsteht durch solche Aussagen ein Ungleichgewicht, und die Balance zwischen den Bedürfnissen des Menschen und den Bedarfen der Organisation gerät ins Schwanken.
Der Zweck von Organisationen
Der Wunsch und Anspruch, als Mensch ganz in der Organisation sein zu können, entspricht aus unserer Sicht nicht dem Zweck von Organisationen und überbeansprucht diese. Wenn man aus Organisationssicht auf den Menschen blickt, ist wichtig zu sehen, dass die Bedürfnisse der Beschäftigten nicht zu deren Selbstzweck berücksichtigt werden, sondern damit diese ihre Arbeitskraft besser einsetzen können und die Organisation somit weiter bestehen und ihren Zweck erfüllen kann (vgl. Kühl 2018, S. 61).
Die Ganzheit des Menschen und seine Erfüllung ist somit per se kein Zweck, den die Organisation verfolgt. Sie ist vielmehr wichtig, damit Organisationen ihren Zweck erfüllen können, da gemeinsam geteilte Werte, Normen, Motive und Grundhaltungen im Gegensatz zum reinen Tauschprinzip von Arbeitskraft gegen Geld die Zusammenarbeit erleichtern. Zusätzlich akzeptieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Mitgliedschaft in Organisationen auch die formalen Spielregeln des Systems, in dem sie Mitglied wurden. Ganz ohne »professionelle Maske«, wie Laloux es nennt, werden sie sich daher nie wirklich bewegen können, solange sie Mitglied bleiben wollen (vgl. Kühl 2011, S. 30 f.).
An einem Ort im Leben ganz zu sein und die Maske ablegen zu können scheint für viele Menschen eine große Sehnsucht darzustellen. Diese Sehnsucht wird daher häufig unhinterfragt übernommen. Der Ausblick auf Ganzheit scheint so hoffnungsvoll – dabei beschäftigt die Überwindung des Egos die Menschheit bereits seit Tausenden von Jahren. Die gewünschte Radikalität einer neuen Arbeitswirklichkeit wird somit wohl eher beschworen, als dass sie tatsächlich gelebt werden kann. Wir sind der Meinung: Organisationen können diese Sehnsucht des Menschen nicht voll erfüllen und sind auch nicht der richtige Ort, um Masken ganz abzulegen.
[15]Es geht um die richtige Balance
Gleichzeitig möchten wir betonen: Die Entfaltung und das Ernstnehmen des Menschen mit seinen Bedürfnissen ist für Organisationen unabdingbar. Wir haben die Vorstellung, dass Organisationen Orte sein können, an denen Entwicklung möglich ist, und zwar für Mensch und Organisation gleichermaßen. Es geht uns um die gute Balance. Ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die neu in ein Team kam, das wir in seinem Entwicklungsprozess begleitet haben, verdeutlicht unsere Bedenken. »Mit zwei kleinen Kindern, alleinerziehend und neu im Job war ich am Anfang total überfordert. An manchen Tagen wollte ich nur losheulen. Mir war alles zu viel. Ehrlich gesagt habe ich oft geweint und gezeigt, dass ich überfordert bin. Ich habe viel Unterstützung von meinem Arbeitgeber bekommen, um meine Situation zu verbessern. Irgendwann habe ich dann verstanden: Ich bin hier an meinem Arbeitsplatz. Es ist nicht Aufgabe der Organisation, meine emotionale Überforderung Tag ein Tag aus mitzutragen. Irgendwann ist die Grenze erreicht. Ich muss mich selbst darum kümmern, dass ich das in den Griff bekomme, und hier meinen Job gut machen, für den ich eingestellt wurde und bezahlt werde.«
Zusammengefasst sehen wir den Ansatz des »maskenfreien« Seins in der Organisation als Überforderung dieser. Das zu schreiben, kommt uns in der heutigen Zeit fast schon kühn vor, läuft es doch scheinbar gegen den vorherrschenden Trend, der eine menschenzentrierte Organisation fordert. Dennoch tun wir es, denn aus unserer Perspektive gibt es noch zu wenige Antworten auf die Frage, wie eine sinnvolle, leistungsbereite und realisierbare Beziehung zwischen Organisationen und Menschen aussehen kann, die die Beschäftigten in ihrem Bedürfnis nach Verbundenheit und Zugehörigkeit ernst nimmt und dennoch nicht blind dem Glauben folgt, dass die menschliche Entfaltung der einzige Organisationszweck ist.
Dieses Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen der Menschen und den Bedarfen der Organisation überfordert häufig auch Führungskräfte, die als Bindeglied zwischen beiden agieren. Slavoj Žižek schreibt dazu in seinem Buch In Defense of Lost Causes sinngemäß: Konzentriert man sich auf das Individuum, verliert man die Gesamtheit aus dem Blick, konzentriert man sich auf die Gesamtheit, verliert man das Individuum aus dem Blick (vgl. Žižek 2008). Sieht so ein ausgeglichener Weg aus, der beides berücksichtigt?
Mag sein, dass Sie Einwände haben und der Meinung sind, das Wort »Ganzheit« dürfe man ohnehin nicht ganz wörtlich nehmen. Damit sei ja nur gemeint, dass man am Arbeitsplatz ein wenig authentischer sein kann und sich der eigenen Organisation wieder verbundener fühlt. Doch wenn wir uns auf schwammige Definitionen einlassen, begeben wir uns auf unsicheres Gelände, das kein zielgerichtetes Arbeiten ermöglicht. Was wir uns wünschen, ist eine exakte Auseinandersetzung mit dem Thema, denn nur so [16]können Sie als Wirkende in Organisationen und auch wir als Beraterinnen konkret gestalten und Ihr Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen.
1.4Die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung: Was Sie in diesem Buch erwartet
Der beschriebene Wandel der Arbeitswelt macht für viele Unternehmen neue Formen der Organisation und Zusammenarbeit erforderlich. In unserer Begegnung mit verschiedensten Organisationen haben wir immer wieder erlebt, dass der New-Work-Ansatz in unterschiedlicher Tiefe und Breite umgesetzt wird. Manche führen ein Großraumbüro ein – mit der Intention, die Hierarchien räumlich zu durchbrechen und die Zusammenarbeit zu erleichtern – und stellen es unter die Überschrift »New Work«. Andere befassen sich mit neuen Organisationsstrukturen, Selbstorganisation und agilen Arbeitsmethoden.
Perspektivwechsel: Sowohl-als-auch statt Entweder-oder
Im Prinzip geht es bei New Work darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Organisationen erfolgreich macht, ohne dass dies auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. Die New-Work-Bewegung stellt den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt, um gleichzeitig eine Wirkung zu erzeugen, die auf die Ziele des Unternehmens einzahlt. Das Wort »gleichzeitig« ist dabei für uns von großer Bedeutung. Damit ist ein Sowohl-als-auch gemeint: Der Mensch steht ebenso im Mittelpunkt wie die Ziele des Unternehmens.
Warum betonen wir das so sehr? Weil diese Perspektive der Grund ist, warum wir uns berufen fühlen, dieses Buch zu schreiben. Denn aus unserer Sicht gelingt dieses Sowohlals-auch in der Praxis noch selten. Es scheint, als gehe es manchen Verfechtern von New Work nur darum, den Menschen in den Mittelpunkt der Organisation zu stellen. Die Organisation mit ihren Bedarfen tritt dabei in den Hintergrund. Überspitzt gesagt scheint es, als ob Organisationen den Menschen lange genug beschnitten und ihm das Leben schwer gemacht haben, und jetzt sollen endlich einmal die Menschen an der Reihe sein.
Der Wunsch nach Ausgeglichenheit ist jedoch nicht neu. Bereits im letzten Jahrhundert versuchte die Human-Relations-Bewegung, die Bedürfnisse des Menschen sowie seine psychologische Verfassung und Identität mehr in den Fokus der Managementtätigkeit zu rücken. Kritisiert wurde an diesem Ansatz die Einseitigkeit der Maßnahmen. Der Organisation wurde keine Bedeutung geschenkt. In der aktuellen New-Work-Bewegungen laufen wir nun Gefahr, diesen Fehler zu wiederholen. Wieder rückt der Mensch mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt und die Organisation wird vernachlässigt.
[17]Wie beides gelingen kann – also die Organisation mit ihren Zwecken und ihrer Funktionsweise im Blick zu behalten und gleichzeitig den Menschen mit seinem Wunsch nach Potenzialentfaltung ernst zu nehmen –, wurde bisher noch wenig thematisiert. Mit frustrierenden Folgen: Orientieren sich Organisationen am New-Work-Ansatz und treffen gleichzeitig harte organisationale Entscheidungen, hört man häufig: »Die haben das mit New Work doch nicht so ernst gemeint. Wenn es hart auf hart kommt, zählt nur wieder der finanzielle Vorteil für das Unternehmen.« Sie sehen: Noch wird hier in einem Entweder-oder-Schema gedacht und gehandelt. Es entsteht der Eindruck, dass Organisationen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, kein großes Interesse mehr an Gewinn haben sollten, und Organisationen, die rein finanzgesteuert sind, der Mensch egal ist. Dass das eine das andere ausschließt, ist ein Paradigma, das wir Menschen erst durch den Fokus, mit dem wir auf die Welt schauen, erschaffen.
Laloux findet in seinem Buch Reinventing Organizations Beispiele von Firmen, die beides gut zu vereinen scheinen. Auch wir sind von der Möglichkeit eines Sowohl-als-auch überzeugt.
Bitte keine Verallgemeinerungen
Uns ist bewusst, dass wir hier nicht alle Menschen und Organisationen über einen Kamm scheren können. Von den Menschen, vom wir und von den Organisationen zu sprechen, verallgemeinert in einer Form, die der Realität nicht gerecht wird. Es ist sicher nicht so, dass alle Menschen nach Potenzialentfaltung und Selbstverwirklichung in der Arbeit streben. Und auch wenn überall proklamiert wird, dass die VUKA-Welt von Unternehmen Agilität verlangt, sehen wir das weniger schwarz-weiß. Es wird zum Beispiel nach wie vor Unternehmen geben, die auf Effizienz und Automatisierung setzen und für die Agilität weniger wettbewerbsentscheidend ist. Sie sind damit mehr auf effiziente Prozesse angewiesen als auf die Kreativität und Innovationskraft der Beschäftigten. Es wird auch immer Menschen geben, die gerne in solchen Organisationen arbeiten und sich genau in solch einem Kontext wohlfühlen – und das ist gut so. Genauso gibt es aber Unternehmen, die aufgrund des volatilen Umfelds, in dem sie sich bewegen, sehr stark auf die Lernfähigkeit, Kollaborationsbereitschaft, Kreativität und Innovationskraft ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen sind. Sie haben oft keine andere Wahl, als sich mit der Beziehungsgestaltung zwischen Mensch und Organisation auseinanderzusetzen, weil der Mensch für sie zu einer immer wichtigeren Ressource wird.
Die Lücke schließen
Was wir durch die oben beschriebenen Aspekte verdeutlichen möchten: Die Rolle des Menschen in Organisationen verändert sich vor allem da, wo es auf menschliche Innovationskraft ankommt. Der Mensch mit seinen Potenzialen rückt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Einerseits weil viele Menschen sich in ihrer individuellen Haltung ver[18]ändern, aber auch weil sich der Kontext wandelt, in dem sich viele Organisationen bewegen. Es gibt zahlreiche Bücher, die Hinweise und Anleitung geben, wie Organisationen der Identität des Menschen mehr Raum geben können. Es gibt auch viele Bücher, die die Funktionsweise von Organisationen im Blick haben. Was aus unserer Sicht jedoch noch kaum bis gar nicht stattgefunden hat, ist, beide Seiten zusammenzuführen und die Beziehung zwischen Mensch und Organisation genauer zu betrachten.
Diese Lücke wollen wir mit diesem Buch schließen und Ihnen alternative Modelle zur Beziehungsgestaltung zwischen Mensch und Organisation anbieten. Vor allem für Unternehmen, die in der VUKA-Welt wettbewerbsfähig bleiben müssen, sehen wir die Auseinandersetzung mit diesem Thema als besonders relevant. Aber auch für alle anderen Organisationen lohnt sich die Beschäftigung damit. Dafür sind ein grundsätzliches Verstehen beider Seiten und ein Gegenüberstellen der unterschiedlichen Bedarfe notwendig. Erst dann kann man an einer gelingenden Beziehungsgestaltung arbeiten. Genau um diese Schritte mit Ihnen zu gehen, haben wir dieses Buch geschrieben.
Kommen Sie mit auf die Reise
In den Kapiteln 2 und 3 wollen wir zunächst eine gemeinsame Sicht und Basis entwickeln, Sie mit der Systemtheorie vertraut machen und die beiden Aspekte Organisation und Mensch in Hinblick auf die Beziehungsgestaltung genauer betrachten. In Kapitel 4 nehmen wir die Beziehung und ihre Hintergründe in den Fokus. Wir rücken den Zwischenraum zwischen den beiden Aspekten Mensch und Organisation in den Vordergrund und ergründen ihn.
Im weiteren Verlauf geht es um Lösungsmöglichkeiten. Kapitel 5 bietet Ihnen ein Tool zur Standortbestimmung und setzt sich mit dem innovativen Gedanken der Resonanzfähigkeit auseinander, der aus unserer Sicht der Schlüssel für eine neue, beide Seiten integrierende Form der Unternehmens- und Mitarbeiterführung sein kann. In den Kapiteln 6, 7 und 8 bieten wir Ihnen dann konkrete Schritte und Tools an, mit denen Sie eine lebendige Beziehung zwischen Mensch und Organisation gestalten können, sodass einerseits die Menschen versorgt sind und wachsen dürfen und andererseits die Bedarfe der Organisation erfüllt werden. Den Abschluss bildet eine konkrete Handlungsanleitung, um in die Umsetzung zu kommen – ein Quickstart sozusagen.
[19]2Die Logik der Organisation
Organisationen knackig zu beschreiben ist gar nicht so einfach, handelt es sich doch um differenzierte Systeme, die unterschiedliche Erscheinungsformen annehmen. Organisationen wirken wie rätselhafte Gebilde. Je nachdem von welcher Seite man auf dieses Gebilde schaut – ob von innen oder von außen und mit welchen Erfahrungen im Hinterkopf –, wird etwas anderes sichtbar. Befragt man Menschen nach »ihrem« Bild von Organisation, erhält man ganz unterschiedliche Antworten wie: »das Gebäude«, »meine Tätigkeit«, »mein Team«, »die Geschäftsführung«, »die Produkte«. Auch die Bilder wandeln sich: Von außen betrachtet sieht die Abteilung X deutlich anders aus als von innen, wo neue Perspektiven sichtbar werden. Es gibt also nicht das Bild der Organisation.
Es ist, als würden wir mit verbundenen Augen zu einem Elefanten geführt und berührten diesen mit unserer ausgestreckten Hand, ohne zu wissen, was wir vor uns haben. Berühren wir ein Bein, antworten wir auf die Frage »Was ist das?« vielleicht mit: »Es fühlt sich an wie eine Säule!« Das Ertasten des Elefantenrüssels bringt uns dagegen eher zu der Vermutung: »Das könnte eine Schlange sein.« Wir haben eben immer nur einen kleinen Ausschnitt vor uns und sind nicht in der Lage, das Gesamte zu erfassen.
Abb. 1: Die verschiedenen Seiten der Organisation
[20]So ähnlich ist es auch mit Organisationen. Auf den Punkt gebracht hat es der Organisationspsychologe Karl Weick: »Das Wort Organisation ist ein Substantiv, und es ist außerdem ein Mythos. Wenn Sie eine Organisation suchen, werden Sie sie nicht finden. Was Sie finden werden ist, dass miteinander verbundene Ereignisse vorliegen, die durch Betonwände hindurchsickern; und diese Sequenzen, ihre Pfade und die zeitliche Ordnung sind die Formen, die wir fälschlich in Inhalte verwandeln, wenn wir von Organisation reden.« (Weick 1995, S. 129). Die Dynamik zwischen den einzelnen Teilen, die räumlich und zeitlich miteinander verbunden sind, ist es, was Organisation ausmacht.
Wir haben nicht die Absicht, Ihnen den Mythos Organisationen in der Kürze der nächsten Seiten ganzheitlich und umfassend zu erklären. Nicht umsonst gibt es bereits Tausende Bücher nur zu diesem Thema. Wir möchten jedoch jene Aspekte hervorheben und verdeutlichen, die relevant sind, um die Beziehung zwischen Mensch und Organisation besser verstehen und im Endeffekt auch anders gestalten zu können – das ist schließlich das Ziel dieses Buches.
2.1Das Zusammenspiel von Sinn, Mitgliedschaft und Hierarchie
Organisationen prägen das menschliche Leben von Beginn an. Bereits bei unserer Geburt haben wir meist Berührung mit der ersten Organisation unseres Lebens: dem Krankenhaus. Später machen wir wichtige Erfahrungen mit Gleichaltrigen beim Spielen in der Organisation »Kindergarten« und lernen in der Organisation »Schule«. In vielen Bereichen unseres Lebens sind Organisationen unsere ständigen Begleiter.
Von der Empfängerin zur Leistungserbringerin
Doch spätestens mit Beginn des Arbeitslebens ändert sich unser Verhältnis zur Organisation. Wir nehmen dann innerhalb der Organisation »eine Leistungsrolle« (Kühl 2011, S. 10) ein. Waren wir davor eher Konsumentinnen und Konsumenten, ist jetzt unser aktiver Beitrag gefragt. Damit beginnt eine andere Form der Beziehungsgestaltung, und der Mensch nimmt einen aktiven Part als Mitglied der Organisation ein. Von da an hat die Organisation bestimmte Erwartungen an ihr neues Mitglied, die zuvor in dieser Art und Weise nicht existiert haben. Es ist klar, dass die Erwartungen der Organisation »Krankenhaus« an die Patientin andere sind als die an eine Oberärztin oder an einen Pflegedirektor. Als Mitglied einer Organisation ist man anders gefordert als in der Rolle einer Kundin.
Durch ihre Mitgliedschaft treffen Menschen die Entscheidung, Bestandteil einer Organisation zu sein. Da ist es nur logisch, dass in unterschiedlichsten modernen Managementlehren (Teal Organisation, Scientific Management, Human-Relations-Ansatz etc.) [21]der Mensch zu einem zentralen Element von Organisationen wird. Betrachtet man diese Ansätze jedoch genauer, wird deutlich, dass die ausschließliche Zentrierung auf den ganzen Menschen nicht zutreffend sein kann und auch gar nicht möglich ist, wie wir in Kapitel 1.3 bereits angedeutet haben. Wenige Organisationen haben wohl Interesse, den ganzen Menschen mit seiner Lebensbiographie, seinen privaten Beziehungen, seinen unbewussten Anteilen und seinen Glaubensüberzeugungen in den Fokus zu nehmen. Es könnte auch eine ethische Frage sein, ob Organisationen das überhaupt sollen und dürfen. Vielmehr ist für Organisationen nur ein bestimmter Ausschnitt, ein Beitrag des Menschen von Interesse. Die Mitgliedschaft in einer Organisation ist an Bedingungen geknüpft. Das könnte die Leistung, das Verhalten, das Treffen von Entscheidungen oder Ähnliches sein. Verkürzt gesagt interessiert nicht der Mensch an sich, sondern das, was Menschen tun, was sie beitragen können. Die Erwartung der Organisation an die in ihr arbeitenden Menschen ist es, zu arbeiten (vgl. Boos/Mitterer 2014, S. 15 ff.).
Das Wesen von Organisationen
Und wie ist das nun mit der Forderung, in Organisationen »ganz« sein zu wollen? Dazu müssen wir das Wesen einer Organisation genauer betrachten. Da wir Neuwaldeggerinnen systemisch geprägt sind, bedienen wir uns eines unserer einfachen Werkzeuge – dem der Unterscheidung. Wir fragen uns: Was unterscheidet Organisationen von anderen sozialen Systemen? Es sind im Wesentlichen drei Ausprägungen: Organisationen entstehen aus einem Sinn und Zweck heraus; sie werden durch Menschen am Leben gehalten, die ihre Mitglieder sind; und sie sind in Hierarchien strukturiert. Erst das Zusammenspiel dieser drei Aspekte lässt eine Organisation entstehen und am Laufen halten.
2.1.1Der Sinn von Organisationen
Wenn Sie an die Gründung einer Organisation denken, ist der Gründungszweck normalerweise schnell erkennbar. Die Erzählungen über die berühmten »Garagen-Start-ups« beeindruckten in den letzten Jahrzehnten viele Unternehmerinnen und Unternehmer vor allem deshalb, weil durch sie innovative Produkte, bahnbrechende Ideen und das Verfolgen von revolutionären Zwecken möglich wurden. Man denke nur an die Microsoft-Gründer Paul Allen und Bill Gates oder die Apple-Ikone Steve Jobs.
Mit der Weiterentwicklung und Vergrößerung einer Organisation tritt der Gründungszweck häufig in den Hintergrund und es entsteht eher eine Sammlung von verschiedenen Zwecken (vgl. Kühl 2011, S. 58). Der Sinn einer Organisation geht nicht verloren, wenn diese wächst, er spaltet sich aber in Untereinheiten auf. Jede Abteilung, jedes Team trägt mit einem bestimmten Beitrag zum Sinn und Zweck der Organisation bei. [22]Simon Sinek und seine Co-Autoren fassen es in der folgenden Abbildung prägnant zusammen.
Abb. 2: Nested Why (nach Sinek et al. 2017, S. 85)
Diese verschiedenen Sinn-Nester können sich voneinander unterscheiden: So kann in ein und demselben Unternehmen der Sinn der Forschungsabteilung darin bestehen, in Innovation zu investieren, agil zu steuern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel freie Hand zu lassen, während der Produktionsbereich durch vorgegebene Abläufe deutlich skalierbare Effekte erzielen will und den Beschäftigten somit wenig Raum zur Selbstentfaltung gibt. Organisationen streichen oftmals die Einheit der unterschiedlichen Zwecke heraus, tatsächlich handelt es sich aber um ein Spiel im Spannungsfeld zwischen Wachstum und Effizienz, das es auszubalancieren gilt (vgl. Kühl 2011, S. 58 und Fink/Moeller 2018, S. 77). Gleichzeitig muss die Organisation mit ihren Ressourcen haushalten, denn so sehr das Spannungsfeld unterschiedlicher Zwecke Entwicklungspotenzial in sich birgt, so sehr drohen dadurch auch Ressourcen erschöpft zu werden. Als Führungskraft im Unternehmen müssen Sie immer wieder die unterschiedlichen Zwecke balancieren und Prioritäten setzten.
Der Organisationszweck erlebt gerade einen Bedeutungszuwachs, und zwar in beiden Ausprägungen seiner Bedeutung. Denn der Sinn hat laut Fink und Moeller einerseits eine sachliche Dimension, andererseits impliziert er eine starke, antreibende Emotion (vgl. Fink/Moeller 2018, S. 24):
Die sachlich-inhaltliche Dimension von Sinn beschreibt das Wofür und Wozu der Arbeitsleistung der Organisation, den Gründungszweck, der hoffentlich auch in der Umsetzung Sinn ergibt. Sinn gibt Orientierung, für Organisationen ist er ein Mittel, [23]um mit Komplexität umzugehen; er erlaubt, aus den Möglichkeiten auszuwählen und auf die vielfältigen Anforderungen zu reagieren.Die emotionale Dimension von Sinn beschreibt das Gefühl, etwas Sinnvolles beitragen zu wollen. Bei der Entscheidung für eine Mitgliedschaft in einer Organisation kann der Sinn und Zweck der Organisation einen entscheidenden Unterschied machen.Für den »richtigen« Sinn und Zweck sind Menschen bereit, sich einzuordnen. Damit sie zu einem bestimmten Sinn und Zweck beitragen können, verzichten sie bewusst oder unbewusst darauf, ihre Selbstentfaltung in den Vordergrund zu stellen. Was wie ein Verlust erscheint, ist doch ein Gewinn – nämlich dann, wenn der Sinn und Zweck von Organisation und Mensch übereinstimmt. Damit sind wir auch schon beim zweiten Aspekt, der das Wesen einer Organisation ausmacht: den Mitgliedern.
2.1.2Arbeitskraft durch Mitgliedschaft
Uns ist derzeit noch keine Organisation bekannt, die ganz ohne menschlichen Beitrag auskommt. Menschen spielen für die Entwicklung von Organisationen eine relevante Rolle. Mit der Unterschrift des Arbeitsvertrags oder auch nur stillschweigend erwirbt man die Mitgliedschaft in einer Organisation. Während die Mitgliedschaft in einer Familie durch Geburt und Verwandtschaft auf Lebenszeit gewährt wird (auch wenn die ungeliebte Tante nicht mehr zum Familienfest eingeladen wird, gehört sie doch weiterhin zum System Familie), ist die Mitgliedschaft in einer Organisation eine auf bestimmte Zeit vereinbarte. Manchmal wird die Beendigung bereits von Anfang an im Arbeitsvertrag festgehalten – etwas, das in Familien nicht vorkommt. Doch auch eine auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Mitgliedschaft kann durch Aufkündigung erlöschen. Im System Familie bleiben wir dagegen für immer offizieller Teil, auch wenn die Beziehung »verstummt« ist.
Es gibt allerdings auch Gemeinsamkeiten dieser beiden Systeme. Sowohl in Familien als auch in Organisationen bedeutet Mitgliedschaft eine Form von Zugehörigkeit im jeweiligen System. Was aus der Sicht der Organisation nur der Erfüllung eines Zwecks dient, ist für Menschen ein wesentliches Lebensprinzip, das wir im nächsten Kapitel noch weiter vertiefen.
Zugehörigkeit ist ein mächtiges Prinzip. Innerhalb von sozialen Systemen ist es wichtig, eine klare Grenze zu ziehen: Wer gehört dazu und wer nicht. Als soziale Wesen sind Menschen allein nicht lebensfähig. Zugehörigkeit ist also lebenswichtig. Der Entzug von Zugehörigkeit war früher häufig eine tödlich endende Bestrafung: Wer aus der dörflichen Gemeinschaft verbannt wurde, hatte kein leichtes Leben. Heute ist der Ausschluss aus einer Gemeinschaft weniger dramatisch und auch durch Gesetze gut geregelt: Der Arbeitsvertrag kann, je nach rechtlichen Grundlagen, von beiden Seiten beendet wer[24]den, damit erlischt die offizielle Zugehörigkeit zur Organisation. Auch wenn es sich manchmal anders anfühlt: Dieser Entzug der Zugehörigkeit durch Kündigung dient in Organisationen weniger der Bestrafung, als vielmehr dazu, die Funktionalität der Organisation aufrechtzuerhalten. Sie braucht bestimmte Kompetenzen an Bord, und so ist die Entscheidung wesentlich, wer mit welchen Fähigkeiten und Fertigkeiten eine Mitgliedschaft erhält und wer nicht. Ändern sich die Anforderungen, ändert sich auch der Bedarf an Kompetenzen innerhalb der Organisation.
Die Mitgliedschaft ist an die Erfüllung von Leistung und das Einhalten von Bedingungen gebunden. Innerhalb einer Organisation ist man nicht frei zu tun, was man will, sondern muss tun, was wichtig und wesentlich für die Organisation ist. »Nur wer die Regeln der Organisation anerkennt, kann überhaupt in die Organisation eintreten. Wer sie nicht mehr befolgen will, muss austreten«, bringt es Luhmann auf den Punkt (Luhmann 2005a, S. 50). Die Organisation hat »formale Erwartungen« an die Mitglieder, sie stellt Bedingungen und verlangt Anpassung. Das klingt so, als wäre die Organisation so mächtig und könnte sich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach aussuchen und bestimmen, wie lange sie bleiben. Doch in Zeiten eines »War for Talents« und Fachkräftemangels hat die Organisation das Schicksal ihrer Beschäftigten beileibe nicht allein in der Hand. Die Kündigung einer Schlüsselkraft kann den Verlust von wichtigem Know-how bedeuten, das schwer zu ersetzen ist. Da müssen Organisationen schon einiges bieten, damit ihre Mitglieder ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen.
Die Mitgliedschaft innerhalb der Organisation hat ihren Preis für die Menschen und auch die Organisation, und sie ist Veränderungen unterworfen. Verlangt der Markt eine stärkere agile Ausrichtung, sind plötzlich andere Skills gefragt, die sich nur zum Teil intern aufbauen lassen und deshalb von außen zugekauft werden müssen. Die Mitgliedschaft in einer Organisation ist also keineswegs eine sichere Sache, sondern für beide Seiten veränderbar.
Organisationen historisch betrachtet
Für das bessere Verständnis der Beziehung zwischen den beiden Teilen Mensch und Organisation wollen wir einen kurzen Blick in den Rückspiegel werfen. Schaut man auf die Entstehungsgeschichte von Organisationen, dann ergeben sich zwei Perspektiven: Die eine Perspektive lässt ziemlich weit zurückblicken. Eine gemeinsame Organisation war es noch nicht, vielmehr ging es darum, sich gemeinsam zu organisieren. Begonnen hat dieses Sich-gemeinsam-Organisieren wohl schon mit der gemeinsamen Jagd. Da allerdings in sehr kleinen Stämmen. Die Menschen waren zentraler Dreh- und Angelpunkt des gemeinsamen Organisierens. Erst mit der Sesshaftigkeit stieg der Bedarf, ein größeres System zu organisieren. Aus den kleinen Jagdgemeinschaften wurden Dörfer, die gemeinsam Landwirtschaft betrieben. Die dörfliche Ansammlung von Menschen wuchs, [25]und es bedurfte immer weiterer Steuerungs- und Verteilungsmöglichkeiten. Führung spielte plötzlich eine große Rolle. Es war nicht mehr nur die charismatischen Führungsperson gefragt, sondern auch die Funktion von Führung. Den Platz, den man innerhalb dieser ersten Organisationen einnehmen konnte, war eng mit dem Geburtsstand verknüpft. Herkunft und Stand bestimmten die mögliche Position, im Dorf, beim Besitz und in Kirche und Militär (vgl. Heintel/Krainz 2015, S. 57).
»Wo immer Menschen eine gemeinsame Geschichte durchleben, müssen sie ihr Verhalten koordinieren. Wenn zwei Menschen durch die gleiche Tür wollen, müssen sie sich einigen, wer zuerst geht, falls nicht beide gleichzeitig hindurch passen.« (Simon 2007). Das Beispiel beschreibt eine koordinierte Interaktion, ist allerdings nicht mit Organisation gleichzusetzen.
Organisationen auf dem Weg in die Moderne
Die zweite Perspektive wirft einen Blick auf Organisationen, wie wir sie heute kennen. In dieser Form existieren sie noch nicht lange. Die Industrialisierung hat für ihre Entstehung wichtige Weichen gestellt. Arbeit wurde durch das Fließband neu organisiert. Der Entwicklungsbogen spannt sich hier von der Manufaktur über das Industriezeitalter hin zur Netzwerkökonomie. Bis zum 19. Jahrhundert wurden viele Produkte in Manufakturen erzeugt. Vieles war lokal organisiert, Erzeugung und Absatz erfolgten oft in nicht allzu großer räumlicher Distanz. Durch die Entwicklungen des Industriezeitalters wurden die Reichweiten größer, und der Einsatz von menschlicher Arbeitskraft wurde neu definiert. Frederik Taylor lieferte das theoretische Hintergrundwissen zu dieser Epoche. Die Arbeitsprozesse wurden funktional und hierarchisch geregelt. Die Arbeit in tayloristischen Organisationen war durch Spezialisierung, Standardisierung und Formalisierung gekennzeichnet.
Was bedeutete diese Entwicklung nun für den Menschen, der in diesen Organisationen arbeiteten? Die Arbeitskräfte wurden für das System »austauschbar«, die Zuständigkeiten fest geregelt, die Privatsphäre von der Arbeitssphäre getrennt. Mitdenken und Kreativität waren hier schädlich. Die Menschen in den Betrieben sollten wie Maschinen funktionieren. Das bekannte Zitat von Henry Ford bringt es auf den Punkt: »Ich wollte Hände und bekam Menschen!«
Alles basierte auf verlässlichen und skalierbaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. In derartigen Konstellationen spielten Autonomie und Selbstverantwortung keine Rolle. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter »unbotmäßig« reagierten, gab es Druck »von oben« (Geramanis/Hutmacher 2020, S. 231 ff.).
Die Humanisierung der Arbeitswelt war eine Bewegung, die aus den Folgen der tayloristisch geprägten Arbeitsorganisation entstand. Nachdem die Arbeitsbedingungen [26]durch verschärfte Rationalisierung und Intensivierung immer schlechter wurden und die sich daraus ergebenden gesundheitlichen Belastungen und Gefährdungen immer deutlicher wurden, gewann die Verbesserung der physischen, psychischen und sozialen Arbeitsbedingungen an Bedeutung. Der Mensch sollte nicht nur für ökonomische Zwecke eingesetzt werden, sondern seine menschlichen Eigenschaften möglichst vielfältig einbringen (vgl. Geramanis/Hutmacher 2020, S. 234).
Organisationen heute
Nun sind wir in einer neuen Phase angelangt, in der Globalisierung und Digitalisierung flexiblere Organisationsformen fordern, bei denen der Ablauf stärker in den Blick genommen wird als der Aufbau. Prozesse werden wichtiger als die Hierarchie. Die räumliche und zeitliche Begrenzung für Unternehmen fiel in den letzten Jahrzehnten ganz, sie spannen sich nun über den gesamten Globus (vgl. Oestereich/Schröder 2017, S. 4).
Die Coronakrise hat diese Entwicklung nochmals beschleunigt, wobei die langfristigen Folgen noch nicht abschätzbar sind. Auf jeden Fall hat die Digitalisierung der Arbeitswelt einen weiteren Entwicklungsschritt erfahren. Die Möglichkeiten des grenzüberschreitenden, verteilten Arbeitens und die Notwendigkeit digitalisierter Prozesse wurden umso deutlicher. Die Grenzen zwischen Arbeitsplatz und privater Lebenswelt verschwimmen mittlerweile – nicht zuletzt aufgrund der technischen Möglichkeiten. Viele Expertinnen und Experten gehen von einer weltweiten wirtschaftlichen Wende aus.
Was wollen Organisationen jetzt von Menschen? Einfach nur Hände sind es nicht, vielmehr gewinnen spezifische menschliche Potenziale wie Kreativität, Eigeninitiative und die Fähigkeit zur Selbstorganisation an Bedeutung. Die Intelligenz des Handelns lässt sich nicht mehr allein in bürokratischer Planung verorten. Insbesondere hochqualifizierte Arbeit in flexiblen, innovativen Kontexten ist zunehmend an menschliches Arbeitsvermögen gebunden. Es stellt sich somit die Frage, ob es aufgrund dieser Entwicklungen auch zu einem neuartigen Bündnis zwischen Mensch und Organisation kommen muss (vgl. Geramanis/Hutmacher 2020, S. 232).
Organisationen haben also ein Interesse daran, die passenden Mitglieder zu gewinnen und zu halten. Größere Organisationen schaffen dafür sogar eigene Abteilungen, die für Recruiting und Mitarbeiterbindung zuständig sind – so wesentlich ist dieser Aspekt für den Erfolg der Organisation.
Ein unterschiedliches Verständnis von Ganzheit
Folgen wir den Anforderungen der New-Work-Bewegung mit der Frage, wie die Menschen sich mit ihrer Ganzheit einbringen können, finden wir jetzt schon erste Antworten. Es mag hart klingen, aber Organisationen haben per se kein Interesse an menschlicher [27]





























