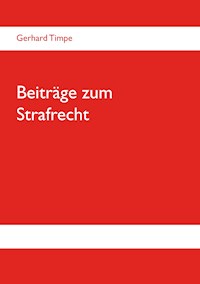
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Strafrechtliche Zurechnung folgt nicht den Gesetzen der Natur, sondern verbindet ein deliktisches Geschehen mit einer Person nach gesellschaftlichen Regeln. Der Vorsatz ist deshalb kein psychisches Faktum, sondern ein eigenständiger normativer Zusammenhang, und ein Verbotsirrtum nur dann vermeidbar, wenn er Ausdruck mangelnder Rechtstreue des Irrenden ist. Auf einen auch nur "leisen" Unrechtszweifel kommt es also nicht an. Auch in der Beteiligungslehre ist die Verbindung von Person und Delikt nicht gegenständlich-faktisch zu verstehen, sondern normativ als Zuständigkeit des Beteiligten für ein Geschehen, das er durch ein deliktisch befangenes Verhalten ermöglicht oder gefördert hat. Bei der Nötigung steht schließlich nicht die Freiheit als der Person natürlich gegebener Besitz im Zentrum der Interpretation von Gewalt und Drohung, sondern die Aufgabe der Freiheit in einer Gesellschaft der gegenwärtigen Gestalt. Die Nötigung schützt das allgemeine Interesse an der Bewahrung der Bestandsbedingungen einer Gesellschaft, die hochgradig anonyme Sozialkontakte ermöglichen muss, und nur dadurch vermittelt die Freiheit der Person.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
S
ELBSTORGANISATION
D
IE
A
BERRATIO ICTUS
A. Vorbemerkung
.
B. Vorsatz und Wissen
C. Vorsatzabweichungen
.
1. Error in persona vel obiecto
2. Aberratio ictus
3. Schlussbemerkung
㤠17
IST ZU HART“
– I
ST
§
17 ZU HART?
A. Vorbemerkung
.
B. Die „Pflichtverletzungslehre“
C. Der „Unrechtszweifel“ als Kennzeichen der Vermeidbarkeit eines Verbotsirrtums
D. Rechtsunkenntnis als Ausdruck mangelnder Normbefolgungsbereitschaft
1. Der vermeidbare Verbotsirrtum
2. Der unvermeidbare Verbotsirrtum
E. Schlussbemerkung
D
ER
T
ATBESTAND DER
B
EIHILFE
A. Hilfeleisten
1. Die Förderungsformel der Rechtsprechung
2. Teilnehmerdelikt
3. Die Kausalitätslehren
4. Organisatorisch-normative Gemeinsamkeit
B. Psychische Beihilfe
C. Subjektiver Tatbestand
.
M
ITTELBARE
T
ÄTERSCHAFT BEJ
S
ELBSTSCHÄDIGUNG
I. Einleitung
II. Täterlehren
A. Die Rechtsprechung
.
B. Das Verantwortungsprinzip
III. Zuständigkeit für einen Defekt
A. Paternalistische Zuständigkeit
B. (Quasi-)vorsatzlos handelndes Werkzeug
C. (Quasi-)gerechtfertigtes Werkzeug
IV. Zuständigkeit für das Verhalten
.
B
EMERKUNGEN ZUR
M
ITTÄTERSCHAFT
(§ 25
II
S
T
GB)
A Konzepte der Verhaltenszurechnung bei der Mittäterschaft
I. Funktionelle Tatherrschaft
II. Mittäterschaft als Problem des Besonderen Teils
III. Die Unrechtsvereinbarung
IV. Organisatorisch-normative Gemeinsamkeit
B. Gemeinsame Tatbegehung
.
C. Gemeinsamer Tatentschluss
.
1. Finale und funktionelle Tatherrschaft
2. Einpassungsentschluss ausreichend?
I
ST DIE
N
ÖTIGUNG EIN
D
ELIKT GEGEN DIE
F
REIHEIT?
A. Die Aufgabe der Freiheit
B. Gewalt als Verfälschung der Zurechnung
C. Drohung als Komplementärbegrif zur Gewalt
D. Das abgenötigte Verhalten
E. Verwerflichkeit
F. Nötigungsabsicht erforderlich?
.
Selbstorganisation
Die neuere funktionale Strafrechtsdogmatik stellt nicht die verhaltenssteuernde, sondern die erwartenssichernde Funktion des Rechts in den Mittelpunkt. „Ein funktionales Strafrechtssystem lässt sich ... nicht mit der verhaltenssteuernden, sondern nur mit der erwatungssichernden Funktion des Rechts koordinieren“, denn für eine „Verhaltenssteuerung“ komme es „immer schon zu spät“1. Daran ist richtig, dass Individuen strukturdeterminiert2 sind, also Systeme, deren Struktur ihr Verhalten bestimmt und nicht ihre Umwelt. Umweltreize können sie zwar zum Operieren nach ihren Prinzipien anregen, aber nicht determinieren. Recht ist deshalb konnotativ und nicht denotativ, also ein System von Sätzen zur Koordinierung des Verhaltens interagierender Individuen, aber nicht zur Steuerung ihres Verhaltens. Da es sich bei den interagierenden Individuen nicht um triviale Systeme handelt, die ihre Umwelt stereotyp nach einem vorgegebenen Schema ordnen, sondern um Systeme, bei denen ihr früheres Verhalten ihr späteres Verhalten mit bestimmt, sind sie geschichtsabhängig und deshalb unvorhersagbar, weil eine einmal beobachtete Reaktion auf einen bestimmten Reiz zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr auftreten muss. Strukturdeterminierte Systeme können lernen. Damit wird aber die Etablierung verhaltenskoordinierender Regeln zum Problem, weil stabile Interaktionen die Anschlussfähigkeit des Verhaltens der Beteiligten voraussetzen, an der es bei strukturdeterminierten Systemen aber gerade fehlt, weil interne Zustandsänderungen in Abhängigkeit von einem vorangegangenen Verhalten zu nicht vorhersagbaren Verhaltensänderungen führen können, aus der Beobachtung der Input- Output-Beziehung also nicht auf die Funktionsweise des Systems geschlossen werden kann. Der Verweis darauf, dass „gesellschaftliche Systeme ... objektive, generalisierte und kontrafaktisch stabilisierte Erwartungen (institutionalisieren), an denen man sich orientieren, nach denen man sich richten kann“3, bezeichnet deshalb zwar das Problem, bietet aber keine Lösung, weil die Etablierung „gesellschaftlicher Systeme“ ihrerseits koordiniertes Verhalten voraussetzt, also ohne Regelorientierung nicht möglich ist; denn in einem regellosen Zustand muss jedermann „jederzeit mit jedem beliebigen Verhalten anderer“4 rechnen. Regelorientierung wird im funktionalen Strafrechtssystem als „Grundbedingung sozialer Koexistenz (und darin eingeschlossen: menschlicher Personalität)“5 zwar vorausgesetzt, aber die Genese der Regeln nicht erklärt. Eine Erklärung für die Etablierung verhaltenskoordinierender Regeln ergibt sich aus einer Besonderheit der Kommunikation strukturdeterminierter Systeme, ihrer Rekursivität. Strukturdeterminierte Systeme sind operativ geschlossen, autonom und selbstreferentiell, interagieren also rekursiv mit ihren eigenen internen Zuständen, aber nicht mit ihrer Umwelt, weil es wegen ihrer operativen Geschlossenheit keine semantischen Beziehungen zwischen System und Umwelt gibt, sondern nur energetische. Interagieren strukturdeterminierte Systeme aber rekursiv mit ihren eigenen inneren Zuständen, ist also der Output einer Interaktion der Input einer folgenden Interaktion und der Output dieser Interaktion wiederum der Input einer weiteren Interaktion und so weiter ohne Ende, entstehen als Resultat dieser rekursiven Operationen stabile Zustände, weil die Zustandsänderungen des rekursiv mit seinen internen Zuständen interagierenden Systems in Richtung auf bestimmte (Eigen-) Werte konvergieren6, die für andere Systeme anschlussfähig sind. Ebenso wie Individuen, erschafen auch soziale Systeme ihre Welt, indem sie sich selbst organisieren, weil die rekursive Interaktion eines strukturdeterminierter Systems mit seinen Input- und Outputzuständen der Interaktion mehrerer strukturdeterminierter Systeme entspricht. Ist der Output des einen Systems der Input für die Operationen des zweiten Systems und der Output dieses Systems wiederum der Input für die Operationen des ersten Systems und so weiter ohne Ende, entstehen operational geschlossene (Interaktions-)Systeme, die (trotz unbegrenzter Plastizität des Handelns) als (Eigen-)Werte stabile und vorhersagbare Zustände hervorbringen7, die dann zu generalisierten Verhaltenserwartungen werden, wenn es den interagierenden Systemen gelingt, Strategien für den Umgang mit Enttäuschungen zu entwickeln. Da Gesellschaft Kommunikation ist und jede Kommunikation rekursiv, ist Bedeutung keine ihr vorgegebene Eigenschaft der Natur, sondern entsteht erst im System als Ergebnis seiner (rekursiven) Operationen. Bedeutung ist in sozialen Systemen kein bloßes Derivat psychischer Fakten, kann also nicht mit dem Sinn gleichgesetzt werden, den die interagierenden Individuen ihrem Verhalten geben8, sondern eine gesellschaftliche Konstruktion. Psychische Fakten haben für sich genommen keine Bedeutung – sie sind, was sie sind9.
1 Lesch Der Verbrechensbegriff (1999), S. 187; vgl. auch ders. Schiller FS (2014), 448 ff., 465 ff.
2 Maturana Biologie der Realität (2000), S. 11 ff., 102 ff.; Maturana/Varela Autopoiesis and Cognition (1980), S. 46, 78 ff.
3 Lesch Der Verbrechensbegriff (1999), 187.
4 Lesch Der Verbrechensbegriff (1999), 187.
5 Lesch Der Verbrechensbegriff (1999), 187.
6 Vgl. dazu v. Förster Understanding Understanding (2003), S. 305 ff.
7 Jakobs Norm, Person, Gesellschaft, 3. Aufl. (2008), S. 31, setzt nicht auf Selbstorganisation, sondern auf Gewalt: „(D)er Gewalthaber (muss) versuchen, die Individuen mit ihren je eigenen Schemata so zu ordnen, was heißt, mit, nebenund gegeneinander aufzustellen, dass eine Förderung der Gruppe herausspringt.“
8 Anders Armin Kaufmann Welzel FS (1974), 393 ff., 403, der meint, dass „in konsequenter Durchführung des personalen Unrechtskonzepts … allein der Sinn, den der Täter im Tatvorsatz seiner Tat gibt, das Wertungssubstrat des Normwidrigkeitsurteils“ sei.
9 Vgl. zum Verlust der Sinnhaftigkeit der Welt, „die (nach ihrer Entzauberung) ein schlichtes Dasein ist und deshalb durch menschliches Verhalten veränderbar wird“, Cancio Melia Wolter FS (2013), 293 ff., 309; Jakobs Das Schuldprinzip (1993), S. 10 ff.
Die Aberratio ictus
A. Vorbemerkung
In der Nikomachischen Ethik unterscheidet Aristoteles zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit und versteht unter vorsätzlichem Handeln freiwilliges Handeln: Freiwillig sei „eine Handlung, die zu verrichten bei ihrem Urheber steht, und die man mit Wissen verrichtet, ohne aber bezüglich der Person, der sie gilt, … in einem Irrtum befangen zu sein“10. „Als unfreiwillig (und deshalb fahrlässig) gilt, was … aus Unwissenheit geschieht“11. Nur das, „was freiwillig geschieht“, sei für „Lob und Tadel“ ofen, „während das Unfreiwillige Nachsicht und manchmal Mitgefühl findet“12. Verdient der Fahrlässige aber „Nachsicht“ und „Mitgefühl“, „dokumentiert“ sein Verhalten keine „Entscheidung gegen den Rechtswert“13, verweist also nicht auf einen Mangel an Rechtsreue, sondern ist Folge seiner Unaufmerksamkeit oder seines Ungeschicks bei der Gestaltung der Welt. Fahrlässigkeit kann milder bestraft werden14 als Vorsatz, weil sich die Normen zweckrationalen Umgangs mit der Welt auch ohne strafrechtlichen Nachdruck selbst stabilisieren. Denn unsorgfältiges Verhalten wirkt in eine vorab nicht bestimmbare Richtung, eventuell also auch gegen den Täter selbst, der sich der Gefahr einer poena naturalis aussetzt15. Ein Kraftfahrer, der z. B. sieht, dass es schneit, aber nicht bedenkt, dass die Straßen deshalb glatt sein werden, und mit einem anderen Kraftfahrer kollidiert, weil er seine Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen angepasst hat, verletzt nicht nur den anderen Kraftfahrer, sondern wird regelmäßig auch selbst nicht ungeschoren davonkommen Die Unsorgfalt des Kraftfahrers ofenbart einen Mangel an Kompetenz zur Selbstverwaltung, wirkt also nicht vorbildhaft, weil sich jedermann schon im Eigeninteresse darum bemühen wird, unsorgfältiges Verhalten zu vermeiden.
B. Vorsatz und Wissen
Neben dem Vorsatz und der Fahrlässigkeit kennt Aristoteles noch eine dritte Schuldform, die er zwischen die „Freiwilligkeit“ und die „Unfreiwilligkeit“ stellt und „Nichtfreiwilligkeit“16 nennt, weil bei ihr der Grund der Unkenntnis das Desinteresse des Täters an den Folgen seines Verhaltens ist. Diese dritte Schuldform unterscheidet sich von der „Freiwilligkeit“ dadurch, dass der Täter die tatbestandlichen Folgen seines Verhaltens nicht bedenkt, und von der „Unfreiwilligkeit“ dadurch, dass „sich danach (weder) Mißbehagen (noch) Bedauern einstellt“17, weil „Kenntnis für den Täter keine entscheidungserheblichen Daten brächte“18 und er seinen Kenntnismangel deshalb nicht negativ bewertet19. Unkenntnis, die nicht zur „Unfreiwilligkeit“ führt, steht dem Vorsatz gleich, weil das Recht sich selbst zur Disposition stellen würde, wenn es diejenigen, die sich vom Recht abgewandt haben, die Gleichgültigen und die Tatsachenblinden, dann entlasten würde, wenn ihre Rechtsuntreue in einem Kenntnismangel Ausdruck gefunden hat. Diese Selbstrelativierung der Ordnung wäre aber mit ihrer Normativität nicht vereinbar.
Um die Selbstrelativierung der Ordnung zu vermeiden, wird heute überwiegend angenommen, dass der Begrif des Vorsatzes sich nach der „Funktion (richte, die ihm) bei der subjektiven Zurechnung zukommt“20, und die Feststellung des Vorsatzes deshalb einen „normativen Bewertungsmaßstab“21 voraussetze. Bei der Normativierung des Vorsatzes soll aber keine Surrogation aktuell-psychischen Erlebens durch Gleichgültigkeit oder Tatsachenblindheit stattfinden, weil der Täter sich nur dann für die Rechtsgutsverletzung entscheide22, wenn er die Folgen seines Verhaltens kenne. Denn der Vorsatz könne seine „Funktion“, eine „hervorgehobene Art der Verantwortlichkeit“23 zu kennzeichnen, nur dann erfüllen könne, wenn der Täter einen Sachverhalt kenne, „der (in ihm) den Impuls auslösen kann, sein Verhalten zu unterlassen“24. Der Begrif der „Entscheidung“ fügt demjenigen der Kenntnis aber dann nichts hinzu, wenn das Handeln in „Kenntnis der Folgen die Entscheidung“ ist25, derjenige, der „alle schädigenden Umstände kennt und gleichwohl handelt (also) mit der Behauptung, dies entspreche nicht seiner Entscheidung, nicht gehört“ wird26. Als Grund der Vorsatzzurechnung bleibt damit nur die Folgenkenntnis, so dass gegenüber dem von Feuerbach27 überkommenen psychologisierenden Verständnis des Vorsatzes wenig gewonnen ist.
An einer psychologisierenden, auf aktuelle Folgenkenntnis abstellenden Deutung des Vorsatzes ist zwar richtig, dass derjenige, der seine Pflichten nicht nur zufällig erfüllen will, wissen muss, was der Fall ist. Wer z. B. in einer Scheune ein ofenes Feuer entzünden, das Niederbrennen der Scheune aber vermeiden will, muss nicht nur wissen, dass er sich in einer Scheune befindet und wie er ein Feuer legen kann, sondern auch, dass die Scheune aus brennbarem Material errichtet wurde, dass der Funkenflug eines ofenen Feuers das Baumaterial der Scheune in Brand setzen kann und was „Brandstiften“ in der gegenwärtigen Gesellschaft bedeute, also z. B. das Inbrandsetzen von Teilen des Dachstuhls, aber nicht die flehentliche Bitte an irgendwelche Heilige, die Scheune niederzubrennen28. Dieses Wissen reicht allein aber nicht aus, um ein Niederbrennen der Scheune zu vermeiden, sondern hinzukommen müssen elementare Kenntnisse der Mathematik, der Logik und der Naturgesetze, weil nur derjenige in der Lage ist, ein Feuer zu entfachen und den Funkenflug des Feuers zu kontrollieren, der dieses Wissen besitzt. Um das Niederbrennen der Scheune zu vermeiden, muss zum Wissen um den zweckrationalen Umgang mit der Welt aber noch hinzukommen, dass er auch dominant dazu motiviert ist, seine Pflichten zu erfüllen; er muss die Gutsverletzung also auch vermeiden wollen29. Wissen und Wollen sind deshalb zwar in dem Sinn äquivalent, dass sie notwendige Bedingungen der Normbefolgung sind. Das Recht behandelt kognitive Leistungsdefizite (Wissensfehler) aber trotzdem anders als voluntative. Während Wissensfehler regelmäßig entlasten (§ 16), ist mangelnde Rechtstreue kein Milderungsgrund, sondern belastet in dem Maß, in dem sich der Täter vom Recht entfernt hat. Weiß er zwar, was der Fall ist, vermeidet die Gutsverletzung aber trotzdem nicht, so ist seine Schuld nicht deshalb größer als die eines Fahrlässigkeitstäters in gleicher Lage, weil es ihm leichter gefallen wäre, die Tat zu vermeiden, als dem Fahrlässigen30, sondern sie ist der Ausdruck „höchster Schuld“31, weil maßgeblicher Grund der Tatbestandsverwirklichung ein Wertungsfehler und kein Wissensfehler ist. Wertungsfehler belasten, weil das Recht in einer „nicht beweisbaren und in diesem Sinn unvollkommenen Ordnung“32 nicht beweisen kann, dass seine Befolgung stets vorzugswürdig ist und es deshalb jedem einzelnen als von ihm zu verantwortende Aufgabe zuschreiben muss, für ausreichende Normbefolgungsbereitschaft zu sorgen. Das Recht konstituiert die Person also nach seinen Funktionsbedingungen als ein System, das zwar für ihr rechtliches Wollen, aber nicht für ihr Wissen33 zuständig ist. Der Grund der Zurechnung der Verhaltensfolgen zum Vorsatz ist deshalb nicht, dass der Täter in Kenntnis der Folgen gehandelt hat, sondern ein durch Folgenkenntnis indizierter Wertungsfehler34. Der Täter hat die Rechtstreue nicht aufgebracht, die von ihm als Person im Recht rollenübergreifend erwartet wird, damit eine Gesellschaft, die ihre Bürger als frei darstellt, zugleich aber hochgradig anonyme Sozialkontakte ermöglichen muss, verwaltbar bleibt35. Zur Folgenkenntnis als Indiz mangelnder Rechtstreue gibt es aber Surrogate, weil auch Gleichgültigkeit und Tatsachenblindheit eine Interpretation des Verhältnisses zu anderen Personen ist, nämlich ihre Abwertung36, und der Täter deshalb auch ohne Kenntnis37 der Folgen seines Verhaltens „dokumentieren“ kann, dass „ihn fremde Interessen nicht interessieren“38. Auch für Gleichgültige und Tatsachenblinde sind die Handlungsfolgen zum Tatzeitpunkt akzeptabel, also nicht bedenkenswert39, weil sie gelernt40 haben, sich so zu verhalten dass sie nicht in die Gefahr einer poena naturalis geraten. Denn hat der Täter die Risikostandards einer Gesellschaft der gegenwärtigen Gestalt nur selektiv zur Kenntnis genommen, also nur insoweit, als ihre Einhaltung ihm nutzt, können die Folgen seines Verhaltens nur in dem Bereich eintreten, dessen Entwicklung ihn nicht interessiert41. Das nicht Bedachte ist dann nicht entscheidungserheblich, weil der Täter auch gehandelt hätte, wenn er die Folgen gekannt hätte.
Besteht die „Funktion“42 des Vorsatzes im System der subjektiven Zurechnung also darin, denjenigen ihre Tat verschärft zuzurechen, die die Rechtstreue nicht aufgebracht haben, die von ihnen in allen ihren Rollen erwartet wird, um gesellschaftstauglich zu sein, kann der Vorsatz keine dem Recht vorgegebenen individualpsychologischen Fakten bezeichnen, sondern muss als eigenständiger normativer Zusammenhang verstanden werden. Gegenstand der Normativierung kann dabei einmal die intellektuelle Seite des Vorsatzes sein, aber auch die voluntative, oder sowohl die intellektuelle als auch die voluntative Seite43. Puppe44 versteht die intellektuelle Seite des Vorsatzes normativ. Nach der von ihr entwickelten Lehre von der „Vorsatzgefahr“ soll vorsätzlich handeln, wer die „qualifizierte Gefahr“45 des Erfolgseintritts schaft. Eine „Vorsatzgefahr“ sei eine „taugliche Methode zur Herbeiführung des Erfolges“46, also eine Gefahr, „die ein vernünftiger Täter nur dann setzen würde, wenn er sich mit dem Eintritt des Erfolges abfindet, ihn sich zu eigen macht“47. Das Setzen einer „Vorsatzgefahr“ sei daher „Ausdruck … tiefster Gleichgültigkeit gegenüber dem fremden Rechtsgut, (das) den schwersten … Schuldvorwurf verdient“48. Die „tiefste Gleichgültigkeit“ des Täters ist aber kein Surrogat für sein Wissen, sondern zur Gleichgültigkeit muss hinzukommen, dass der „Täter … sich bewusst (sei), dass überhaupt eine Gefahr der Tatbestandsverwirklichung besteht“49. Damit entscheidet aber nicht mehr das Recht darüber, ob dem Täter die Tatbestandsverwirklichung zum Vorsatz zugerechnet wird, sondern der Täter50, der sich dem Recht aus Gleichgültigkeit verweigert51, ein axiologisch zumindest befremdliches Ergebnis.
Axiologische Unstimmigkeiten dieser Art lassen sich nur vermeiden, wenn in Abhängigkeit von der gesellschaftlichen Funktion strafrechtlicher Zurechnung darüber entschieden wird, ob das Recht sich ohne Schaden für die Normgeltung auf die psychische Befindlichkeit des Täters einlassen kann, oder ob dem Täter die Folgen seines Verhaltens trotz seines Wissensmangels zum Vorsatz zugerechnet werden müssen, weil anderenfalls für den Erhalt der normativen Struktur der Gesellschaft erforderliche Zurechnung verloren ginge. Der insbesondere von Roxin52 und Schünemann53 vertretene „volitive Normativismus“ meint deshalb, dass das „erkannte Ausmaß der Gefahr“54 nicht die einzige „Beurteilungsgrundlage“55 sei, sondern „Beurteilungsgrundlage“ sei der „gesamte Geschehensablauf“56. Die zur Bezeichnung der voluntativen Komponente des Vorsatzes verwendeten Formeln (Ernstnehmen, Billigen, Sichabfinden) seien „keine exakt beschreibbaren Bewusstseinsphänomene, sondern … verkappte Bewertungen eines Gesamtsachverhalts“57 und der Vorsatz daher ein „Typusbegrif“, der „sowohl subjektive als auch objektive Merkmale vereint“58. Demgemäß sei zu fragen, „ob bei Würdigung aller Umstände des Einzelfalls das Täterverhalten so gedeutet werden kann, dass der Handelnde sich … gegen das geschützte Rechtsgut entschieden hat“59. Das Vorhandensein einer „Entscheidung für (eine Gutsverletzung) wird also aus der Gesamtsituation mit all ihren äußeren und inneren Umständen und nicht aus Reflexionen des Täters erschlossen, die er wahrscheinlich gar nicht angestellt hat“60: Das Erfordernis präsenter Folgenkenntnis61, das auch der „volitive Normativismus“ nicht preisgibt, konterkariert bei Gleichgültigkeit und Tatsachenblindheit aber die generalpräventiv62 erforderliche Bemessung der Strafe, so dass die Legitimation der Strafe selbst in Gefahr gerät, „weil konterkarierte Zwecke keine mehr sind“63. Eine Begrifsbestimmung des Vorsatzes, die sich an psychischen Fakten und nicht am Strafzweck orientiert, ist „sinnlos“64, weil sie keinen „normativen Maßstab und Bezugspunkt hat“65, also allenfalls zufällig zweckvoll wirken kann. Geht es bei der Zurechnung zum Vorsatz „um eine Interpretation des Tatverhaltens als Hinnahme des Erfolgs“66 nach einem „normativen Maßstab, der im Falle evidentermaßen höchster Schuld zur Bejahung vorsätzlichen Handelns führt“67, ist für die Feststellung des Vorsatzes das Maß der Schuld entscheidend und nicht das zufällige Vorhandensein eines psychischen Faktums, der Folgenkenntnis, weil es „höchste Schuld“68 auch ohne diese Kenntnis geben kann. Folgenkenntnis gehört also nicht zum Begrif des Vorsatzes, sondern ist nur ein Indiz dafür, dass rechtlich maßgeblicher Grund des Konflikts ein Wertungsfehler ist.
Der „volitive Normativismus“ verkennt, dass die subjektive Zurechnung keine individualisierende, sondern eine „personale Zurechnung“69 ist und eine Tat deshalb dann vorsätzlich begangen wurde, wenn der Täter für seinen Kenntnismangel zuständig ist, weil die Tatbestandsverwirklichung nicht Ausdruck seiner Inkompetenz zur Selbstverwaltung ist, wie bei der ungerichteten Fahrlässigkeit, sondern auf einem Wertungsfehler beruht, eben auf Gleichgültigkeit oder Tatsachenblindheit. Da Folgenkenntnis nur ein Indiz für objektiv fehlende Rechtstreue ist und es zur Folgenkenntnis Surrogate gibt, ist der Vorsatz zwar eine hervorgehobene Schuldform, aber kein besonderer Bewusstseinszustand70. Die Zurechnung zum Vorsatz setzt deshalb nicht voraus, dass der Täter die Folgen seines Verhaltens gekannt hat, sondern es muss nachgewiesen werden, dass die Quelle seines Kenntnismangels ein Wertungsfehler ist71. Hat der Täter aber falsch gewertet, wird die Rollentrennung durchbrochen und dem Täter seine Tat in dem Sinn verschärft zugerechnet werden, dass er durch die Erklärung des Konflikts als Ausdruck mangelnder Rechtstreue „nicht nur in einem gesellschaftlichen Sektor (desavouiert wird), sondern rundum“72, weil er vor den Anforderungen versagt hat, die er rollenübergreifend erfüllen muss, um gesellschaftstauglich zu sein. Die „subjektive Tatseite“ ist also „nichts (anderes) als am Individuum erscheinende objektiv mangelnde Rechtstreue“73.
C. Vorsatzabweichungen
1. Error in persona vel obiecto
Die gesellschaftliche Notwendigkeit, die für die Bewahrung der normativen Struktur der Gesellschaft notwendige Zurechnung zu erhalten, setzt sich auch beim error in persona vel obiecto gegen ein psychologisierendes Verständnis des Vorsatzes durch. Denn individualisiert der Täter das Tatobjekt nicht nach seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gattung, z. B. als „Mensch“, sondern konkret in seiner raumzeitlichen Befindlichkeit als ganz bestimmter Mensch, irrt er sich aber über die Identität des so individualisierten Tatobjekts, ist das „Geschehene“ nicht das „Gewollte“74 und der error in persona vel obiecto deshalb eine Schuldform zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit75. Ebenso wie bei der Fahrlässigkeit sind die Folgen der Tat nicht entscheidungsirrelevant, weil der Identitätsirrtum des Täters seine Nutzenkalkulation durchkreuzt76 und ihn dann sogar eine poena naturalis trift, wenn er z. B. versehentlich seine Ehefrau erschießt, weil er sie in der Dämmerung mit seinem Feind verwechselt hat. Beim error in persona vel obiecto betrachtet der Täter das, was er angerichtet hat, zwar mit „Mißbehagen und Bedauern“77; die Situation des error in persona ver obiecto unterscheidet sich aber dadurch von derjenigen der Fahrlässigkeit, dass zu seinem Wissensfehler ein Wertungsfehler hinzutritt und dieser Wertungsfehler der Grund dafür ist, dem Täter die Folgen seines Verhaltens zum Vorsatz zuzurechnen. Denn die Tat ist trotz des Wissensfehlers des Täters kommunikativ relevanter Ausdruck mangelnder Rechtstreue, also ein Ereignis, das „sich … als verallgemeinerungsfähiges Verhalten“78 vom „Erlaubten abhebt“79 und deshalb anschlussfähig ist, weil der Täter präsent über die „normativ relevante Dimension“80 seines Verhaltens orientiert ist, so dass nicht die Inkompetenz des Täters zur Selbstverwaltung den Verlauf zum Erfolg erklärt, wie bei der Fahrlässigkeit, sondern seine fehlerhafte Wertung. „Indem … der Handelnde ein vernünftiges Wesen ist, so liegt in seiner Handlung, dass sie etwas Allgemeines“81 ist, an das als Sinnausdruck eines formell Vernünftigen angeschlossen werden kann, wenn der Normbruch „allgemeine Existenz haben würde“82. Weiß der Täter, dass er z. B. für einen „Menschen“ eine unerlaubte Gefahr geschafen hat und sein Verhalten deshalb „töten“ bedeutet, verfehlt er aber den Sinn, den er mit seinem Verhalten verbindet, kann die Tatbestandsverwirklichung nicht als kommunikativ irrelevant abgetan werden83, weil der Anlass der Tat, die Vorstellungen, Wünsche und Hofnungen, die der Täter mit seinem Verhalten verbindet, nicht zu den normativ relevanten Eigenschaften seines Verhaltens gehören84. Nur der „Umfang der Gestaltung ist genuin Inhalt des Wollens“85 und bestimmt in „dieser Eigenschaft, ohne emotiv gefärbte Ergänzungen, den Umfang des Vorsatzes“86. Ein Strafrecht, das Rechtstreue garantiert, kann dem Täter das Risiko einer fehlerhaften Individualisierung des Tatobjekts also nicht abnehmen, weil die Tat trotz des Irrtums auf einen Wertungsfehler verweist und die Normgeltung deshalb Schaden nehmen würde, wenn der Täter sich zu seiner Entlastung auf seinen Irrtum berufen könnte.
2. Aberratio ictus
a. Die Gleichwertigkeitstheorie
Während der Täter beim error in persona vel obiecto den Sinn verfehlt, den er mit seinem Verhalten verbindet, „entgleist“87 bei der aberratio ictus der Kausalverlauf, trift also ein anderes als das vom Täter anvisierte Objekt. Nach der insbesondere von Puppe88 vertretenen „Gleichwertigkeitstheorie“ soll die „Konkretisierung des Täterwillens auf ein bestimmtes Objekt … der Zurechnung der Verletzung eines anderen Objekts“ gleicher Gattung zum Vorsatz nicht entgegenstehen89. Die „Konkretisierung (des Vorsatzes) auf ein bestimmtes Objekt (sei) für den Tatbestandsverwirklichungsvorsatz … nicht erforderlich“90, weil mit der Vorstellung des Täters, ein bestimmtes Objekt einer tatbestandsmäßigen Gattung zu verletzen, „logisch“ zwingend die Vorstellung verknüpft sei91, ein Objekt dieser Gattung zu verletzen92. „Gehört das getrofene Objekt tatsächlich dieser Gattung an, so ist seine Verletzung eine Erfüllung dieses (generellen) Tatvorsatzes“93. „Nach der Identität zwischen anvisiertem und getrofenem Objekt wird genauso wenig gefragt wie nach der Richtigkeit sonstiger außertatbestandlicher Vorstellungen und Erwartungen des Täters“94, denn eine „Tätervorstellung, die für den Vorsatz gar nicht erforderlich“ sei95, könne „die Zurechnung des Erfolges zum Vorsatz … nicht einschränken, wenn sie falsch ist“96. „Der Täter will stets das Objekt verletzen, das in den Wirkungsbereich seines Tatmittels geraten wird, also z. B. den Menschen töten, den seine Kugel trift“97. „Die aberratio ictus hat keine Existenzberechtigung als eigenständige Rechtsfigur mit spezifischen Rechtsfolgen. Sie ist ein Fall des error in objecto und daher nach allgemeinen Regeln unbeachtlich“98.
Die „Gleichwertigkeitstheorie“ rechnet dem Täter eines fehlgeschlagenen Versuchs also all das zum Vorsatz zu, was adäquate Folge der Versuchshandlung ist. Nur der auf ein Objekt einer bestimmten Gattung konkretisierte Vorsatz des Täters soll der Zurechnung Grenzen setzen, weil „der Täter auch dann, wenn er das getrofene Opfer gar nicht bemerkt hat“ damit rechnen müsse, dass ein anderes Objekt der gleichen Gattung „in den Wirkungsbereich seines Angrifsmittels geraten kann“99. Ist die „Individualisierung durch den Kausalverlauf“ aber „immer richtig“100, gibt es keinen Grund, für die Zurechnung zum Vorsatz bei der Gattungszugehörigkeit des in den „Wirkungsbereich“ des „Angrifsmittels“ geratenen Objekts stehen zu bleiben. Denn Puppe verkennt, dass sich mit der Vorstellung, einen bestimmten Hund zu töten, „logisch“ zwingend nicht nur die Vorstellung, ein Objekt dieser Gattung zu verletzen, verbindet, sondern „logisch“ ebenso zwingend auch die Vorstellung, ein Objekt der jeweils übergeordneten Gattung zu schädigen. Bezieht sich der „generelle Vorsatz“ des Täters aber „logisch“ zwingend „auf alle möglichen konkreten Erfolge“101 an gattungszugehörigen Tatobjekten102, müsste der Täter also auch dann vorsätzlich handeln, wenn er statt des Hundes den Hundehalter trift103, weil Hund und Hundehalter zur übergeordneten Gattung104 der Individualrechtsgüter gehören. „Diese logische Wahrheit kann nicht durch Tatsachenbehauptungen, insbesondere nicht durch psychologische Argumente widerlegt werden“105. Um das überhaupt Zurechenbare auf Tatobjekte einer bestimmten Gattung begrenzen zu können, reicht als „Mindestinhalt des Vorsatzes“106 deshalb nicht aus, dass der Täter die Gattungszugehörigkeit des tatsächlich getrofenen Tatobjekts kennt, sondern hinzukommen muss zumindest noch, dass „der zum Vorsatz zuzurechnende Sachverhalt den Wünschen und Erwartungen (des Täters insoweit) entspricht“107, als dies erforderlich ist, um das Abstraktionsniveau gerade der Gattung bestimmen zu können, auf das der Täter seinen Vorsatz konkretisiert hat, da anderenfalls alles überhaupt Vorhersehbare zum Vorsatz zuzurechen wäre. Sind die „Absichten und Wünsche“108 des Täters für den Vorsatzinhalt aber nicht irrelevant, sondern werden sie benötigt, um die Konkretisierung des Vorsatzes gerade auf ein Objekt erklären zu können, das zu der Gattung gehört, zu der auch das anvisierte Objekt gehört109, ist gegenüber der „Konkretisierungstheorie“110 wenig gewonnen, weil auch die „Gleichwertigkeitstheorie“ ohne tatbestandlich irrelevante Zusatzindividualisierungen nicht auskommt. In Frage steht also nicht die Notwendigkeit von Vorsatzkonkretisierungen überhaupt, sondern nur ihr Grad. Über den Grad der Vorsatzkonkretisierung lässt sich ohne Willkür aber nicht entscheiden, weil Vorsatzkonkretisierungen stufenlose Kontinua sind111, die keine qualitativen Grenzen kennen, so dass es auf der „Rutschbahn“112 der Vorsatzkonkretisierungen kein Halten gibt: Ein ganz bestimmter Hund, ein Objekt aus der Gattung der Hunde, ein Tier, eine beliebige fremde Sache, irgendein Objekt aus der Gattung höchstpersönlicher oder „personenunabhängiger (Individual-)Rechtsgüter“113, die durch Individualrechtsgüter repräsentierte allgemeine Verhaltensfreiheit, oder reicht sogar die durch den Angrif auf ein bestimmtes Tatobjekt dokumentierte Vorstellung, irgendetwas Böses zu tun, aus, um dem Täter alles, was er vorhersehbar angerichtet hat, zum Vorsatz zuzurechnen? Da Gattungen Hierarchien bilden, kann die „Gleichwertigkeitstheorie“ nicht erklären, dass zwar derjenige nicht wegen vorsätzlicher Verletzung haftet, der unter Bedingungen auf einen Hund schießt, die die Verletzung des danebenstehenden Hundehalters nahelegen, was der Täter aber nicht bedacht hat, wohl aber derjenige, der unter sonst gleichen Bedingungen auf den Hundehalter schießt, aber dessen danebenstehende Ehefrau trift, auch dann wegen vorsätzlicher Vollendung haften zu lassen, wenn er diese Folge nicht bedacht hat, obwohl das getrofene Tatobjekt in beiden Fällen in den „Wirkungsbereich (des) Angrifsmittels“ geraten und in dem Sinn „richtig“ individualisiert worden ist, weil anvisiertes und tatsächlich getrofenes Objekt jeweils zur Gattung der Individualrechtsgüter gehören. Ein weiteres kommt hinzu: Puppe114 geht bei der aberratio ictus von einer „Gesamtgefahr“ aus, unterscheidet also nicht danach, „in welchen Tatsachen die Vorstellung des Täters von der vorsätzlich gesetzten Gefahr mit dem wirklichen Kausalverlauf übereinstimmt“, und „bewertet“ die „so erhaltene vorsätzlich gesetzte Gefahr“ deshalb nicht mehr daraufhin, „ob sie für eine Vorsatzzurechnung genügt“. Dafür „genügt“ die „vorsätzlich gesetzte Gefahr“115 aber dann nicht, wenn der Täter von mehreren Bedingungen des ungewollten Erfolges nur eine kennt, er also z. B. mit einem Gewehr, dessen Zielfernrohr falsch eingestellt ist, auf das Tatobjekt schießt und dadurch nicht nur die Gefahr des gezielten Schießens auf einen ganz bestimmten Menschen schaft, sondern auch die davon verschiedene „allgemeine Gefahr“ des Schießens an „unerlaubten Orten“116.
b. Die echte117 aberratio ictus
Diese Unstimmigkeiten118 kommen nicht von ungefähr, sondern sie sind die Konsequenz aus der Verbindung eines schwachen logischen Arguments mit einem naturalistisch-psychologisierend zugeschnittenen Systems personaler Zurechnung119, das auf dem Missverständnis beruht, dass die Zurechnung zum Vorsatz der psychischen Disposition des Täters folgt und nicht umgekehrt die Konstitution des Täters eine Zuschreibung nach gesellschaftlicher Notwendigkeit ist. Das Recht konstituiert die Person nach seiner Aufgabe, setzt sie also nicht aus den Eigenschaften der psycho-physischen Einheit „Mensch“120 zusammen und entscheidet deshalb „gemäß seiner Funktion, (die Normgeltung zu stabilisieren, was zum Vorsatz gehört, und) nicht der Täter … und auch nicht die Psychologie“121. Handelt es sich bei der Zurechnung zum Vorsatz aber um einen eigenständigen normativen Zusammenhang, muss nicht die Frage beantwortet werden, ob mit der „Vorstellung des Täters, ein bestimmtes Objekt einer tatbestandsmäßigen Gattung zu verletzen, logisch notwendig die Vorstellung verbunden ist, ein Objekt dieser Gattung zu verletzen“122, sondern die anders gelagerte, mit Überlegungen zur psychischen Disposition des Täters nicht entscheidbare Frage, wie weit der „Topos Zurechnung“123 bei der Erklärung von Konflikten reichen muss, damit die Normgeltung nicht erodiert. Unter dieser Perspektive ändert sich also nicht der psychische Befund, sondern der gesellschaftliche Kontext, und mit dem gesellschaftlichen Kontext die objektive Bedeutung des Befunds124: verzeihlich oder belastend?
Nicht nur beim error in persona vel obiecto, sondern auch bei der echten aberratio ictus ist die Akzeptabilität der Folgen im Tatzeitpunkt ungewiss, weil die Abirrung die Nutzenkalkulation des Täters zunichtemachen kann125 und sich der Täter möglicherweise der Gefahr einer poena naturalis aussetzt. Schießt der Täter z. B. mit einer Pistole auf ein fahrendes Auto, verfehlt aber den Fahrer und trift die von der Karosserie abprallende Kugel einen zufällig vorbeikommenden Passanten, können auch die Interessen des Täters in Gefahr geraten, wenn er „nach Abgabe eines gezielten Schusses zu seinem Entsetzen feststellen muss“126, dass er nicht das anvisierte Tatobjekt getrofen hat, sondern eine ihm nahestehende Person, oder dass er vielleicht selbst in den „Wirkungsbereich des Tatmittels“127 geraten ist und er das, was er angerichtet hat, deshalb mit „Mißbehagen und Bedauern“128 betrachtet, weil es Zufall ist, wen der Angrif trift, einen beliebigen Dritten, den Täter selbst oder eine Person, deren Schädigung ihn trift wie der Verlust eigener Güter. Beim error in persona vel obiecto ist der Irrtum des Täters aber von einer anderen Qualität als bei der echten aberratio ictus. Während der präsent über die deliktischen Eigenschaften seines Verhaltens orientierte Täter beim error persona vel obiecto nur den subjektiven Sinn verfehlt, den er mit seinem Verhalten verbindet, organisiert der Täter bei der aberratio ictus auf fehlerhafter Grundlage, weil er z. B. eine defekte Wafe für voll funktionstauglich hält oder weil er sich über die Entfernung zum Ziel irrt und deshalb gelegentlich129 eines fehlgeschlagenen Versuchs das unerlaubte Risiko der Abirrung schaft. Anders als die „Gleichwertigkeitstheorie“ meint, können beide Risiken aber nicht gemeinsam abgerechnet werden, weil bei der echten aberratio ictus zum Wertungsfehler des Täters jedenfalls dann ein Wissensfehler hinzukommt, wenn das von ihm gelegentlich des Versuchs geschafene unerlaubte Risiko der Abirrung für Objekte, die sich „im Streubereich des Tatmittels befinden … keine bloße Verlaufsvariante des gekannten Risikos“130 ist. Kommt zum gesehenen Risiko aber ein weiteres Risiko hinzu, das „nach Art und Maß durch das gesehene Risiko nicht zu bestimmen“ ist131, und ist es deshalb von der „gesehenen Gefahr her Zufall“132, dass sich neben dem anvisierten Objekt ein anders befindet, entspricht die Situation der echten aberratio ictus in ihrer Struktur133 derjenigen des fehlgeschlagenen Versuchs134, zugleich aber auch derjenigen der ungerichteten Fahrlässigkeit135. Tritt zum Wertungsfehler des Täters ein Wissensfehler hinzu, meint der Täter also z. B., dass er die durch den Versuch geschafenen unerlaubten Risiken sicher unter Kontrolle hat, verkennt er dabei aber, dass das von ihm gelegentlich des Versuchs geschafene unerlaubte Risiko der Abirrung136 seiner Kontrolle bereits entglitten ist137, kann ihm die individuelle Sinnlosigkeit seiner Tat demonstriert werden138, weil es Zufall ist, dass er nicht selbst zu Schaden gekommen ist. Urteilt jeder Vernünftige, dass der Täter gescheitert ist, weil er sich nicht um das für die Verwirklichung seiner Pläne erforderliche Wissen bemüht hat, besteht auch deshalb kein Grund, ihm die Folgen seines Verhaltens zum Vorsatz zuzurechnen, weil seine Tat nicht vorbildhaft wirkt, also nicht anschlussfähig ist, weil sie nicht Ausdruck rationaler, verständiger Planung ist, sondern ihr Scheitern auf dem Ungeschick oder der Unachtsamkeit des Täters beruht, der im gültigen Deutungsschema139 punktuell den Überblick verloren hat. Kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter selbst das erste Opfer seiner Tat wird, und ist es deshalb nur dem „Glück“ des Täters zuzuschreiben, dass er noch einmal glimpflich davongekommen ist, geht keine für den Erhalt der normativen Struktur der Gesellschaft erforderliche Zurechnung verloren, wenn er von den Folgen seines Verhaltens distanziert wird, weil sein Ungeschick oder seine Unachtsamkeit den Verlauf zum Erfolg erklären.
c. Die unechte aberratio ictus
Bei der echten aberratio ictus äußert der Täter Falsches, also Unmaßgebliches, über den „Weltlauf“140, aber nicht über die Norm, und kann deshalb ohne Schaden für die Normgeltung von den Folgen seines Verhaltens distanziert werden. Auch bei der unechten aberratio ictus tritt zum Wertungsfehler des Täters ein Wissensfehler hinzu. Der Wissensfehler des Täters ist bei der unechten aberratio ictus aber nicht Ausdruck seines Ungeschicks oder seiner Unachtsamkeit, sondern der Täter bedenkt die Folgen seines Verhaltens nicht, weil sie ihm nicht bedenkenswert, also gleichgültig, sind. Verwirklicht sich das vom Täter gelegentlich des fehlgeschlagenen Versuchs geschafene unerlaubte Risiko im Erfolg, schießt er also z. B. auf eine Menschenansammlung, um eine bestimmte Person aus der Menge zu verletzen, trift er aber einen anderen141, oder ist ihm „die Identität des konkretisierten Opfers von Vornherein … gleichgültig“ und erscheint die Konkretisierung des Vorsatzes auf ein bestimmtes Opfer „angesichts des Tatplans (deshalb) unmotiviert“142, muss der Zurechnungsmaßstab verschärft werden, weil der Wissensfehler des Täters auf Gleichgültigkeit, also auf einem Wertungsfehler beruht. Hat der Täter die Rechtstreue nicht aufgebracht, die von ihm in allen seinen Rollen erwartet wird, um gesellschaftstauglich zu sein, und bedenkt er die Folgen seines Verhaltens deshalb nicht, so ist die aberratio ictus eine Schuldform zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit, die der culpa dolo determinata Feuerbachs143 nahesteht. Denn Kennzeichen dieser Schuldform ist gerade, dass „ein Verbrecher einen bestimmten rechtswidrigen Erfolg zum Zweck hat, aus der hierauf gerichteten Handlung aber ein anderer rechtswidriger Erfolg entstanden ist, welchen er als mögliche Folge seiner Handlung … vorhersehen konnte. Hier ist Dolus in Ansehung des Zwecks, den er wirklich gewollt hat; Culpa in Ansehung derjenigen Wirkung, welche ohne die Absicht des Handelnden aus seiner auf einen anderen rechtswidrigen Zweck gerichteten Handlung entstanden ist“144. Bei der unechten aberratio ictus können fehlgeschlagener Versuch und Abirrung zusammen abgerechnet werden, weil zum Wertungsfehler des Täters zwar ein Wissensfehler hinzukommt, dieser Wissensfehler aber auf einem Wertungsfehler beruht und der Täter deshalb nicht gegen den „Weltlauf“145 protestiert, sondern gegen die Norm. Hat der Täter den realisierten Verlauf aus Gleichgültigkeit nicht bedacht, ist sein Protest gegen die Norm anschlussfähig, weil das Recht dem Täter nicht beweisen kann, dass Rechtstreue stets vorzugswürdig ist. Dem Täter müssen die Folgen seines Verhaltens verschärft zugerechnet werden, weil er sich vom Recht abgewandt hat und sein Wissensfehler deshalb nur der Bedeutungsträger eines Wertungsfehlers ist. Er handelt also vorsätzlich.
3. Schlussbemerkung
Die Behandlung sowohl des error in persona vel obiecto als auch der aberratio ictus folgt den Funktionsbedingungen einer Gesellschaft, die ihre Bürger als frei darstellt, zugleich aber hochgradig anonyme Sozialkontakte ermöglichen muss und die deshalb nur dann psychologisierend-einfühlend verfahren kann, wenn durch die Entlastung des Täters keine für die Bewahrung der normativen Struktur der Gesellschaft erforderliche Zurechnung verloren geht, hat also mit dem Vorhandensein oder Fehlen einer „volitiven Beziehung“146 zwischen Tathandlung und Erfolg nichts zu tun, wie die auf eine „bewusstseinspsychologische Wollen-Nichtwollen-Dichotomie“ verkürzte147„Konkretisierungstheorie“148 annimmt, und deshalb meint, dass „die Tat i. S. des § 16 … durch Vorstellung und Willen“ des Täters „konstituiert“ werde149, damit aber die Ebene verfehlt, auf der „sich rechtlich geregelte Gesellschaftlichkeit ereignet“150, weil sie die Tat monologisch als Ausdruck des „Wollens“ des Täters begreift, aber nicht dialogisch als kommunikativ relevanten Sinnausdruck einer Rechtsverletzung. Error in persona vel obiecto und aberratio ictus unterscheiden sich dadurch, dass die Tat beim error in persona vel obiecto die „eine Tatbestandsverwirklichung gestaltende Wirkung (seines) Wollens“151 kennt152, also präsent über die deliktischen Eigenschaften seines Verhaltens orientiert ist, während der Täter bei der echten aberratio ictus die Situation falsch einschätzt und ihm deshalb „einiges an präsenter Orientierung“153 fehlt. Bei der echten aberratio ictus ist ein nicht durch einen Wertungsfehler vermittelter Wissensfehler rechtlich maßgeblicher Grund des Konflikts, der es erlaubt, den Täter von den Folgen seines Verhaltens zu distanzieren, weil sein Ungeschick oder seine Unachtsamkeit den Verlauf zum Erfolg ohne Schaden für die Normgeltung erklären.
10 Aristoteles Nikomachische Ethik, Bd. III (1983), 1135a
11 Aristoteles a.a.O., 1110b
12 Aristoteles a.a.O., 1110b
13 Schroth JuS 1992, 1 ff., 4; vgl. auch Roxin JuS 1964, 53 ff.; ders. Rudolphi FS (2004), 243 ff., 244; Hassemer Armin Kaufmann GS (1989), 289 ff., 296, der den Vorsatz als „hervorgehobenen Modus des >DafürKönnens<“ bezeichnet und deshalb meint, dass „das Substrat des Vorsatzes nur in Willen und Vorstellung des Menschen liegen kann“, ohne aber die normative Relevanz dieser psychischen Fakten begründen zu können; denn die „Negation der Norm“ kann sich dann mit Unkenntnis verbinden, wenn Grund des Kenntnismangels ein Wertungsfehler ist und nicht etwa Unachtsamkeit oder Ungeschick; vgl. zur Kritik auch Puppe GA 2006, 65 ff.
14 Dazu grundlegend Jakobs ZStW 101 (1989), 527 ff.; kritisch Stuckenberg Vorstudien zu Vorsatz und Irrtum im Völkerstrafrecht (2007), S. 425 ff., 428 ff., der nach der unterschiedlichen Symbolik vorsätzlichen und fahrlässigen Verhaltens unterscheiden will und zu dem Ergebnis gelangt, dass vorsätzliches Verhalten einen größeren Mangel an Normbefolgungsbereitschaft ausdrücke als die Fahrlässigkeit, dabei aber verkennt, dass es zur Kenntnis Surrogate gibt, nämlich Gleichgültigkeit und Tatsachenblindheit; wieder anders Gaede ZStW 121 (2009), 239 ff., 267 f., der meint, dass es dem Vorsatztäter ceteris paribus leichter falle, die Tat zu vermeiden,als dem Fahrlässigkeitstäter: „Wer weiß, was er tut … hat allen … Anlass die Tat zu unterlassen“; ebenso Hassemer Armin Kaufmann GS (1989), 289 ff., 299 f.; Schroth Vorsatz und Irrtum (1998), 50 f.; Walter Der Kern des Strafrechts (2006), S. 114 f.
15 Vgl. auch Roxin Rudolphi FS (2004), 243 ff., 255, der dem Täter die Folgen seines Verhaltens dann nicht zum Vorsatz zurechnen will, wenn der „Verursacher der Gefahr sich einem ebenso großen Risikos aussetzt wie der Gefährdete“.
16 Die „Nichtfreiwilligkeit“ des Aristoteles lebt bis heute in den erfolgsqualifizierten Delikten (§ 18) fort und wurde im gemeinen Recht als dolus indirectus des „Absicht“ gleichgestellt; vgl. nur Carpzov Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium (1645), Quaestio I, Nr. 28 bis 32
17 Aristoteles Nikomachische Ethik, Bd. III (1983), 1110b
18





























