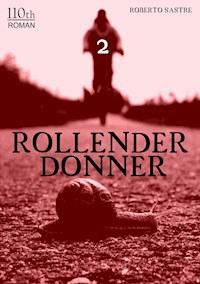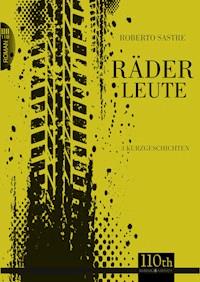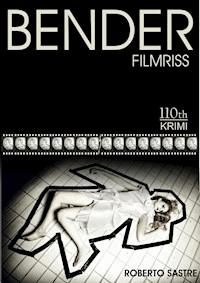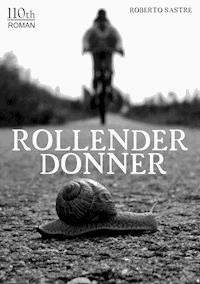Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Benders 2. Fall: Friedwart Bender, der Rollstuhl fahrende Privatermittler will eigentlich nur einen Vortrag auf einem Kongress in London halten und anschließend ein paar Tage in der Stadt genießen. Aber Bender wäre nicht Bender, wenn er die Missgeschicke nicht magisch anziehen würde. So überlebt er knapp einen Sprengstoffanschlag. War es ein Terroranschlag, ein Unfall oder der Teil von etwas Größerem? Die Suche nach Antworten führt ihn erst zurück nach Deutschland und quer durch Osteuropa, von einer Panne zum nächsten Fettnäpfchen. Manchmal muss man eben die Datenautobahn verlassen und stellt entsetzt fest, dass das reale Leben auf der realen Autobahn nicht nur für Rollstuhlfahrer so manche schräge Situation versteckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roberto Sastre
Impressum:
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
Foto: www.bjoernjansen.com
Bjørn Janssen Photography, Konstanz,
Modelle:
Janina Lara Seitle
Amy Catheriné
Deborah Frey
© 110th / Chichili Agency 2014
EPUB ISBN 978-3-95865-187-6
MOBI ISBN 978-3-95865-188-3
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Kurzinhalt
Friedwart Bender, der Rollstuhl fahrende Privatermittler will eigentlich nur einen Vortrag auf einem Kongress in London halten und anschließend ein paar Tage in der Stadt genießen. Aber Bender wäre nicht Bender, wenn er die Missgeschicke nicht magisch anziehen würde. So überlebt er knapp einen Sprengstoffanschlag. War es ein Terroranschlag, ein Unfall oder der Teil von etwas Größerem? Die Suche nach Antworten führt ihn erst zurück nach Deutschland und quer durch Osteuropa, von einer Panne zum nächsten Fettnäpfchen. Manchmal muss man eben die Datenautobahn verlassen und stellt entsetzt fest, dass das reale Leben auf der realen Autobahn nicht nur für Rollstuhlfahrer so manche schräge Situation versteckt.
Der Autor
Roberto Sastre ist in Deutschland geboren und führte als Computerspezialist ein einigermaßen geruhsames Leben, das nur von gelegentlichen Eskapaden des passionierten Rockmusikers unterbrochen wurde. Als ihn ein Kundenauftrag ins Ausland führte, packte ihn das Reisefieber. Einige Jahre lebte er in Lateinamerika, wo man seinen Namen kurzerhand verspanischte. Seit einem Unfall sitzt er querschnittgelähmt im Rollstuhl. Seine Abenteuerlust und den Spaß am Erzählen tobt er jetzt an der Tastatur aus.
Vorwort
Dieses Buch ist wieder von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Man sagte mir, bei Romanen sei so etwas absolut üblich. Nachdem ich in inzwischen drei autobiografischen Erzählungen berichtet habe, wie ich im Rollstuhl gelandet bin und wieder ins Leben zurückgefunden habe, hat mich die Lust am Schreiben gepackt. Die ersten beiden Erzählungen sind übrigens unter dem Namen „Rollender Donner“ bei Chichili/Satzweiss erschienen. Der dritte Teil ist auch schon im Lektorat. Mal sehen, was schneller ist, die Gesamtausgabe vom Rollenden Donner mit allen drei Teilen, oder dieses Buch.
Na ja – so aufregend ist mein Privatleben nun auch wieder nicht und mit drei Büchern habe ich meiner kleinen Lesergemeinde eigentlich genug Prosa angetan. Ob mir eine erfundene Geschichte übel genommen wird? Diese Frage hätte ich mir nicht stellen müssen. Friedwart Bender, der mit seinem Rollstuhl von Fettnäpfchen zu Abenteuer zu Schlamassel eiert und es irgendwie immer schafft, sich herauszuziehen, fand auf Anhieb seine Fans.
Diesmal verschlägt es ihn nach London, der Hauptstadt der Kriminalromane. Sein rollendes Computerlabor musste er zu Hause lassen, sein Elektrorollstuhl ist defekt und Elsbeth, seine treue Assistentin – aber ich möchte die Spannung nicht vorwegnehmen. Wie es ausgeht, das weiß ich an dieser Stelle selbst noch nicht, aber ich bin sicher, dass der gute Bender auch diesmal durch die seltsamsten Abenteuer stolpern wird.
Elsbeth ist tot!
Ich habe sie umgebracht. Meine Elsbeth, die mich seit meinem ersten Fall begleitet, sie ist nicht mehr da. Kein reinquatschen beim Autofahren mehr. Keine Politessen, die zu zugeparkten Behindertenparkplätzen bestellt werden. Kein fröhliches „Sie haben Post“ im ungeeignetsten Moment. Und ich bin schuld daran.
Es war ein Unfall. Normalerweise kann man mit einem Elektrorollstuhl schon mal in den Regen kommen. Die Elektrik, wie auch die Elektronik sind spritzwassergeschützt und halten auch einen etwas kräftigeren Guss aus. Elsbeth ist in ihrem Versteck unter meinem Sitzkissen normalerweise gut geschützt. Aber hundertprozentigen Schutz gibt es eben nicht. Wir hatten im Kloster des Ordens den Abschluss eines ziemlich komplizierten Falles gefeiert. Ob es jetzt am Weißherbst lag oder an unserer ausgelassenen Stimmung, ich weiß nur noch, dass ich im Kneippbecken stand und Hamlet deklamierte. Also – mein Rollstuhl stand und ich saß darin. Tanja saß zu meinen Füßen und soufflierte mir. Lisa gab am Beckenrand die Uncoole. „Mensch, Bender, du benimmst dich wie ein kleiner Junge. Komm raus, du hast schon ganz blaue Lippen.“ Manchmal kann sie schon eine ganz schöne Glucke sein, aber diesmal hatte sie Recht. Ich schob den Joystick nach vorn, um wieder aus dem Becken zu rollen, aber der Rollstuhl gab keinen Mucks von sich. Das Display war tot. Das leise Pfeifen der Mikroturbine war erloschen. Weinselig rührte ich mit dem Joystick in alle Richtungen. Das Einzige, was ich erreichte, war ein Lachorkan der Umstehenden. Selbst Lisa wischte sich die Tränen aus den Augen. „Auf los jetzt, komm raus, du hast dich genug zum Affen gemacht.“ Warum müssen Frauen immer nur so vernünftig sein? So langsam merkte sie, dass da etwas nicht stimmte. Während ich immer noch kichernd den Joystick malträtierte, hatte sie ein paar Freiwillige mobilisiert, die mich mit vereinten Kräften aus dem Becken bugsierten. Die Schwestern hatten mich schnell wieder trockengelegt und in meinen Ersatzrollstuhl verfrachtet. Einen Aktiv-Rollstuhl ohne Antrieb. Den Rest des Festes durfte ich mit Muskelkraft absolvieren.
Die Techniker des Ordens stellten am nächsten Morgen fest, dass das Wasser meinem Rollstuhl gar nicht gut getan hatte. Antrieb und Steuerung waren triefend nass. Allerdings sind die so robust ausgelegt, dass sie nach einer sorgfältigen Trockenlegung wieder funktionieren sollten. Nur Elsbeth konnten sie nicht mehr wiederbeleben. Die hatten diverse Kurzschlüsse endgültig zu ihren Altvorderen versammelt.
Hatte ich erwähnt, dass Elsbeth ein Computer ist? War. Ein Notebook, genauer gesagt, dass unter meinem Sitz im Rollstuhl eingebaut war. Hatte ich? Tut mir leid, aber ich stehe immer noch unter Schock. Ja, in so einem E-Rolli kann man eine Menge Dinge verstecken. Vor Jahren hatte ich eine Zeit lang mit künstlicher Intelligenz herumexperimentiert. Steffen, ein begnadeter Tüftler, den ich in der Reha kennengelernt habe, hatte an meinen Algorithmen weitergearbeitet und sie so optimiert, dass wir ein älteres Notebook damit ausstatten konnten. Dieses Notebook steckte unter meinem Sitz und hörte auf den Namen Elsbeth. Im wörtlichen Sinne. Eine Sprach-Ein- und Ausgabe hatten wir mit als Erstes realisiert. Das Wasser im Kneipp-Becken hatte ganze Arbeit geleistet, dieses Notebook würde nie wieder einen Ton von sich geben. Kathrin Vollbarth, die IT-Leiterin des Ordens hatte die Festplatte schon ausgebaut und an Steffen geschickt.
„Du bist mer vielleischt en Labbeduddel“
Steffen konnte sich kaum halten vor Lachen. „Du Kapp, des waaßte doch selber, des mer en Kompjuder net mit ins Wasser nimmt. Aber mach der nix draus, isch hab noch e Backup. Bloß e neu Kist‘ die müsse mer einbaue. Aber isch hab da schon ´ne Ideesche.“
Virtuelle Millionen
„Ladies and Gentlemen, British Airways welcomes you aboard of flight Bee Ay oh niner oh one from Fränkfört to London Heathrow.“ Die Stimme der Flugbegleiterin hatte diesen näselnd singenden Ton, den ich schon einige Zeit nicht mehr gehört hatte. Genauer gesagt schon einige Jahre, denn seitdem ich im Rollstuhl sitze, habe ich kein Flugzeug mehr bestiegen. Mein Haupt-Fortbewegungsmittel ist mein umgebauter Van. Da kann ich mit dem Elektrorollstuhl hinters Lenkrad rollen und selbst fahren. Hinten ist mein kleines Computerlabor eingebaut. Eigentlich bin ich ja unter vollen Bezügen in Rente und müsste nicht mehr arbeiten. Für einen ehemaliges Mitglied einer Spezialeinheit ist es aber nicht so einfach, von einem zum anderen Tag in Rente zu gehen. Ja, so eine Kugel, die sich mitten im Einsatz plötzlich in der Wirbelsäule breitmacht, kann einem schon den ganzen Tag versauen. Und so arbeite ich jetzt eben als freier Ermittler im Bereich Computerforensik gelegentlich wieder für meine alte Einheit.
Seit einem Fall von illegaler Pornographie, in dem Tanja, die Tochter eines meiner Freunde unfreiwillig eine tragende Rolle spielte, ist mein Hauptkunde allerdings ein über 800 Jahre alter Orden. Der Orden Unserer Lieben Frau vom Rhein wurde zur Zeit der Kreuzritter von einer ehemaligen Trosshure gegründet. Sie wollte ursprünglich all diejenigen mit bleibenden Schäden heimgekehrten Kreuzzügler medizinisch versorgen, die nicht für einen der großen Ritterorden gekämpft hatten und für die sich niemand zuständig fühlte. In einer aufgegebenen Abtei baute sie eine Art Pflegeheim auf. Das Geld dazu hatte sie mit zwei Häusern verdient, in dem man sich der käuflichen Liebe hingeben konnte. Da sie darauf bestand, dass ihre Mädchen sich richtig pflegten und auch medizinisch versorgt wurden, erfreuten sich ihre Frauenhäuser eines sehr guten Rufes. Das Wort Frauenhaus ist übrigens schon älter, als so manche glauben. Nur die Bedeutung, die hat sich im Lauf der Jahre geändert. Jedenfalls entwickelte sich eine Organisation, die schon vor einigen hundert Jahren moderner aufgebaut war, als so manches heutige Unternehmen. Nur um überleben zu können, wurde der Orden immer größer. Heute betreibt er eigene Schulen, Kinder- und Pflegeheime.
Seit einigen Jahren unterstützt er eine Universität, die Studiengänge für Hochbegabte anbietet. Tanja, mein Patenkind, die in den Schul- und später in den Semesterferien gerne bei mir jobbt, besucht diese Universität mit einem Stipendium des Ordens. Sie hat sich zu einer jungen Frau entwickelt, die man kaum beschreiben kann, ohne in Superlative zu verfallen. Tanja studiert Kriminologie und Informatik. Im nächsten Jahr will sie ein halbjähriges Praktikum im Bereich Computerforensik bei mir absolvieren. Da freuen wir uns beide heute schon drauf.
Der Orden hat mir eine kleine Wohnung eingerichtet, die ich mir mit Lisette de la Montagne teile. Lisa, wie sie von allen genannt wird, war ebenfalls in Tanjas Fall involviert. Sie ist inzwischen in den Orden eingetreten und hat dort die Pflegedienstleitung übernommen. Unser Verhältnis ist etwas merkwürdig. Wir verstehen uns gut, haben fantastischen Sex, aber eine echte Beziehung hat für uns einen ähnlichen Stellenwert, wie Weihwasser für den Teufel.
Meine beiden Pflegerinnen Melinda und Nikita sind nicht mehr so häufig bei mir. Sie haben im Orden andere Aufgaben übernommen und springen nur noch ein, wenn mal niemand sonst zur Verfügung steht. Zum Glück verstehe ich mich ja prima mit der Pflegedienstleiterin. Wenn ich im Kloster übernachte, dann werde ich von Pflegekräften aus dem Heim betreut, das auf demselben Gelände liegt.
In meiner Wohnung in der Nähe des Frankfurter Huthparks mit dem herrlichen Blick über das Maintal bis zum Spessart habe ich ein Zimmer als Aufenthalts- und Rückzugsraum für meine 24-Stunden-Assistenz eingerichtet. Üblicherweise haben sich mehrere Pflegerinnen alle 12 oder 24 Stunden bei mir abgelöst. Momentan probieren wir ein anderes System aus. Eine Pflegerin wohnt mehrere Tage fest bei mir und wird von einer Kollegin abgelöst, die dann auch für mehrere Tage bleibt. In Regelfall bin ich aber 2-3 Tage pro Woche im Kloster. Seit ich den Rahmenvertrag mit dem Orden abgeschlossen habe, brauche ich mich über fehlende Fälle nicht zu beklagen. Die Mutter Oberin hatte wirklich nicht übertrieben.
Caitlin, die Cathy genannt wird, ist momentan die meiste Zeit für mich zuständig. Sie teilt sich die Aufgabe mit Monika, die lateinamerikanische Vorfahren hat. Monis zarte Figur lässt nicht erahnen, welche Kräfte in ihr schlummern. Schließlich muss sie mich bei der Pflege öfter mal herumwuchten. Ihre Haut, die diesen Farbton hat, der wie Milchkaffee aussieht und den man bei den Südamerikanern als „Morena“ bezeichnet, macht den Gesamteindruck noch stimmiger – bis sie den Mund aufmacht. Sie ist in der Pfalz aufgewachsen und den Dialekt ihrer Kindheit kann sie nicht ganz abstreifen. Im ersten Moment wirkt das schon irritierend. Sie lässt keinen Moment der Trübsal aufkommen und ist ständig in Bewegung. Dabei ist sie von einer Sanftheit geprägt, eine Mischung, die nur die Latinas so hinbekommen. Monis sanftmütiges Wesen ergänzt sich gut mit Cathys burschikoser Art. Das Einzige, was an Cathy nicht typisch deutsch ist, ist ihr irischer Ururgroßvater. In ihrer Familie ist es üblich, den Kindern irische oder englische Namen zu geben. Cathy ist immer pünktlich, extrem sorgfältig und hat einen fast unzerstörbaren Humor. Der bekommt immer nur dann Risse, wenn ich sie scherzhaft „Käthe“ nenne. Das kann sie überhaupt nicht ab.
Dass alle meine Pflegerinnen hochqualifiziert sind, ergibt sich aus dem Selbstverständnis des Ordens. Ich vermute mal ganz stark, dass sie auch beide zumindest Grundkenntnisse in der Selbstverteidigung haben. Die Mutter Oberin legt großen Wert darauf, dass sich ihre „Kinder“ auch in unüblichen Situationen helfen können.
Schwester Kathrin Vollbarth, die IT-Leiterin des Ordens wollte eine Tagung zum Thema Netzwerksicherheit im klerikalen Umfeld besuchen, zu der britische Jesuiten eingeladen hatten. Aber das Leben spielt uns gerne mal einen Streich. Gestern beim Transfer in ihr Bett hat ihre Pflege eine offene Stelle gefunden, dämlicher weise genau am Sitzbein. Dekubitus, der Albtraum aller Rollstuhlfahrer. Dagegen gibt es nur eine wirksame Behandlung, nämlich entlasten. Für die nächste Zeit wird Kathrin auf dem Bauch schlafen, bis der Hautdefekt wieder abgeheilt ist. Ihr war bei der Arbeit ein USB-Memory-Stick auf den Schoß gefallen. Viele von uns Querschnitten haben kein Gefühl in den unteren Körperregionen. So hat Kathrin nicht gemerkt, dass der Stick sich durch ihre Bewegungen auf dem Sitzkissen nach hinten gearbeitet hat. Abends hatte sie bereits ein tiefes Loch in der Haut. Das Loch hat man ihr sofort zugelasert. Jetzt braucht sie viel Geduld, bis alles wieder verheilt ist. Kathrin und Geduld sind nicht wirklich die besten Freunde, aber da muss sie jetzt durch. Durch die Laserbehandlung wird der Heilungsprozess erheblich beschleunigt, aber einige Wochen wird es wohl brauchen.
So sitze ich im Flieger, neben mir schaut Cathy begeistert aus dem Fenster. In der Reihe vor uns hat sich Sylvia Vollbarth, Kathrins Schwester und Kollegin in ein Computermagazin vertieft. Neben ihr sitzt eine abenteuerlustige junge Rollstuhlfahrerin. Sie fliegt meistens alleine und war auch diesmal ohne Begleitung zum Flughafen gekommen. Viele Fluglinien bestehen darauf, dass Menschen, die sich nicht selbst evakuieren können, mit Begleitpersonen reisen. Deswegen wird man als Rollstuhlfahrer auch keinen Platz am Notausgang bekommen. Die Flugbegleiter haben im Notfall anderes zu tun, als die Behinderten rauszutragen. So heißt es für uns, entweder Begleitperson mitnehmen oder so lange sitzen zu bleiben, bis die Maschine komplett ausgebrannt ist. Sylvia hat sich auch gleich bereit erklärt, als Begleitperson zu fungieren. Die Dame am Check-in meinte doch glatt, sie wäre doch viel zu schwach dazu. Ohne ein Wort zu sagen, drehte Sylvia sich zu der Rollstuhlfahrerin herum und setzte sie ohne jede Mühe in einen bereitstehenden Kabinenstuhl um. Etwas Anatomie, dazu eine Prise Hebelgesetze, Kinästhetik nennt sich das Ganze und sieht aus wie eine Mischung aus Judo und Krankengymnastik. Auf die Art können Menschen, die fast das Doppelte der Pflegekraft wiegen, ohne Schwierigkeiten bewegt werden. „Äh, sie muss aber doch noch zum Flieger ...“ Einen Wimpernschlag später saß die junge Frau wieder in ihrem Rollstuhl. Kleiner Nebeneffekt – für Begleitpersonen reduziert sich der Ticketpreis erheblich. Sylvia bekam den Mund nicht mehr zu, als man ihr den Differenzbetrag direkt in bar auszahlte und beim Übergepäck bloß abwinkte.
Jedenfalls weiß ich, auf wen heute Abend das Stout geht. Ich kenne da ein Pub, die zapfen ein Porter, leicht malzig, aber nicht zu süß, schwarz wie eine Mondfinsternis. Das läuft von selbst die Kehle runter. Die Leute behaupten ja immer, das englische Bier wäre schal und warm. So ganz stimmt das nicht. Die Engländer haben bloß eine etwas andere Brautechnik. Ihr Bier entwickelt den besten Geschmack bei ungefähr 10-12 Grad und hat weniger Kohlensäure. Deswegen sind englische Zapfhähne auch viel größer. Das Bier wird nämlich aus den Fässern gepumpt und nicht mit Kohlensäure gezapft. Man hat zwar inzwischen auch Kohlensäurezapfanlagen, aber damit schmeckt das Bier irgendwie nicht richtig. Für einen deutschen Biertrinker wirkt das erste Glas vielleicht ein bisschen ungewohnt. Spätestens nach dem dritten Glas macht es einem aber nichts mehr aus. Durch die fehlende Kohlensäure kann man nämlich viel mehr trinken.
Irgendwo unter mir im Bauch des Airbus ist mein Aktivrollstuhl zusammengefaltet und verstaut. Normalerweise würde die Crew den Rollstuhl in der Kabine mitnehmen, aber das Flugzeug ist bis auf den letzten Platz besetzt. Durch die Faltmechanik kann ich den Rollstuhl ein paar Zentimeter schmaler machen, ohne aus ihm auszusteigen. Will ich ihn wieder verbreitern, dann drücke ich mich auf den Schutzblechen hoch, während ein Helfer die Griffe auseinanderzieht. Gerade bei schmalen Toilettentüren ist das äußerst praktisch. Bei den Toiletten im Flugzeug klappt das aber auch nicht. Die sind so klein, dass ich auch mit dem Kabinenstuhl keine Chance habe, hinein zu kommen. Die Fluglinie wusste, dass ein Whisky Charly Hotel Charly kommt, ein Rollstuhlfahrer, der bis zum Kabinensitz gerollt werden muss. Deshalb stand ein Bordrollstuhl bereit. Ich wurde bis zur Maschine geschoben, dann haben mich zwei kräftige Arbeiter in den schmalen Kabinenstuhl gehoben. Mit zwei Griffen war mein Stuhl zusammengefaltet und verschwand im Bauch der Maschine. Mit einem Gepäcklift hob man mich zur Gangway hoch, klappte ein Stück Geländer weg und ich war drin. Normalerweise hätte man mich mit einem Lift zum Finger gebracht. Das ist dieser Schlauch, der von den Warteräumen zu den Maschinen geht. Dass der Lift genau zu diesem Zeitpunkt gewartet wurde, war mal wieder mein ganz persönliches Glück. Mit ratlosen Gesichtern stand man herum und überlegte. Im Scherz meinte ich: „Dann nehmt doch ´n Gepäcklift.“ Warum kann ich nie meine Klappe halten?
Jetzt sitze ich in einem ganz normalen Passagiersitz und sehe aus wie jeder andere. Den Bordrollstuhl hat man wieder ausgeladen. Auch kein Platz. Irgendein Event, das mit der Königsfamilie zu tun hat. Da werden wieder alle Straßen verstopft sein, die Passkontrolle dauert Stunden und die Taxipreise explodieren. Mein Ticket hat schon das eineinhalbfache des regulären Preises gekostet. Spesen, die kann ich abrechnen. Meinen E-Rollstuhl haben die Techniker des Ordens in der Mache, von Steffen mit Argusaugen überwacht.
„Mach der mal kaan Kopp“, hat er mich beruhigt, „du kriehst e ganz neu Elsbeth. Die kann dann noch e ganz Eck mehr. Watts ab, die werd rischdisch guhd.“
„Sir“, diesen leicht blasierten Ton bekommen nur die Flugbegleiterinnen von British Airways so hin. Irgendwie weiß ich nie, haben die jetzt einen Riesenrespekt vor mir, oder können sie bloß die Verachtung nur schwer unterdrücken. Vielleicht liegt‘s aber auch nur an der Sprache. Englisch richtig ausgesprochen klingt immer ein wenig, als wäre der Rest der Welt zur eigenen Belustigung da. Ob ich ein Frühstück möchte? Wir lassen uns eine große Portion Rührei mit Bratwürstchen schmecken. Als Rollstuhlfahrer ist es sinnvoll, nicht unbedingt Holzklasse zu fliegen. Club Class hat echte Vorteile. Knapp eineinhalb Stunden Flug, aber für ein richtiges britisches Frühstück muss Zeit sein. Das ist fast noch wichtiger, als der Fünfuhrtee.
„Das sieht ja toll aus“, Cathys Finger deuten zum Fenster. Ich recke mich. Hinter der Flügelkante ist ein Zentimeter Wasser vor der Küstenlinie Frankreichs zu sehen. Vor der Flügelspitze ist ebenfalls ein Finger breit Ärmelkanal, darunter liegen die weißen Klippen von Dover. Der Anblick fasziniert auch mich jedes Mal aufs Neue. Es ist schon ein irrwitziges Gefühl. Da sitzen wir in bequemen Sesseln, genießen ein frisch zubereitetes Frühstück mit Würstchen, Rührei und einem hervorragenden Tee. Ja der englische Tee. Wer je englischen Kaffee getrunken hat, kann die Begeisterung der Briten für Tee verstehen. Unter unseren Füßen sind ein paar Millimeter Aluminium, ungefähr 12 Kilometer Luft und dann Wasser. Ich konzentriere mich auf mein Frühstück und versuche, nicht daran zu denken, dass das Einzige, das die viele Tonnen schwere Maschine vor einem Sturz in den Ärmelkanal bewahrt, ein physikalisches Prinzip ist, nach dem sie an der umgebenden, ziemlich dünnen Luft hängt.
Wir haben gerade genug Zeit für eine zweite Tasse Tee, da geht das „Anschnallen“-Licht wieder an. Lehnen senkrecht, Tisch einklappen, Landeanflug – ich hatte mich erst gar nicht abgeschnallt. Caitlin neben mir ist ganz aufgeregt. Sie ist das erste Mal eigenverantwortlich unterwegs. Ich bin ja kein Ordensmann, sondern nur Berater. Sylvia spielt die Rolle der Assistentin, die mir technisch zur Hand geht. Eine kleine Assistentin wird auch von Insidern gerne mal übersehen. Dass sie mir fachlich kaum nachsteht, muss ja keiner wissen. Ihr fehlt nur noch die Erfahrung, aber die kommt von selbst. So ist Cathy als diejenige, die für meine Pflege verantwortlich ist, auch gleichzeitig unsere Delegationsleiterin. Ihre Eltern hatten sich auch im Orden kennengelernt. Als sie geboren wurde, entschieden sie sich dazu, ihre Mitgliedschaft vorübergehend ruhen zu lassen. Die ersten Jahre wuchs sie in einer ganz normalen Familie auf. Sie kam dann in einen Kindergarten des Ordens. Bis zu ihrer Einschulung durften ihre Eltern nicht in den Orden zurückkehren.
So tolerant er allen Aspekten der menschlichen Existenz gegenüber auch ist, bei der Kindererziehung geht der Orden keinerlei Kompromisse ein. Kinder sind unsere Zukunft und müssen sich einerseits frei entwickeln können, andererseits aber auch verstehen, dass das Zusammenleben von Menschen nur funktioniert, wenn sich alle an bestimmte Regeln halten. Respekt gegenüber der Erfahrung von Älteren, niemanden etwas wegnehmen, niemanden falsch beschuldigen. Im Großen und Ganzen orientieren sich die Regeln an den Zehn Geboten. Alle Kinder wachsen gemeinsam auf. Sie lernen von Anfang an, dass vieles besser funktioniert, wenn man sich gegenseitig hilft und auch Hilfe annimmt. Die Erzieherinnen und Erzieher versuchen, besondere Talente früh zu erkennen und zu fördern. Talente wie Behinderungen werden als Zeichen der Individualität und der Vielfalt akzeptiert. So wachsen die Kinder in einer Umgebung auf, bei der Individualität und soziales Verhalten von Anfang an als Selbstverständlichkeit vermittelt werden. Das Kennenlernen des eigenen Körpers, das in vielen Kulturen als schmutzig oder sogar als Tabu gilt, wird als wichtige Komponente der Entwicklung betrachtet. Gleichzeitig kann damit der Respekt vor der Privatheit vermittelt werden. Ich hatte mich anfangs gewundert, warum meine Pflegerinnen so vertrauensvoll miteinander umgehen, mehr wie Schwestern als Kolleginnen. Als ich den Tod einer Ordensschwester im Kloster untersuchte fiel mir sofort diese besondere Art auf, mit der man sich gegenseitig behandelte. Dieser Mischung aus Vertrautheit und Respekt begegne ich nicht allzu oft.
Die Maschine hat die Landeklappen ausgefahren und setzt zur Landung an. Mit leisem Rumpeln fährt das Fahrwerk aus. Dabei fällt mir jedes Mal mein erster Flug in einer Verkehrsmaschine ein. Es war ein Inlandsflug mit einer Boeing 737 gewesen. Als die Landeklappen ausgefahren wurden, bekam ich einen Riesenschreck. Ich dachte, da lösen sich Stücke aus der Tragfläche. Das Rumpeln beim Ausfahren des Fahrwerks brachte mich an den Rand einer Panik. Inzwischen wäre ich besorgt, wenn im Landeanflug kein Rumpeln zu hören wäre. Ein Fahrwerk, das die Landung einer zig Tonnen schweren Maschine aushält, das lässt sich nicht ganz lautlos ausfahren. Und mit ausgefahrenem Fahrwerk landet es sich einfach leichter. Der Pilot setzt die Maschine butterweich auf. Der Gegenschub, mit dem er den Bremsvorgang unterstützt, drückt uns in die Gurte. Als ich mein Gesicht aus der Rückenlehne des Vordersitzes puhle, stelle ich fest, wie selbstverständlich ich früher die Beine beim Abfangen dieses Rucks benutzt habe. Instinktiv habe ich die Arme an den Körper gezogen und versucht, mich zu einer Kugel zusammen zu rollen. Das jahrelange Training lässt sich eben nicht so einfach abstellen. Mit funktionierenden Bauchmuskeln hätte das bestimmt auch geklappt. So hat eben mein Gesicht zusammen mit dem Vordersitz die Vorwärtsbewegung abgefangen. Als sie sieht, dass mir nichts weiter passiert ist, zeigt Cathy ein erleichtertes Grinsen. „Das kriegst du aber noch eleganter hin.“ Jaja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.
Die Rollstuhlfahrerin vor uns reicht Sylvia gerade ein Kissen. Sie hatte das im Landeanflug auf ihrem Schoß liegen und sich kurz vor der Landung darüber gebeugt. Aha, so geht das. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Während das Flugzeug noch zum Gate rollt, ist hinter uns Unruhe zu hören. Einige Passagiere haben sich schon abgeschnallt und die Staufächer über ihren Köpfen geöffnet. Die Ansage, noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis die Maschine die Parkposition erreicht hat, haben sie schon längst wieder vergessen. Die Flugbegleiterinnen werfen sich resignierte Blicke zu. Ich weiß nicht, welches Gesetz dafür verantwortlich ist, aber diese ungeduldigen Typen bekommen ihr Gepäck meistens als letzte. Vielleicht liegt es ja daran, dass sie auch ziemlich früh eingecheckt haben. Ihre Koffer werden dann als erstes verladen und zuletzt aus dem Gepäckraum geholt. Wäre zumindest eine Erklärung. Mich stört es nicht weiter, ich werde eh als letzter ausgeladen, damit der Bordrollstuhl durchkommt. Ich hoffe nur, dass mein Rollstuhl im Gepäckraum nichts abgekriegt hat. Da hab ich schon die tollsten Geschichten gehört.
Als ich endlich aus dem Flugzeug gerollt werde, steht schon mein Faltrolli im Fingerkopf. Die andere Rollstuhlfahrerin war vor mir ausgeladen worden, Ladies First. Sie schimpft wie ein Rohrspatz. Normalerweise sind die Briten, was Barriefreiheit und den Umgang mit Behinderten angeht, den Deutschen ein paar Jahre voraus. Aber auch die sind nur Menschen. Man wusste, dass in der Maschine zwei Rollstuhlfahrer sitzen. Also waren vier Assistenten am Flugsteig. Die wollten sie unbedingt in meinen Rollstuhl verfrachten. Ihrer war nämlich bereits auf dem Weg zum Gepäckband. Irgendein Gepäckentlader hat da wohl nicht aufgepasst. Ohne Rollstuhl musste sie aber im Bordrollstuhl bleiben und zur Gepäckausgabe gefahren werden. Während sie noch diskutierten, ob jetzt jemand zum Gepäckband geht und den Rollstuhl wieder holt oder sie mit dem Bordrollstuhl einfach hinfährt, meinte Sylvia als offizielle Begleiterin nur ganz trocken, was denn mit einem zweiten Bordrollstuhl wäre, schließlich säße der Eigentümer des vorhandenen Rollstuhls noch in der Maschine. „Oops“, betretene Mienen. Dann brach Gelächter aus, was meine Mitreisende natürlich noch mehr erzürnte. An das Nächstliegende hat man gar nicht gedacht.
Mithilfe der Assistenten sitze ich schnell wieder in meinem Rollstuhl. Am Gepäckband treffen wir Sylvia wieder. Ihr Schützling wird gerade in ihren Rollstuhl umgeladen. Bei ihr sieht das irgendwie eleganter aus, als bei mir. Was 30 Kilo weniger doch ausmachen.
Der Tipp unserer Reisebekanntschaft war Gold wert. Statt ein Taxi zu nehmen, sitzen wir in der Picadilly Line in Richtung Innenstadt. Die Londoner U-Bahn ist, was Barrierefreiheit angeht, nicht unbedingt richtungsweisend. Viele Stationen sind einfach so alt, dass eine Nachrüstung mit Liften schlicht nicht möglich ist. Manche haben sogar noch Holzrolltreppen. Die sehen zwar herrlich nostalgisch aus, aber für Rollstuhlfahrer sind sie natürlich nichts. Wir müssen an der Station Hammersmith in die District Line umsteigen. Normalerweise hätten wir bis Earl‘ s Court sitzenbleiben können, aber da komme ich mit dem Rollstuhl nicht ans Tageslicht. Also steigen wir am Olympia Park in Kensington aus. Bis zum Earl‘ s Court ist es dann nicht mehr weit. Im gleichnamigen Kongress- und Ausstellungszentrum findet unsere Tagung statt. Direkt nebenan ist ein barrierefreies Hotel einer bekannten Kette.
In London U-Bahn zu fahren ist ein echtes Erlebnis. Menschen aus allen Ecken des Empires bilden ein kunterbuntes Gewimmel. Uns gegenüber sitzt ein graugekleideter Mann mit Bowlerhut, also der klassischen Melone. Den zusammengerollten Schirm hat er wie einen Spazierstock zwischen den Knien aufgestützt. Die Jugendlichen in allen Hautfarben, die sich lautstark über seinen Kopf hinweg unterhalten, nimmt er schlicht nicht zur Kenntnis. Ich glaube, dieses Ausblenden von Dingen, die einen nicht interessieren, das kriegen nur die Londoner so hin. Gelassen pendelt er jeden Ruck, jede Kurve aus, so als wäre er mit sich und der Welt absolut im Reinen. Die Menschen um ihn herum, das quirlige Leben, das ist für ihn einfach Umgebung. Das könnte genauso gut ein Vogelnest in einem Baum sein oder ein Schwarm Heringe unter seinem Boot.
Als wir am Aufzug der Station Earl‘ s Court ankommen, hängt gerade ein Techniker ein Schild an die Tür. Sinngemäß übersetzt steht da, dass der Aufzug gewartet wird und man sich für eventuelle Unbequemlichkeiten entschuldigt. Höflich sind sie ja, die Engländer, aber das nützt mir jetzt auch nichts. Cathy nimmt es gelassen. Sie lotst mich zur Rolltreppe. Dann drückt sie mir den Griff ihres Rollkoffers in die Hand.
„Festhalten!“
Sie kippt meinen Rollstuhl auf die Hinterräder und zieht mich rückwärts auf die Rolltreppe. Mich packt die nackte Panik.
„Sag mal, spinnst du?“
Aktivrollstuhlfahrer kennen das, Hindernisse überwindet man am besten gekippt. So verrückt es klingt, aber in manchen Situationen ist der Rollstuhl stabiler, wenn die vorderen, kleinen Lenkräder keinen Bodenkontakt haben. Für Leute, die in einem Aktiv-Rolli sitzen, gehört das zur Grundausbildung. Aber ich fahre normalerweise einen E-Rollstuhl. Und wenn so ein Teil mal in Schräglage gerät, dann wird’s meistens haarig. Nicht, dass ich besonders schreckhaft wäre. Aber da darf einem doch der kalte Schweiß ausbrechen, oder?
„Ganz ruhig. Lehn dich zurück und genieß´ die Show“, Cathys Stimme klingt merkwürdig dumpf.
In einer Reklametafel reflektiert sich leicht verzerrt ein denkwürdiges Bild. Vorne eine junge Frau, die in einer Haltung, wie ein Skispringer bei der Telemark-Landung einen Rollstuhl gekippt in der Balance hält und darum kämpft, nicht laut loszulachen. Im Rollstuhl sitzt mit leicht panischem Gesichtsausdruck eine korpulente Gestalt, die sich verzweifelt am Griff eines Rollkoffers anklammert. Die ganze Gruppe wird gemächlich von der Rolltreppe nach oben geschaufelt.
„Ihr seht vielleicht bekloppt aus.“ Sylvia hat sich von ihrer Reisebegleitung verabschiedet und erwartet uns oben an der Rolltreppe. Die lichtdurchflutete Halle ist ein überraschender Kontrast zu dem Tunnelbahnsteig der Piccadilly Line, der für Klaustrophobiker eine ganz besondere Herausforderung ist. Vielleicht habe ich auch deshalb leicht unentspannt reagiert. Was soll´s, jetzt sind es nur noch ein paar Schritte zum Earl’ s Court Exhibition Centers, in dem die Tagung stattfindet. Ich bin ja mal gespannt, wie barrierefrei die Bude ist.
Es ist wirklich beeindruckend. Aus allen Ecken Europas sind Delegationen erschienen. Die Jesuiten haben eine ausgefeilte Planung hingelegt. Nicht nur, dass die Verpflegung die unterschiedlichen Vorschriften verschiedener Gruppen berücksichtigt, auch die Mentalitäten hat man bedacht. Es gibt eben auch in diesem Bereich Vereinigungen, die sich miteinander vertragen und andere, die man besser nicht im selben Hotel unterbringt. Für mich hat man ein rollstuhltaugliches Zimmer reserviert, mit befahrbarer Dusche, Duschrolli, Lifter. Das Bett, das auf den ersten Blick wie ein normales Hotelbett aussieht, lässt sich elektrisch verstellen, wie ein Pflegebett. Von meinem Fenster aus habe ich einen atemberaubenden Blick über die City. Das Riesenrad London Eye sieht abends, wenn es von Scheinwerfern angestrahlt wird, bestimmt sensationell aus.
In der Lobby des Convention Centers sammeln sich die Arbeitsgruppen. Die traditionellen Ordenstrachten bieten einen exotischen Anblick. Von einfachen braunen Kutten, die mit einer einfachen Kordel geschnürt werden, über weiße Leinengewänder bis hin zu den prachtvollen Purpurornaten des Vatikans sind Trachten vertreten, die ich noch nie gesehen habe. Ich kann das Tatzenkreuz der Malteser erkennen, das koptische Balkenkreuz, dann ist auch schon Ende. Flammende Herzen, ein grünes Kreuz mit einem brennenden Herz, Schlangen, die sich um Kreuze winden, die meisten Ordenssymbole enthalten entweder ein Kreuz, ein Herz, oder beides. Cathy und Sylvia haben ebenfalls offizielle Ordenstracht angelegt: Weiße Tunika mit bodenlangen, weit geschnittenen Überwürfen aus einem cremefarbenen feinen Leinenstoff. Dazu bedeckt ein weißes Tuch ihr Haar, das auf der Schulter aufliegt. Es wird von einem Lederband gehalten und wirkt weniger wie der Schleier der Nonnen, eher wie das Kopftuch der Beduinen. Fällt das Licht aus einem bestimmten Winkel darauf, irisiert es in einem zarten Blauton. Am Kragen ist das Gewand mit einer Brosche verschlossen, die eine stilisierte Ringelblume darstellt. Mir fällt ein, dass die ersten Wundsalben aus Ringelblumenextrakt hergestellt wurden. Passt. Beim Laufen sehen unter dem bodenlangen Überwurf cremefarbene, bequeme Slipper hervor. Der ganze Habitus wirkt in seiner Schlichtheit unauffällig elegant. Die beiden tragen ihre Tracht mit einer Selbstverständlichkeit, als würden sie keine andere Kleidung kennen. Manche der anderen Teilnehmer wirken in ihrem Ornat regelrecht verkleidet, so als würden sie es nur zu sehr besonderen Gelegenheiten herausholen. So unglücklich, wie einige im wahrsten Sinne des Wortes aus der Wäsche gucken, stimmt das vermutlich sogar.
Mich hat Cathy in einen leichten, cremefarbenen Hausmantel gesteckt, der von vorn angezogen wird, wie ein OP-Mantel. Die Flügel des Mantels sind so lang, dass sie einmal um mich herum gewickelt werden können. Sie laufen mittig in ein Band aus, das mit einem lockeren Knoten den Mantel vorn zusammenhält. Der Mantel fließt locker um mich herum bis zu meinen Füßen. Da ich kein Ordensmitglied bin, trage ich keine Brosche. Dafür habe ich auf der linken Brustseite mit feinen Stichen die Ringelblume eingestickt.
In den vielen Gesprächen mit der Mutter Oberin sind wir uns darüber einig geworden, dass es für beide Seiten von Vorteil ist, wenn ich nicht in den Orden eintrete. Ich bin schlicht ein Lieferant, ein Subunternehmer, der seine eigene Arbeitskraft vermietet. Ordensmitglieder haben kein eigenes Vermögen und können folglich auch keine Firmen gründen. So habe ich den Status eines assoziierten Mitglieds. Ich werde für meine Dienste bezahlt, habe ein großzügiges Spesenbudget. Allerdings habe ich in Dingen, die den Orden angehen, weder Mitsprache-, noch Stimmrecht.
Der große Saal, in dem die Eröffnung des Kongresses stattfindet oder besser zelebriert wird, bietet ein buntes Bild. Pater John Meadows SJ betritt die Bühne. Die Societat Jesu, wie sich die Jesuiten selbst nennen, ist der größte kirchliche Männerorden. In Jeans, mit einem karierten Hemd unter einem Cordsakko, das schon einige Tage auf dem Buckel hat, wirkt er wie ein Exot gegenüber den anderen Kongressteilnehmern in ihren Ordenstrachten. Das Einzige, das ihn als Jesuiten ausweist, ist eine unauffällige kleine Anstecknadel aus Silber an seinem Revers. Sie stellt ein Kreuz mit den Buchstaben IHS in einem Strahlenkranz dar. I, H und S sind im Griechischen die ersten drei Buchstaben des Namens Jesus. Die Jesuiten leben und wirken eher unauffällig und tragen meistens Zivilkleidung. Nur beim Gottesdienst legen die geweihten Priester die liturgischen Gewänder an. Jesuiten werden auch mit dem Nachnamen angesprochen, nicht mit dem Vornamen, wie bei vielen anderen religiösen Gemeinschaften. Lediglich das an den Namen angehängte SJ für Societat Jesu lässt die Zugehörigkeit zu ihrem Orden erkennen.
Von jeher halten sich die Jesuiten auf dem technisch aktuellen Stand. Als die anderen Orden noch von Teufelswerk sprachen, hatten ihre Habitate schon elektrischen Strom. Der Orden Unserer Lieben Frau vom Rhein kooperiert schon seit langer Zeit mit den Jesuiten, speziell im technischen und im medizinischen Bereich.
Nach und nach zog die EDV auch in die kirchlichen Organisationen ein, meistens misstrauisch beäugt und deshalb auch oft nur halbherzig betrieben. Meistens waren die Netzwerke gar nicht oder nur schlecht gesichert. Nachdem immer mehr Geldbeträge ins Nirwana verschwanden, bat man die Jesuiten um Hilfe, die erst einmal die Hände über den Köpfen zusammen schlugen. Schnell war klar, dass es nicht ausreichen würde, die Systeme so schnell wie möglich abzusichern. Ohne eine gute Sensibilisierung und Schulung der Betreiber, wäre das nur eine sehr kurz wirkende Maßnahme. Technisch waren die kriminellen Elemente den klerikalen IT-Nutzern um Lichtjahre voraus.
Pater Meadows macht in seiner Ansprache keinen Hehl daraus, dass es nicht reicht, ein paar Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Es ist von essentieller Bedeutung, dass diejenigen, die für die Informationsverarbeitung zuständig sind, umdenken. Jede Organisation oder Vereinigung, die auf christlichen Prinzipien basiert, geht erst einmal davon aus, dass der Mensch in seinem Wesen gut ist. IT-Sicherheitsexperten dagegen schadet es nicht im Geringsten, wenn sie sich eine gewisse gesunde Paranoia zulegen. Ganz dreist hatte es ein Hacker in einem Benediktinerkloster getrieben. Der Netzwerkverwalter hatte ein WLAN-Netzwerk eingerichtet und auch sauber abgesichert. Ganz frech rief der Hacker den Abt an und gab sich als Mitarbeiter der Telefongesellschaft aus. Er könne dem Kloster eine höhere Übertragungsrate zum selben Preis anbieten, müsse dazu kurz die Leitung überprüfen. Dazu benötige er den Anmeldenamen und das Kennwort des Abtes. Einige Minuten später gehörte die Brauerei, die Haupteinnahmequelle des Klosters, einer Firma auf einem kleinen Atoll in Malaysia.
Gemeinsam mit Kathrin Vollbarth konnte ich dem verzweifelten Abt seine Brauerei wieder zurückholen. Der Hacker hatte mit der Naivität seiner Opfer kalkuliert und war im Laufe der Zeit immer sorgloser geworden. Bei dem Brauereihack hatte er es noch nicht einmal mehr für nötig gefunden, seine Spuren sauber zu verwischen. Über den Server der dortigen malaysischen Handelskammer konnten wir den Vorgang zurückverfolgen und korrigieren. Irgendwie muss uns dabei ein winziger Fehler unterlaufen sein, denn ein großer Teil des Firmenvermögens verschwand und tauchte mit dem Vermerk: “Anonyme Spende“ auf dem Konto einer dortigen Umweltschutzorganisation wieder auf. Keine Ahnung, wie das geschehen konnte. Einer von uns beiden muss wohl auf eine falsche Taste gedrückt haben. Kathrin hatte unsere Spur nicht verwischt. Ein guter Ermittler kann feststellen, ob jemand seine Spur verwischt hat und anhand der dabei verwendeten Techniken eine Art Handschrift des Angreifers feststellen. Wir haben nur ein paar Parameter geändert. Sollte jemand diese Spur zurückverfolgen, dann würde er erstaunt feststellen, dass sie bei einem öffentlichen Telefon im tibetanischen Hochland endet, unweit eines Klosters, das seit Jahrhunderten jeglichen technischen Fortschritt ablehnt.
Man kann ein Computernetz so sicher machen, wie es der technische Standard überhaupt zulässt. Gegen Social Engineering, also das Erschleichen von Anmeldeinformationen hilft nur ein Umdenken der Systembenutzer. Inzwischen haben die Klosterbrüder ihre sensiblen Daten zusätzlich noch biometrisch abgesichert.
***
Eins muss man Pater Meadows lassen, er ist ein phantastischer Rhetoriker. Schon nach den ersten Worten hören ihm die Leute gebannt zu. Geschickt garniert er die ziemlich trockenen Themen mit diversen Anekdoten. Spritzig erzählt er die Geschichte der geklauten Brauerei. „Einen der Akteure haben wir sogar heute hier. Er ist nicht nur IT-Sicherheitsexperte, er unterstützt in seiner Heimatstadt als Computerforensiker und Ermittler auch noch die örtlichen Behörden. Und dass, obwohl er nicht besonders gut zu Fuß ist. Er wird Ihnen in seinem Seminar zeigen, wie sie Angriffe nicht nur abwehren, sondern auch nachweisen können.“
Kathrin, ich mach dir die Ohren ab. Du hättest mich ja ruhig vorwarnen können. Nein, sie lässt mich voll ins Messer rennen.
„Liebe Freunde, ich präsentiere Ihnen Bruder Friedhelm Bender vom Orden unserer Lieben Frau vom Rhein.“ Begeistert applaudierend sieht sich die Menge um. Ja, ich weiß, in so einer Situation steht man höflicherweise auf und verbeugt sich. Das Verbeugen würde ich ja noch hinkriegen, wenn man mich dann auch gar nicht mehr sieht. Mit dem Aufstehen hapert‘s natürlich. Mit knallrotem Kopf hebe ich einen Arm und winke. Als die Umstehenden bemerken, warum ich nicht aufstehe, wird der Applaus deutlich leiser. Dafür geht ein Raunen und Tuscheln durch den Saal. Kleriker sind eben auch nur Menschen. Jedenfalls hat Pater Meadows es geschafft, mich auffällig unauffällig zu akkreditieren. Keiner der Anwesenden dürfte mehr daran zweifeln, dass ich mit Fug und Recht in dieses Plenum gehöre. Bei manchen Themen können Kleriker schon ziemlich elitär sein. Sylvia grinst von einem Ohr zum anderen. Na klar, sie wurde von ihrer Schwester natürlich eingeweiht. Cathy hat nasse Augen und presst ihre zuckenden Lippen aufeinander. Na toll, da habt ihr mich aber mal so richtig vorgeführt. Wobei – so gesehen, eleganter hätte man mich nicht einführen können. Aber trotzdem, die hätten ruhig etwas sagen können.
In der Zwischenzeit ist jemand anderes ans Mikrofon getreten, eine Nonne in traditioneller Ordenstracht. Sie spricht ein gut verständliches Englisch. Dass sie mit ziemlicher Sicherheit in Frankreich aufgewachsen ist, hört man kaum heraus. Pater Meadows ist inzwischen an unseren Tisch herangetreten.
„Hi, the Name is John.“ Auch ohne Verstärkung hat er eine sehr angenehme Stimme. „Oder sollen wir deutsch reden?“
Caitlin ist zweisprachig aufgewachsen, Sylvia und ich sind Computerleute. Lange Zeit gab es die guten Fachbücher nur in Englisch. „Hi John, this is Sylvia, the lady on the other side is Cathy, and I call myself Bender, just Bender.“ Noch nicht einmal meine Mutter nennt mich beim Vornamen.
„Das kann ich verstehen“, grinst John, „würde ich auch, wenn ich Friedwart hieße“. „Friehdwohrt“, spricht er es aus, mit diesem englischen R, bei dem man die Zunge so merkwürdig einrollen muss. Klingt noch schlimmer, als auf Deutsch.
Cathy prustet laut los, Sylvia kann sich gerade noch die Hand vor den Mund halten. Mir klappt der Unterkiefer herunter. Sehr professionell, wir machen unserem Orden mal wieder alle Ehre. Ist doch wahr, Mensch. Da geht man auf einen ernsthaften Kongress, trifft auch einen hochrangigen Vertreter des größten kirchlichen Männerordens und der flachst einen an, als wären wir Untertertianer in der großen Pause. Johns sympathisches Grinsen weicht einem sehr ernsten Gesicht. „Ich möchte ja nicht mit dem Tor ins Haus fallen, aber wir haben da ein winziges Problem. Da würde ich gerne deine Meinung hören, Bender“
Wenn ein Engländer schon bei der Begrüßung sagt, er hätte ein winziges Problem, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass er ein ganz klein wenig untertreibt. Und wenn er dann noch sagt, er würde gerne die Meinung eines Dritten hören, stehen ihm normalerweise seine Verdauungsprodukte bis Unterkante Oberlippe, rein bildlich gesprochen natürlich.
Pater John Meadows SJ hat kein winziges, er hat ein gewaltiges Problem. Alle persönlichen und wirtschaftlichen Daten der Jesuiten werden in einer Datenbank verwaltet. Schon seit Jahren. Inzwischen läuft diese Datenbank auf einem dezentralen Servercluster. Die Datendateien liegen auf einem zentralen iSCSI-RAID-51-Laufwerk, das mehrmals täglich gesichert wird. Professionelle Datenbanksysteme lassen sich schon lange sichern, ohne dass die Datenbankengine dafür offline geschaltet werden muss.
Der einzige Schwachpunkt der Anlage ist das zentrale Speichermedium. Die einzelnen Festplatten des Netzlaufwerks sind Hot-Plug fähig, lassen sich in vollem Betrieb tauschen. Zur Wartung hatte man die Spiegelung aufgehoben und einen Satz komplett neue Festplatten eingesetzt. Gerade, als die Synchronisierung gestartet werden sollte, war ein Bus gegen das Umspannwerk zwei Straßen weiter geprallt und hatte für einen sofortigen Stromausfall gesorgt, nachdem eine Überspannung von 14000 Volt für einige Millisekunden durch das Gebäude gerast war. Die sofort anspringenden Sicherungen hatten das Schlimmste verhindert. Fast.
„Look at that.“
Der Administrator, ebenfalls mit dem Zeichen der Jesuiten am Revers, hält uns mit traurigem Gesicht einen verschmorten Klumpen entgegen. Das war bis vor Kurzem der ganze Stolz der IT gewesen. Ein RAID-Laufwerk, das über das Netzwerk angesprochen und von einem Servercluster als gemeinsame Ressource akzeptiert werden konnte. Dasselbe stand noch einmal daneben, mit jungfräulichen Platten. Getreu dem alten Murphy war die Überspannung genau in dem Moment durch das Rechenzentrum gefegt, als die Daten ohne Redundanz auf nur einem RAID lagen. Die Struktur des Systems hätte den Ausfall einer weiteren Platte klaglos kompensiert. Dass die Sicherungen erst angesprungen waren, als das Laufwerk bereits zu einem massiven Kohleblock gebacken war, das war schlichtweg Pech.
„Wo liegen denn die Backups?“ Auf meine Frage hin zeigt sich ein zaghafter Hoffnungsschimmer auf den Gesichtern meiner Kollegen.
„Here you are!“
Stolz erzählt mir der Administrator, dass er sogar aus Sicherheitsgründen jährlich die Bänder des Bandlaufwerks austauscht. Hätte er mal das klein Gedruckte auf der Verpackung gelesen. Zugegeben, es ist wirklich sehr klein gedruckt, aber der Hersteller des Bandes garantiert 99,5%- ige Datensicherheit nur bei bis zu zehnmaliger Verwendung.
Das freudestrahlende Gesicht meines Gegenübers zeigt etwas Verwunderung, als ich aus einer Tasche ein Paar feine Leinenhandschuhe hole und mir überziehe. Ich öffne vorsichtig die Klappe, hinter der in der Kassette, das Band liegt, was die Verwunderung einem leisen Entsetzen weichen lässt. Dann ziehe ich vorsichtig das Band ein kleines Stück heraus und lasse einen leisen Pfiff hören. Auf dem Gesicht des Administrators wechselt das leise Entsetzen zur blanken Panik. Das Trägermaterial, das eigentlich mit Eisenoxid bedampft sein sollte zeigt die makellose Transparenz von frisch abgerolltem Tesafilm. Klar mehrmals täglich durch die Mechanik der Kassette und an den Schreib-Lese-Köpfen des Bandlaufwerks vorbei gezogen zu werden, das hält kein Band ein Jahr aus. Noch nicht mal einen Monat.
Sylvia beugt sich zu mir und flüstert mir etwas ins Ohr. Das Mädel ist gut, sie hat gleichzeitig mit mir dieselbe Idee. Ich schaue den Administrator an, dessen Namen ich immer noch nicht weiß. Die sonst so höflichen Engländer haben wirklich das obligatorische Vorstellungsritual vergessen, so ernst nehmen sie die Situation.
Ich nicke Sylvia zu, soll sie die Frage stellen, mal sehen, wo die Kollegen die Transaktionsprotokolle geparkt haben. Das war es nämlich, was sie mir geflüstert hatte.
Ein Wort nur: „Transaktionsprotokolle“.