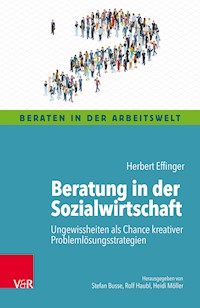
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
In der Sozialwirtschaft bewegt man sich im Spannungsfeld zwischen teilweise gegensätzlichen sozialen und ökonomischen Orientierungen, zwischen widersprüchlichen Regulationsprinzipien und Werten. Mehrdeutigkeit, Ambivalenz und Kontingenz gehören zum unauflösbaren Bestandteil des beruflichen Handelns in diesem Wirtschaftssektor und beeinflussen besonders die von wechselseitigem Vertrauen und institutioneller Macht abhängigen Arbeitsbeziehungen. Damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entscheidungs- und handlungsfähig bleiben, benötigen sie besondere Kompetenzen für das Zusammenspiel ihrer kognitiven und affektiven Bewältigungsstrategien. Das stellt Berater und Beraterinnen vor eine doppelte Herausausforderung. Sie sollen die Handlungskompetenzen ihrer Adressaten im Umgang mit Ungewissheit und Unsicherheit minimieren und geraten dabei selbst oft in paradoxe und unsichere Situationen. Herbert Effinger beschreibt die Besonderheiten intermediärer und hybrider Organisationen mit ihren gemeinschaftlichen, öffentlichen und kommerziellen Arrangements. Er benennt die widersprüchlichen Bezugspunkte sozialer personenbezogener Dienstleistungen und gibt Orientierungspunkte für Beratungsstrategien in diesem Handlungsfeld. Es geht darum, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen kreativen und akzeptierenden Umgang mit Widersprüchen zu ermöglichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben von
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Herbert Effinger
Beratung in der Sozialwirtschaft
Ungewissheiten als Chance kreativer Problemlösungsstrategien
Mit 7 Abbildungen und 2 Tabellen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällenbedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Mushakesa/shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6061
ISBN 978-3-647-90111-4
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
1 Ungewissheit als Risiko und Chance
2 Zwischen den Stühlen – Sozialwirtschaft als intermediäres und hybrides Hilfesystem
2.1 Sozial wirtschaften – wie geht zusammen, was meist getrennt gedacht wird?
2.2 Sozialwirtschaft und Sorgearbeit als System subsidiär-kompensatorischer Vergemeinschaftung in der Risikogesellschaft
2.3 Zum Charakter sozialer personenbezogener Dienstleistungen in der Sozialwirtschaft
2.4 Widersprüchliche Bezugspunkte und verunsichernde Faktoren in der Sozialwirtschaft
3 Herausforderungen für die Beratung
3.1 Bewältigung von Ungewissheit durch defensives Vermeidungsverhalten
3.2 Subjektivierendes Handeln und Selbstkompetenz als reflexive Erkundungsstrategie zur Ungewissheitsbewältigung
3.3 Das Selbst als regulative Instanz – eine persönlichkeitstheoretische Rahmung
3.4 Elemente entwickelter Selbstkompetenz
3.5 Perspektiven der praktischen Umsetzung in Beratung und Selbsterfahrung
4 Fazit: Beratung im Bündnis mit Kairos
Literatur
Danksagung
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Beratende und Personalverantwortliche, die Beratung beauftragen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen, und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforschende, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mitgestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leserinnen und Lesern die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen, als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe werden Themen bearbeiten, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So werden die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen nochmals offerieren und aufbereiten, sondern sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt bewegen. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und schulenübergreifend, in der nicht einzelne Positionen prämiert werden, sondern zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene angeregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
1 Ungewissheit als Risiko und Chance
Die Bewältigung von Ungewissheit und damit verbundene Gefühle von Unsicherheit und Angst gehören für alle Menschen zum Alltag. Täglich finden wir uns in Situationen, in denen wir herausgefordert sind, eine Entscheidung zu treffen, ohne sicher zu sein, ob das auch die richtige ist. Wenn wir eine Situation gut einschätzen können und uns genügend Informationen vorliegen, können wir Vor- und Nachteile möglicher Handlungen abwägen und so eine rational naheliegende Entscheidung treffen. Ist uns eine Situation bekannt, können wir auf unsere Routinen zurückgreifen, ohne darüber nachzudenken. Auch bei plötzlich auftretenden Gefahren entscheiden wir zumeist intuitiv oder reflexartig und ohne nachzudenken. Aber längst nicht alle Ungewissheiten lassen sich rational, routiniert oder reflexartig bewältigen. Ungewissheiten, die sich im Zusammenleben von Menschen ergeben, die kommunikationsabhängig sind und von subjektiven Bewertungen und Bedeutungen abhängen, fordern besonders jene heraus, deren Arbeit darin besteht, Menschen in schwierigen und komplexen Situationen und bei ihrer Lebensführung zu unterstützen und für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu sorgen.
Diese Tätigkeit des Sorgens und Sichkümmerns wird seit einiger Zeit auch als Care-Work oder Sorgearbeit bezeichnet. Dabei handelt es sich um überwiegend von Frauen verrichtete, unbezahlte und bezahlte Erziehungs-, Pflege-, Betreuungs- und Sozialarbeit, die ursprünglich allein im Rahmen von Gemeinschaft und privaten Haushalten verrichtet wurde (Aulenbacher u. Dammayr, 2014). Es ist eine Arbeit, die wesentlich durch die Art der Beziehung zwischen den Sorgenden und den Versorgten geprägt ist. Im Allgemeinen wird Sorgearbeit als ein Oberbegriff für bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten »unabhängig von Gegenstand und Art der Sorge und unabhängig von den Organisationsformen (unbezahlt/bezahlt, informell/formell, privat/professionell, Ehrenamt/Erwerbsarbeit« verwendet (Sachverständigenkommission, 2017, S. 35). Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus primär auf den bezahlten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die als Erwerbstätige in der Sozialwirtschaft beschäftigt sind und sich dort um die Bedürfnisse und Sorgen anderer Menschen kümmern.1
Beratung ist eine personen- und organisationsbezogene, kommunikationsbasierte Dienstleistung, die von Supervisorinnen, Mediatoren, Konflikt- und Organisationsberaterinnen oder Coaches angeboten wird. In der Sozialwirtschaft helfen sie ihren Kunden, den Sorgearbeitenden, bei der Bewältigung der Aufgaben, die sich ihnen im Kontext ihrer beruflichen Praxis zeigen (Zwicker-Pelzer, 2010, S. 13 ff.).2 Für die Beratung stellt das eine doppelte Herausforderung dar:
– Berater und Beraterinnen sollen Gefühle von Ungewissheit und Unsicherheit von Mitarbeitenden reduzieren helfen, die andere bei deren Ungewissheitsbewältigung unterstützen.
– Zum Beginn oder im Verlauf eines Beratungsprozesses gerät man aber als Berater oder Beraterin leicht an einen Punkt, an dem man nicht so recht weiß, um was es in diesem Fall oder in dieser Organisation eigentlich geht. Erstinformation und Auftrag stimmen manchmal nur bedingt mit der erlebten Situation in der Beratung überein. Das vorhandene Wissen über Organisationen und Personen passt nicht, um die Situation zu verstehen, und man spürt irgendwie, dass es da noch verdeckte Aufträge gibt.
Sorgearbeiter in der Sozialwirtschaft haben es oft mit besonders komplexen Problemlagen ihrer Adressaten zu tun. Manchmal ist auch unklar, ob sie einen Auftrag von ihren Adressaten erhalten und um welchen Auftrag es sich genau handelt. Diese Ungewissheit ist typisch für Organisationen, die sich in vielerlei Hinsicht von klassischen Betrieben in der Wirtschaft oder der öffentlichen Verwaltung unterscheiden. Die Sozialwirtschaft wird von sehr unterschiedlichen bis gegensätzlichen Interessen und Regulationsprinzipien geprägt. Die Lehrbücher in der Aus- und Weiterbildung von Beratenden sind aber größtenteils auf die marktwirtschaftlichen Betriebe und Organisationen ausgerichtet, deren Komplexitätsphänomene und -probleme viel stärker von den Strukturen größerer Organisationseinheiten und den Dynamiken des Marktes geprägt werden. In der Sozialwirtschaft haben wir es dagegen mit einem Orchester ganz unterschiedlicher und teilweise auch gegensätzlicher Systemlogiken zu tun – wo man nicht so recht weiß, wer gerade dirigiert und ob es vielleicht mehrere Dirigenten gibt –, welche die Sorgearbeitenden regelmäßig in kognitive Dissonanz und Handlungsdilemmata versetzen.
Aktuelle Gesellschaftsanalysen beschreiben moderne Gesellschaften vor allem dadurch, dass diese immer komplexer und unübersichtlicher werden. Das wird mit Begriffen wie »Risikogesellschaft« (Beck, 1986) oder »Entscheidungsgesellschaft« (Schimank, 2005) gekennzeichnet. Gemeinsames Merkmal all dieser Diagnosen ist die Zunahme von Komplexität sowie eine damit verbundene »neue Unübersichtlichkeit« (Habermas, 1985). Mit dem »Ende der Eindeutigkeit« (Bauman, 2003, 2005, 2008) entstehen demnach neue Formen von Unsicherheit und Ambivalenz. Einige Autoren fokussieren eher auf die damit verbundenen Gefahren und sprechen von einer »Gesellschaft der Angst« (Bude, 2014), andere rücken eher die mit diesem Wandel verbundenen Chancen in den Vordergrund (Evers u. Novotny, 1987; Böhle, 2012; Böhle u. Busch, 2012; Nassehi, 2017).
So haben wir es mit einer paradoxen Situation zu tun. Spätestens seit der Aufklärung haben Wissenschaft und Vernunft die zentrale Aufgabe, Ungewissheit so weit wie möglich zu reduzieren. Damit soll unser Leben autonomer, leichter und sicherer werden. Das war und ist bisher durchaus eine Erfolgsgeschichte, auch wenn es einige Schattenseiten, unbeabsichtigte Nebenfolgen und Risiken zu vermerken gibt. Der Rationalisierung sind aber offensichtlich deutliche Grenzen gesetzt. Individuen und soziale Prozesse lassen sich nicht wie Maschinen steuern. Das gilt besonders für demokratische Gesellschaften, welche sich durch sozial- und rechtsstaatlich garantierte Freiheiten auszeichnen. Menschen gelten zwar als vernunftbegabt, gleichwohl handelt es sich bei ihnen selbst um recht komplexe und nur bedingt berechenbare Wesen. Die Zunahme komplexer Situationen und damit verbundener Ungewissheit und Unsicherheit ist nicht nur eine Folge zunehmender gesellschaftlicher Ausdifferenzierung und Arbeitsteilung, sondern auch eine Folge zunehmender politischer, ökonomischer, kultureller und sozialer Freiheiten des Einzelnen. Die Ausweitung und Zunahme der Freiheiten und Möglichkeiten geht offenbar mit einer »Furcht vor der Freiheit« einher (Fromm, 1941/2017). Beratung in diesem Kontext ist darum weit mehr als eine bloße Rationalisierungsstrategie.
Der Auf- und Ausbau der Sozialwirtschaft steht in unmittelbarer Wechselwirkung mit der Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften und den damit verbundenen Folgeerscheinungen. Mit der Erweiterung unserer Handlungsmöglichkeiten ist immer auch eine Zunahme von Orientierungsproblemen und Entscheidungszwängen verbunden. Zunehmende Wahlfreiheit verstärkt den Zwang zur Entscheidung und kann eine Selbstaufgabe oder eine Abgabe von Selbstverantwortung befördern, wenn sie mit starken Überforderungsgefühlen und Ängsten bei der Entscheidungsfindung verbunden ist. Dann steigt die Neigung, andere für sich entscheiden zu lassen, die man dann ggf. für subjektiv nachteilig empfundene Entscheidungen verantwortlich machen kann.
Diese Erkenntnis setzt sich auch im Management und in der Beratungslandschaft immer mehr durch. In der neueren Management- und Beratungsliteratur ist von der VUKA-Welt die Rede. Dieses Akronym steht für Volatilität oder Unbeständigkeit, Unsicherheit und auch Disruption, Komplexität und Ambiguität oder auch Mehrdeutigkeit (Buhl, 2015; Mack, Kahre, Krämer u. Burgartz, 2015).3 Ob damit tatsächlich ein neues Phänomen beschrieben wird oder ob damit nur auf etwas verwiesen wird, was im Management und in der Beratungswissenschaft bisher eher am Rande behandelt wurde, sei zunächst dahingestellt. In der Sozialwirtschaft war das immer schon ein Thema. Seit jeher gibt es hier das Problem, nicht genau zu wissen, worum es geht und wie eine Intervention letztlich ausgeht. Diese Ambiguitätsund Kontingenzproblematik, nicht genau zu wissen, was ist, was wie wirkt und was die ungewollten Nebenwirkungen einer Intervention sein könnten, ist viel älter als die gegenwärtige Debatte um die sogenannte VUKA-Welt (siehe Dewey, 1929/2013).
Spätestens seit den 1980er Jahren gehört dies zu den zentralen Diagnosen des gesellschaftlichen Wandels. Die Diskurse um »Neue Steuerung« und evidenzbasierte soziale personenbezogene Dienstleistungen (Borrmann u. Thiessen, 2016) brachten ein paar Jahre später Sozialmanagement, Controlling und andere betriebswirtschaftlich ausgerichtete Konzepte hervor, welche vor allem darauf ausgerichtet sind, sogenannte VUKA-Phänomene durch mehr und bessere Planung und Managementkonzepte zu beherrschen. Misserfolge dieser Strategien und anhaltende Widerstände gegen diese Art der Technologisierung, Manageralisierung und Ökonomisierung des Sozialen gibt es bis heute. Allerdings scheint sich erst langsam ein Diskurs über die Chancen des Umgangs mit Unsicherheit und daraus abgeleiteten Interventions- und Copingstrategien zu entwickeln (Conen, 2008; Heiner, 2010a, 2000b; Kleve, 2016; Effinger, 2008; Preis, 2013). In den Bereichen, in denen weder die Verwissenschaftlichung noch die Technologisierung zu wesentlich mehr Sicherheit in der Praxis beigetragen hat, greifen viele Sorgearbeitende in ihrer Praxis auf ihre persönlichen Alltagstheorien und Bewältigungsstrategien zurück, mit denen sie hoffen, Ungewissheiten und unkalkulierbaren Risiken aus dem Wege gehen zu können.
Wenn hier von zunehmender Komplexität und Unübersichtlichkeit die Rede ist, dann ist damit auch gemeint, dass die sich erkennbaren und beinflussbaren Grundlagen und Regeln der Steuerung immer schneller verändern. Wir haben es also mit Komplexitäts- und Beschleunigungsphänomenen zu tun (Rosa, 2013). Regeln, die eben noch galten, werden wenig später schon als nicht mehr selbstverständlich angesehen. Viele sehen das eher als Bedrohung und weniger als einen Ermöglichungsraum. Sie sehnen sich dann in alte, scheinbar überschaubarere und gemächlichere Zeiten zurück. Eine solche, gegen die Entwicklung gestellte Perspektive mag verständlich sein, erscheint aber nicht besonders realistisch. Darum plädieren immer mehr Autoren und Autorinnen dafür, sich konstruktiv mit VUKA-Phänomenen zu beschäftigen und sie jenseits traditioneller Selbstverständlichkeiten für kreative Pfade des Denkens und Gestaltens moderner Gesellschaften und individueller Lebensführung zu nutzen. So fragt Nassehi (2017, S. 3 f.): »Was muss man tun, um Steuerungsstrategien nicht gegen die Kraft der komplexen Gesellschaft zum Einsatz zu bringen, sondern mit ihrem eigenen Drive, mit der Dynamik ihrer eigenen Struktur, ihrer eigenen Zugzwänge, etwas zu erreichen – ganz so wie ein asiatischer Kampfsportler den Drive seines Gegners aufnimmt und mitgeht, um ihn zu besiegen, und nicht einfach zerstörerisch dagegenhält.«
In diesem Text geht es um die Frage, worin die besonderen Ungewissheiten und Verunsicherungspotenziale der Mitarbeitenden in der Sozialwirtschaft bestehen, welche Bewältigungsstrategien dafür häufig anzutreffen sind und wie Beratung Sorgearbeitende in diesem Handlungsfeld dabei unterstützen kann, mit diesen Phänomenen kreativer und produktiver umzugehen. Dabei wird der äußere Kontext in Gestalt sozialer Systeme der Sozialwirtschaft mit dem inneren Kontext in Gestalt der psychischen Systeme der handelnden Personen – ihrer biografisch und beruflich sozialisierten Bewältigungsmuster – in Beziehung gesetzt. In Studium und Ausbildung für soziale Berufe werden die biografischen und milieuspezifischen Muster oft nur am Rande thematisiert (Effinger, 2005a, 2005b, 2012, 2015, 2017). Und in der Beratungswissenschaft spielen die Besonderheiten der Sozialwirtschaft eine untergeordnete Rolle. Wenn Beratende sich aber nicht mit den Besonderheiten der Sozialwirtschaft vertraut machen und von unpassenden Kontexteinschätzungen ausgehen, geraten sie in den Beratungsprozessen leicht in die Gefahr, misszuverstehen und missverstanden zu werden.
Vor diesem Hintergrund stellen sich also besondere Herausforderungen für Berater und Beraterinnen in diesem Handlungsfeld. Sie können meines Erachtens weder mit den klassischen Management-theorien, die sich vor allem auf die rein kommerzielle Profitwirtschaft beziehen, noch mit psychotherapeutischen Konzepten befriedigend bewältigt werden. Es gibt zwar eine umfängliche Literatur zum Sozial-management (Badelt, 2013; Brinkmann, 2010; Grundwald, Horcher u. Maelicke, 2013), aber es fehlt an spezifischen, auf die Besonderheiten der Sozialwirtschaft ausgerichteten Beratungsansätzen. Es fehlt an einer Verknüpfung sozialpolitischer Prämissen der Wohlfahrtsproduktion mit den für diesen Bereich typischen Bewältigungsmustern von Wohlfahrtsproduzenten und -konsumenten. Dafür braucht es mehr als nur betriebswirtschaftliches Wissen:
– Es braucht einerseits Wissen darüber, wie sozialwirtschaftliche Systeme funktionieren und wie die besonderen Bedingungen dieses Funktionssystems auf die Sorgearbeiterinnen wirken.
– Es braucht andererseits auch Wissen darüber, wie das Zusammenspiel bewusster und rationaler Erwägungen mit den eher unbewussten emotionalen Anteilen an Entscheidungen funktioniert und gestaltet werden kann. Dieser Text soll vor allem helfen, sich mit der Spezifik von Entscheidungsdilemmata in diesem Bereich vertraut zu machen.
Im Rahmen dieser Reihe muss das noch auf einer theoretischen Ebene des Verstehens bleiben. Für die Leser und Leserinnen soll dieser Text eine erste Orientierungshilfe sein, der Anregungen zur Selbstreflexion gibt und hier und da Perspektiven für die Gestaltung der Beratungspraxis in diesem Feld aufzeigt.
1 Im Folgenden bezeichne ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Sozialwirtschaft alternativ mit dem Begriff Sorgearbeiter bzw. Sorgearbeiterin. Um gendergerechte Schreibweise bemüht, wechsele ich willkürlich zwischen weiblicher und männlicher Form, gemeint sind immer alle Geschlechtsidentitäten.
2 In der einschlägigen Literatur werden ganz unterschiedliche Definitionen von Beratung angeboten. Sie beschäftigen sich vor allem mit der Abgrenzung gegenüber reiner Informationsvermittlung, Therapie, Pädagogik, Sozialer Arbeit oder anderen Professionen, die kommunikationsbasiert personbezogene Dienstleistungen anbieten. Stellvertretend sei hier auf Nestmann, Engel und Sickendiek (2007/2013), Zwicker-Pelzer (2010), Bamberger (2015) sowie Levold und Wirsching (2017) verwiesen.
3 VUKA steht seit wenigen Jahren als Akronym für einen Paradigmenwechsel im Bereich der kommerziellen Wirtschaft und Managementtheorien. Ursprünglich war das ein Begriff aus dem politisch-militärischen Kontext, der nach dem Zusammenbruch der UdSSR am US Army War College eingeführt wurde, um die neue Unübersichtlichkeit nach dem Ende des Kalten Krieges zu beschreiben.
2 Zwischen den Stühlen – Sozialwirtschaft als intermediäres und hybrides Hilfesystem





























