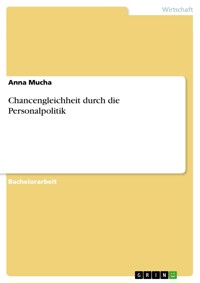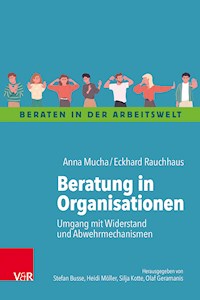
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Augenrollen, Stöhnen, Widerstand – Nutzen Sie die Weggefährten organisationaler Veränderung in Beratung und Personalführung! Verstehen und adressieren Sie oft unbewusste Abwehrmechanismen und setzen Sie Potenzial frei. Denn Abwehrmechanismen sind automatisierte, unbewusste Lösungsstrategien. Sie schützen die Psyche vor Angst und Überforderung und halten sie im Gleichgewicht. Je gefährlicher sich die äußere Welt anfühlt, desto präsenter und wichtiger werden Widerstand und Abwehr. Die zunehmende Geschwindigkeit von Change-Prozessen und Transformationen verlangen Beschäftigten und Führungskräften viel ab. Nach einer theoretischen Reflexion zeigen Anna Mucha und Eckhard Rauchhaus anhand von Schlüsselsituationen aus Personalarbeit und Beratung die praktische Bedeutung der individuellen und kollektiven Abwehrmechanismen in Organisationen auf. Die Leserinnen und Leser lernen, Widerstand als Ressource zu verstehen, die sie konstruktiv ansprechen und nutzen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben von
Stefan Busse, Heidi Möller, Silja Kotte und Olaf Geramanis
Anna Mucha / Eckhard Rauchhaus
Beratung in Organisationen
Umgang mit Widerstand und Abwehrmechanismen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2021, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Vectomart/shutterstock.com Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6061
ISBN 978-3-647-99450-5
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Vorwort
1Widerstand und Abwehrmechanismen
1.1Widerstand: Verteidiger des Gewohnten und Vertrauten
1.2Abwehrmechanismen: Intrapsychischer Umgang mit unangenehmen Empfindungen
1.3Abwehrmechanismen zwischen Pathologie und Anpassungsleistung
2Abwehrmechanismen in der Organisation
2.1Verdrängung – Unangenehmes wird von der inneren Bühne verbannt
2.2Verleugnung – die Bedeutung eines Sachverhalts wird ausgeklammert
2.3Rationalisieren – Rechtfertigen mit vernünftigen Argumenten
2.4Projektion – eigene Affekte und Impulse werden anderen zugeschrieben
2.5Wendung gegen das Selbst – sich selbst die Schuld geben
2.6Verschiebung – Sündenböcke suchen oder auf Nebensächlichkeiten ausweichen
2.7Regression und Progression – Flucht in Vergangenheit und Zukunft
2.8Reaktionsbildung – gegenteilige Gefühle werden erzeugt
2.9Identifikation mit dem Angreifer – Angriff ist die beste Verteidigung
2.10Intellektualisieren – Flucht vor dem Erleben in die Abstraktion
2.11Isolierung vom Affekt und Isolierung aus dem Zusammenhang
2.12Magisches Denken und Ungeschehenmachen
2.13Idealisierung und Entwertung – Himmel und Hölle
2.14Ausagieren – impulsiv aus der Rolle fallen
3Kollektive Abwehr in Organisationen
3.1Interpersonale Abwehr: Aufbau gemeinsamer Schutzsysteme
3.2Institutionalisierte Abwehr: Normen, Standards, Rituale und Narrative
4Erkennen von Abwehr – Umgang mit Abwehr
4.1Das Problem der Tarnung: Ist es Abwehr oder Realität?
4.2Der Umgang mit Abwehr: Raum geben und die Angst adressieren
5Fazit: Abwehr als Perspektive und Lernfeld
5.1Abwehr ist normal und allgegenwärtig
5.2Die eigene Abwehr als Sparringspartnerin nutzen
6Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Berater/-innen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforscher/-innen, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mit gestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leser/-innen, die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe werden Themen bearbeiten, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So werden die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen nochmals offerieren und aufbereiten, sondern sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt bewegen. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und Schulen übergreifend, in der nicht einzelne Positionen prämiert werden, sondern zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene anregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Heidi Möller, Silja Kotte und Olaf Geramanis
Vorwort
Abwehrmechanismen sind automatisierte unbewusste Lösungsstrategien, die dazu dienen, das Bewusstsein vor Angst, Schmerz und inneren Konflikten zu schützen. Wenn man um sie weiß, werden so manch irritierender Prozess, vermeintlich unerklärliche Situationen und Dynamiken, Missverständnisse und Reibungsverluste in Organisationen und im Rahmen der organisationalen Beratung verstehbarer. Abwehrmechanismen sind eigentlich Schutzmechanismen: Unbewusst eingesetzt schützen sie die Psyche vor Angst und Überforderung und halten sie im Gleichgewicht. Angst und Überforderung sind in unserem Leben allgegenwärtig und analog dazu sind auch die Abwehrmechanismen ein ubiquitäres Phänomen. Jeder Mensch setzt sie ein, ein »Leben ohne Abwehrmechanismen ist nicht denkbar« (König, 2007, S. 11). Das gilt privat ebenso wie für den beruflichen Kontext. »Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen«, ist ein bekanntes Zitat von Max Frisch (1967, S. 100). In Organisationen arbeiten Menschen, die sich selbst mitbringen – ihre Stärken und Schwächen, ihre Kompetenzen und ihre ganz persönliche Geschichte, ihre Ängste und ihre Abwehrstruktur. Gleichzeitig schüren Organisationen selbst Ängste und bieten dafür – wie wir später sehen werden – spezifische Abwehrmöglichkeiten an (Beumer, 2011).
Abwehrmechanismen werden für das Innere umso wichtiger, je gefährlicher sich die äußere Welt anfühlt. Die Geschwindigkeit, mit der sich Unternehmen und Betriebe wandeln, nimmt ständig zu: Mit dem Schlagwort der VUCA-Welt wird beschrieben, dass die Rahmenbedingungen von Volatilität (Volatility), Unsicherheit (Uncertainty), Komplexität (Complexity) und Ambiguität (Ambiguity) gekennzeichnet sind (Brückner u. von Ameln, 2016). Treiber dieser Entwicklung sind z. B. demographischer Wandel, Globalisierung und Digitalisierung – bzw. »digitale Transformation« (Krapf, 2019), ein Begriff, mit dem die Wucht der Veränderungen noch einmal unterstrichen wird. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Beschäftigten. Galt es früher, Arbeitsvorgänge zu objektivieren, wird Subjektivität heute als Ressource betrachtet: Arbeitnehmer*innen sollen ihr Engagement und ihre Kreativität einbringen und hochidentifiziert mit ihren Arbeitszielen sein. Das bedeutet im besten Fall Selbstverwirklichung (Sauer, 2012), vor allem jedoch einen hohen Erwartungsdruck, so dass »Entfaltung und Gefährdung, erweiterte Selbstbestimmung und internalisierte Selbst-Beherrschung […] nah beieinander [liegen]« (S. 11; vgl. auch Jansen 2000; Haubl & Voß, 2009).
All diese neuen Anforderungen können Unsicherheiten auslösen. Schneller Wandel kann Ängste schüren und die sicher geglaubte Identität brüchig werden lassen. Sich auf Neues einzulassen und zu lernen, erfordert Ambiguitäts- oder Frustrationstoleranz. Rückschläge und Risiken müssen emotional ausbalanciert und die Unsicherheit, ob die Aneignung gelingt, ausgehalten werden. Über die dafür notwendige Selbststeuerung und ein lern- und entwicklungsförderliches Selbstkonzept – im Sinne der »mentalen Modelle, die Lernende von sich selbst haben« (Finkenzeller & Riemer 2013, S. 10) – verfügen Menschen in unterschiedlichem Maße. Nicht jedes Selbstbild trägt gleich gut zum Erfolg in ungewissen Lern- und Entwicklungsumgebungen bei (Moschner & Dickhäuser, 2010; Markus, 1983): Bereitschaft und Zutrauen, souverän unter unsicheren, komplexen Bedingungen agieren zu können, sind ungleich verteilt.
Schüler*innen und Studierende zeigen Stärke beim Umgang mit Herausforderungen besonders dann, wenn sie komplexen Anforderungen und Ambiguität innere Stabilität und ein tief verankertes Vertrauen in das eigene Leistungsvermögen entgegensetzen können. Studierende dagegen, die diese Disposition nicht biographisch erworben haben, verlassen in solchen Momenten ihre Komfortzone (Bremer & Bittlingmayer, 2008). Im Zuge des immer schnelleren organisationalen Wandels und der Anforderung des lebenslangen Lernens werden Menschen jeden Alters in Organisationen wieder zu Schüler*innen und Studierenden. Der Einsatz von Abwehrmechanismen – als Antwort des Selbst auf Angst und Überforderung – kann hier ganz besonders wichtig werden. Berufliche Veränderungen – seien es agile Entwicklungen in der Arbeitsumgebung, die Einführung eines neuen IT-Systems, Jobwechsel oder ein Aufstieg in der Hierarchie – verlangen dem Selbst etwas ab. Die Führungsrolle anzunehmen und auszufüllen, zum eigenen Stil zu finden und sich dabei – auch und gerade persönlich – weiterzuentwickeln, kann Menschen an ihre Grenzen bringen. Von daher spielen Widerstand und Abwehrmechanismen nicht nur bei der Begleitung von Change-Prozessen, sondern auch und gerade im Führungskräftecoaching eine ausschlaggebende Rolle.
Im vorliegenden Band wollen wir die Bedeutung des Konzepts Widerstand und damit einhergehender Abwehrmechanismen theoretisch reflektieren und anhand von Schlüsselsituationen der Beratung und Personalarbeit für Coaches, Supervisor*innen und Personalverantwortliche darstellen. Dabei nehmen wir sowohl individuelle Abwehrmechanismen als auch kollektive Muster der Abwehr in den Fokus, die eng mit organisationskulturellen Aspekten verknüpft sind (Möller et al., 2015). Die Phänomene Abwehr und Widerstand können in der Beratung auf mehrfache Weise relevant und die entsprechende Kompetenz mit denselben umzugehen bedeutsam werden. Beispiele sind:
▶Der oder die Klient*in berichtet von Situationen, in denen sich Vorgesetzte, Mitarbeiter*innen oder Kolleg*innen so verhalten, dass sich der Gedanke an Abwehrmechanismen nahelegt. Dann ist es für Berater*innen hilfreich, dies erkennen bzw. als Hypothese formulieren und einordnen zu können. Zudem kann es je nach Anliegen sinnvoll sein, Klient*innen das Konzept der Abwehr zu vermitteln, für ihr eigenes (Führungs-)Handeln fruchtbar zu machen und als Perspektive anzubieten bzw. auf Basis dieser Perspektive gemeinsam weiterzudenken.
▶Der oder die Berater*in gewinnt durch Zuhören und Nachfragen den Eindruck, dass der oder die Klient*in bestimmte Inhalte abwehrt. Dann gilt es, mit dieser möglichen Abwehr konstruktiv umzugehen, sie als Hypothese im Kopf zu behalten, wenn möglich das Gefühl hinter der Abwehr zu adressieren und ggf. gleich oder zu einem späteren Zeitpunkt zu eruieren, inwiefern der Eindruck der Abwehr mit dem oder der Coachee besprochen werden kann.
▶Der oder die Berater*in sieht sich, z. B. im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses, eines Workshops etc. mit Widerstand und vermeintlichen Abwehrmechanismen von Organisationsmitgliedern bzw. Teilnehmer*innen konfrontiert. Dann gilt es, mit dieser Abwehr konstruktiv und ggf. strategisch umzugehen. Das bedeutet – je nach Situation und Auftrag – das Gefühl hinter der Abwehr zu adressieren und die Gruppe zu schützen. Zudem ist es im Rahmen der Organisationsentwicklung bedeutsam, kollektive Abwehrmuster in den Blick zu nehmen.
Wenn wir uns in diesem Band mit dem Phänomen der Abwehrmechanismen beschäftigen, legen wir den Fokus damit auf die unbewusste Regulation von Angst und Überforderung und nehmen eine spezifische Perspektive ein – frei nach dem Motto, dass man »in Organisationen immer das [sieht], was die Brille des eigenen Forschungsparadigmas nahelegt« (Küpper & Felsch, 2000, S. 153). Dass Abwehrmechanismen allgegenwärtig sind, bedeutet natürlich nicht, dass jedes Verhalten, das wir an anderen irritierend, überraschend oder ärgerlich finden, auf einen Abwehrvorgang hindeuten muss. Ziel des vorliegenden Bandes ist es, die Sensibilität für die Abwehr zu schärfen. Die Abwehrmechanismen sollen für die organisationale Beratung fruchtbar gemacht und Berater*innen, Personaler*innen, Führungskräften und Beschäftigten das Erkennen von Abwehrmechanismen und der konstruktive Umgang mit ihnen erleichtert werden. Dabei steht besonders die Angstreduktion der abwehrenden Person oder Gruppe im Fokus. Optimalerweise tragen Beratungsformen wie das Coaching zur Abmilderung bzw. positiven Veränderung der Abwehr bei (Möller et al., 2015) – aber dazu später mehr.
In Kapitel 1 beschreiben wir die Phänomene Widerstand und Abwehrmechanismen zunächst auf der konzeptionellen Ebene. Wir fundieren die beiden in der psychoanalytischen Theorie geprägten Begriffe und zeigen, welche produktiven Funktionen Widerstand und Abwehrmechanismen übernehmen. Wir stellen dar, wie allgegenwärtig, notwendig und alltäglich Widerstand und Abwehr sind – nicht nur im therapeutischen Feld, aus dem ein Großteil der Abwehrliteratur stammt, sondern auch und gerade im beruflichen Kontext. Der Begriff des Widerstands wird im Zusammenhang mit Change-Prozessen vielfach verwendet, Abwehrmechanismen dagegen sind unter Berater*innen, Führungskräften und Personaler*innen unserer Erfahrung nach weniger bekannt.
In Kapitel 2 stellen wir klassische Abwehrmechanismen vor und illustrieren sie an Beispielen aus dem organisationalen Alltag und der Coachingpraxis. Abwehrmechanismen sind eine Deutungskategorie: Sie müssen interpretativ und aus dem Kontext heraus erschlossen werden. Ziel des Kapitels ist es, einen Überblick über die bunte Palette möglicher Abwehrmechanismen zu bieten, die zwar alle dasselbe Ziel verfolgen – sie schützen das Selbst vor negativen Empfindungen und psychischem Ungleichgewicht – in ihrer Gestalt jedoch unsystematisch und vielfältig daherkommen. Indem wir eine möglichst große Varianz an Abwehrmechanismen beschreiben, wollen wir eine breite Heuristik anbieten, die ein (Wieder-)Erkennen der verschiedenen Mechanismen im Arbeitsalltag von Führungskräften, Personaler*innen und Coaches ermöglicht.
In Kapitel 3 betrachten wir die kollektive bzw. die institutionalisierte Abwehr. Abwehr findet nicht nur individuell und intrapsychisch statt, sondern auch im Bezug aufeinander und kulturell verankert: Teams, Abteilungen und ganze Organisationen wehren ab. Für die Beratung und die Begleitung von Veränderungsprozessen ist dies besonders bedeutsam: Aus der Abwehrperspektive kann verstehbar werden, warum sich bestimmte irrationale Praxen und Verhaltenswei