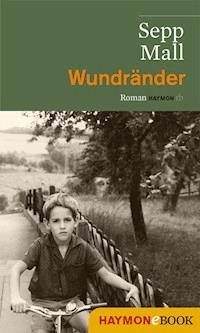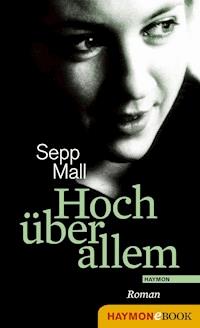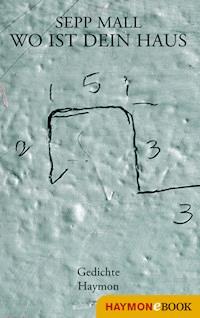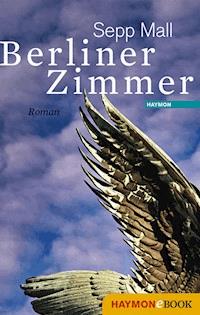
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als sein Vater stirbt, wird Johannes erst bewusst, wie viele Fragen er zeitlebens versäumt hat, ihm zu stellen. Doch lässt ihn das unbestimmte Gefühl nicht los, dass es dafür noch nicht zu spät ist, und er begibt sich auf dessen Spuren nach Berlin. Dort nämlich hatte sein Vater als junger Soldat während des Zweiten Weltkriegs eine Liebesbeziehung zu einer Frau, von der niemand in der Familie bislang wusste. Tatsächlich gelingt es Johannes, die Frau ausfindig zu machen, er trifft sie - und kommt seinem Vater näher als je zuvor. Berührend und mit feinem Sinn für die Zwischentöne beschreibt Sepp Mall die behutsame Annäherung eines Sohnes an seinen Vater und erzählt von einer Liebe, die den Tod überwindet. Er nimmt den Leser mit auf eine Reise in das Berlin von damals und heute und öffnet ihm die innere Welt einer Figur, die sich hartnäckig dagegen wehrt, dass der Tod eines Menschen seine Auslöschung bedeutet."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Sepp Mall
Berliner Zimmer
Roman
1
Vater war seit zwei Monaten und etlichen Tagen tot, auf seinem glänzend weißen Grabstein balgten sich die ersten Tauben und die Welt hatte sich weitergedreht. Die Amerikaner waren vorgedrungen bis nach Bagdad, der Ölpreis stieg in schwindelnde Höhen und über unserer Stadt hörte es in diesem Frühjahr nicht mehr auf zu regnen.
Ein Atlantiktief nach dem anderen zog über den Rand des Kontinents herein, kreiste um seine eigene Achse und kam nicht von der Stelle. Die jungen Mädchen vom Wetterbericht lächelten und versprachen allabendlich Besserung, aber es blieb bei den Versprechungen. Überall stiegen die Pegel, das Militär legte Sandsäcke aus, und doch traten die Bäche und Flüsse, die von den Bergen herunterschossen, über ihre Ufer.
Auch in unserem Viertel standen die Gehwege und Straßen seit Tagen unter Wasser und die Autos, die mit gedrosselter Geschwindigkeit um die Kurve kamen, zogen eine Spur weiß schäumender Gischt hinter sich her. Ich sah ihnen zu, in meinen nachmittäglichen Pausen auf dem Balkon oder abends, wenn ich die Jalousien schloss, und ich fragte mich, wie hoch das Wasser noch steigen müsse, bis es in die Motoren drang und den Antrieb blockierte. Eines Tages, während eines Fernsehberichts über die globale Erwärmung, war mir die irrige Vorstellung gekommen, dass sich auch Fahrzeuge an eine veränderte Umgebung anpassen konnten. Wer weiß, fiel mir ein, vielleicht sind all die Autos in unserer Stadt schon dabei, sich zu verwandeln, in Motorboote, in Kutter oder kleine Yachten, und ich brachte diesen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf.
Vielleicht war die Verwandlung auch längst so weit fortgeschritten, dass es keine Rückkehr mehr gab. Wer davon wusste, schwieg, öffnete höchstens mit wissendem Lächeln die Motorhaube, schon hörte man das leise Surren der Schiffsschraube. Und wer sich bückte, konnte die sanft geformten Flügel bestaunen, die sich behände im Unterboden drehten. Nur noch kurze Zeit, dann würden die Passagiere nicht mehr von Busfahrern oder Taxilenkern zum Flughafen gebracht, sondern von Bootsmännern in ihren Kapitänsuniformen. Und von weitem konnte man dem Arbeitstrupp in ihren Blaumännern zusehen, der an der Glasfront des Flughafens dabei war, die riesigen Leuchtbuchstaben des Wortes Flug abzubauen. Das Kielwasser der Boote und Fähren schob stetige Wellen gegen die durchnässten Mauern der Häuser und auf den eilig erbauten Anlegestellen warteten die Hausfrauen und Angestellten, um rechtzeitig ins Büro oder ins Kaufhaus zu kommen.
Wenn ich nachts aus unruhigen Träumen erwachte und nicht mehr einschlafen konnte, überschlug ich im Kopf die Wasserverdrängung der großen Lastschiffe und stellte mir vor, wie die Feuchtigkeit in die Fugen der Ziegel eindrang und den Mörtel aufquellen ließ. Lang konnte es nicht mehr dauern, dann würden die Stützmauern zu bröckeln beginnen, die Fundamente der Stadt. Manchmal, wenn ich in diesen Stunden das Rauschen und Gluckern eines späten Taxis vernahm, versuchte ich mich an den Namen des Flusses zu erinnern, über den die Toten der Antike in die Unterwelt gebracht wurden, aber er wollte mir nicht einfallen.
Als es eines Morgens schien, als würde es doch noch eine Wendung zum Besseren geben, rief Gregor, mein Bruder, an und behauptete, dass Vater vor seiner Haustür stehe. Ich hatte gerade gefrühstückt und war auf den Balkon hinausgetreten, um die Wolkendecke zu begutachten, die an einer Stelle über den Kaminen des Nachbarhauses beinahe durchgerissen war. Der seit Wochen gießende Regen war in dünnes Nieseln zerronnen und aus dem glatten Nebelgrau brach azurfarbenes Blau durch, ein gutes Zeichen, wie ich dachte. Da vernahm ich das Klingeln des Telefons aus der Diele. Ich war überrascht, Gregors Stimme zu hören, er hatte mich monatelang nicht mehr angerufen. Aber Gregor hörte mir gar nicht zu, noch in meine ersten Worte der Verwunderung hinein sagte er, dass Vater vor seiner Haustür stehe, unser toter Vater, dass Vater an seiner Haustür klingle, dass er auf einmal wieder da sei, so, als hätten wir ihn nie begraben.
„Er klingelt wie verrückt!“, schrie Gregor ins Telefon.
„Verrückt“, wiederholte ich sein letztes Wort, ohne zu begreifen, was er meinte.
„Unser Vater“, schrie Gregor.
„Vater“, sagte ich.
„Er steht da draußen“, schnaubte Gregor. „Er nimmt seinen Finger nicht mehr von der Klingel – hörst du es“, und dann war nur mehr ein leises Rauschen zu vernehmen.
Ich nahm an, dass mein Bruder den Hörer von seinem Ohr weg in den Flur hielt.
„Hast du etwas genommen?“, fragte ich, als ich Gregor wieder atmen hörte.
Alma, die hinten im Wohnzimmer saß, blickte von ihrem morgendlichen Grüntee auf und ich machte ihr ein Zeichen, dass ihr Onkel nun völlig übergeschnappt sei. Sie breitete die Arme aus, die Handflächen nach oben, als wollte sie sagen, dass das irgendwann zu erwarten gewesen wäre.
„Null“, schrie Gregor ins Telefon, „so glaub mir doch.“
Alma war aufgestanden und hatte die Lautsprecherfunktion des Telefonapparates aktiviert, Gregors alarmierter Tonfall füllte unser Wohnzimmer.
„Ganz langsam, Bruderherz“, sagte ich, „reg dich nicht auf. Erzähl einfach der Reihe nach. Es hat geklingelt, du bist zur Tür und dann?“
„Nein“, brüllte Gregor, „er hat geklingelt. Er, er, er. Und er steht immer noch draußen herum. Er wartet nur darauf, dass ich endlich aufmache. Aber das werde ich auf keinen Fall tun.“
„Wer ist der Mann?“, sagte ich. Ich versuchte, langsam und deutlich zu sprechen. „Gregor, schau dir sein Gesicht genau an.“
„So glaub mir doch“, schrie Gregor, „er ist es. Es ist Papa. Dein verdammter Vater und meiner.“ Seine Stimme war kurz davor, sich zu überschlagen, und dann wurden wir unterbrochen.
Gregor war zwei Jahre älter als ich und galt bei meinen Eltern als der Ruhige und Abgeklärte von uns beiden. Er war Vaters Nachfolger in der Partei geworden, war Jahr für Jahr aufgestiegen und seit den letzten Wahlen galt er als unabkömmlich in der Stadtverwaltung. Wir sahen uns zwei- oder dreimal im Jahr, zu Weihnachten und Ostern meist, wenn wir unsere Eltern besuchten. Was Gregor sagte, hatte für unsere Mutter Gewicht, und auch sonst besaß er die Begabung, andere mit seiner Umtriebigkeit und Redegewandtheit in seinen Bann zu ziehen. Nicht umsonst hatte er sein Zahntechnikerstudio aufgegeben und war Politiker geworden. Wenn aber etwas seinen Vorstellungen und Wünschen zuwiderlief, wandte er sich ab und tat einfach so, als gäbe es kein Problem. Meistens folgten ihm alle auf seinem eingeschlagenen Weg, seine Parteikollegen, seine Freunde. Und auch mir als jüngerem Bruder war das Phänomen nicht unbekannt.
Auch als Vaters Krebs diagnostiziert wurde, sah Gregor weg, er wollte es einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Er ließ sich wochenlang nicht blicken und stellte jeder Begegnung mit der Krankheit und allen, die damit zu tun hatten, aus. Er wohnte viel näher bei unseren Eltern als ich, vielleicht eine Dreiviertelstunde mit dem Auto, aber wenn es galt, mit einem Arzt zu sprechen oder Vater zu den Bestrahlungen ins Krankenhaus zu bringen, war er nicht erreichbar. Angelina, seine zweite Frau, erklärte Mutter am Telefon, dass Gregor auf einer Landwirtschaftsmesse die Eröffnungsrede halte, in Verona oder in München, und dass er frühestens in zwei Tagen wiederkomme. Oder er war in einer dringenden Sitzung des Parteiausschusses und unmöglich zu sprechen. Manchmal kam auch Angelina und sagte, Gregor schickt mich.
Zumeist aber brachte ich Vater ins Bezirkskrankenhaus. Damit wir rechtzeitig dort waren, packte ich am Vorabend meine Sachen, fuhr über den Pass und das letzte Stück über die neue Autobahn und übernachtete im Elternhaus. Um sechs Uhr früh klopfte Mama an die Tür meines ehemaligen Kinderzimmers und Vater saß mit der blauen Reisetasche auf seinen Knien bereits in der Küche und sah auf die Uhr.
„Er lässt sich nicht blicken“, sagte er während der Fahrt, „vielleicht hat er Angst, dass ich ihn anstecke.“
„Er ist dein Sohn“, sagte ich.
„Von mir hat er das nicht“, sagte Vater und schaute auf die neuen Häuser, die man am Rande der Kleinstadt hochzog. Auf jeder unserer Fahrten waren weitere dazugekommen, elegante Reihenhäuser oder kleine Luxusvillen in sanften Pastelltönen, die sich an den Hang schmiegten bis hinauf zum Waldrand. Vor einigen Jahren hatte man es aufgegeben, große Wohnblocks mit billigen Wohnungen zu bauen, weil man die Erfahrung gemacht hatte, dass man dadurch zu wenig Kaufkraft für die Stadt anzog. Alles nur Gesindel, sagte Vater, hat kein Sach und kein Geld, und er nahm mit Genugtuung zur Kenntnis, dass man seine Überlegungen ernst genommen hatte. Obwohl er bereits seit fünfzehn Jahren nicht mehr für den Stadtrat kandidierte, war er überzeugt, dass es seine ganz persönlichen baupolitischen Vorschläge waren, die jetzt in die Tat umgesetzt wurden.
Als das Brachland begann und wir auf die Autobahn auffuhren, wollte Vater plötzlich wissen, was die Ärzte gesagt hätten.
„Du warst doch selbst dabei“, sagte ich.
Er richtete sich in seinem Sitz auf und holte Luft, als wollte er losschimpfen, aber dann bemerkte ich, dass er plötzlich innehielt. Er ließ seinen Oberkörper nach vorn sacken, schnaufte und blickte starr vor sich hin. Vielleicht hatte er tatsächlich vergessen, dass er bei der ersten Besprechung im Krankenhaus gemeinsam mit uns den Ärzten gegenübergesessen hatte, und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass man ihn über die Ergebnisse der Bestrahlung im Unklaren ließ. Schließlich hatte der Primar der Abteilung, als er uns die befürchtete Diagnose mitteilte, auf mich den Eindruck gemacht, als würde er weder den Patienten noch den Angehörigen etwas verschweigen wollen. Er hatte das Wort Tumor in den Mund genommen wie etwas Alltägliches, das es für ihn bestimmt auch war, nur für uns nicht, die wir hier saßen: Mama, neben ihr Vater, dann Gregors Frau, die Vaters Hand tätschelte, und ich ganz außen, auf diesen roten Plastikstühlen – und als Vater darauf nicht reagierte, hatte er seine Hand genommen, ihn angeschaut und gesagt: „Wir haben bei Ihnen einen Krebs festgestellt, aber wir haben gute Chancen, ihn zu heilen.“
„Na, dann los“, hatte Vater gesagt, und wir hatten alle gelacht. Auch Mama und Angelina, die statt Gregor mitgekommen war, hatten losgeprustet, und als Vater schließlich begriff, dass es seine Bemerkung war, über die wir lachten, wiederholte er seine Worte noch einmal.
Und jetzt, als wir zum zweiten Bestrahlungstermin fuhren, schien Vater bereits alles vergessen zu haben. Vielleicht war es auch eine Folge der Medikamente oder der Strahlen, die sich durch seinen Schädel bohrten und mit den wuchernden erkrankten Zellen auch die Erinnerung auflösten.
„Mir sagt man nichts“, wiederholte er stur, und als ich darauf nichts mehr entgegnete, drehte er seinen rasierten Schädel zu mir und sagte, lauter als vorher: „Bestimmt muss ich sterben.“
Das hatte er noch nie gesagt, zumindest mir gegenüber nicht, und für einen Augenblick stand dieser Satz mit stummer Wucht da, wie hingehängt vor meinen Augen. Was sollte ich ihm antworten auf diese Behauptung, die wie eine hilflose Frage klang.
„Hör zu, Vater“, sagte ich dann, „du hast alle Chancen der Welt.“
Ich hatte diesen Satz schon einmal gehört, nur fiel mir nicht ein, in welchem Zusammenhang.
„Wirklich?“, sagte Vater, und seine Stimme ging nach oben, als freute er sich über die plötzliche Erkenntnis. Ich nahm meinen Blick vom Rückspiegel und sah ihn an, seine Miene hatte sich mit einem Male aufgehellt, er nickte vor sich hin und wiederholte murmelnd meine Worte.
„Alle Chancen der Welt“, sagte er, drehte seinen Kopf zu mir und freute sich wirklich.
Am Eingang der Radiologie ließ ich ihn mit der Krankenschwester, die ihn mit seinem Namen begrüßt hatte, allein und sah ihm hinterher. Sein Anzug schlotterte um seinen Körper, der wieder ein Stück weniger geworden war. So trottete er durch den Gang auf sein Zimmer, neben der jungen Pflegerin, die seine Tasche trug.
„Das ist Schwester Irina“, hatte er sie mir vorgestellt und ich wunderte mich, dass er ihren Namen behalten hatte. Schließlich war die letzte Bestrahlung vor drei Monaten gewesen.
Am Ende des langen Ganges blieben beide stehen, die Krankenschwester öffnete die Durchgangstür zum Bereich, den Besucher nicht betreten durften, und ich wartete darauf, dass sich Vater noch einmal umdrehte. Ich hatte keine Ahnung, wie schnell es gehen würde.
2
So hatte ich meinen Bruder kaum einmal erlebt. Gregor war vor Schrecken erstarrt und verschwand fast in der Ecke seiner schwarzen Ledercouch. Er hatte es tatsächlich nicht fertig gebracht, die Klinke herunterzudrücken und vor das Haus zu treten, um sich zu vergewissern, wer der Mann vor seiner Haustür wirklich sei. Er hatte nicht einmal versucht, den Alten über seine Gegensprechanlage zu fragen, was er denn wolle. Oder was dies alles zu bedeuten hätte.
„Du bist doch sonst nicht so auf den Mund gefallen“, sagte ich zu Gregor, „warum hast du Vater nicht gesagt, dass er tot ist und gefälligst unter der Erde bleiben müsse.“
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!