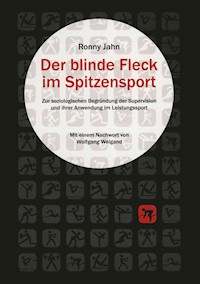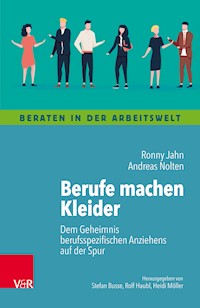
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
Frei nach Roland Barthes ist berufsbezogene Kleidung die von allen gesprochene und zugleich allen unbekannte Sprache. Das Buch erschließt einen Zugang zum Unbekannten und folgt dabei der Idee: Berufe machen Kleider. »Deutlich wird dies an einem vermeintlich individuell motivierten Detail berufsspezifischen Anziehens, der Halskette der Beraterin. Im symbolischen Sinne einer Amtskette gleich, ist sie für die Trägerin das, was dem kirchlichen Würdenträger der Bischofsstab. Sie zeigt an, wem es zusteht, den Prozess zu steuern, wem legitime Einflussnahme erlaubt ist. Mit Blick auf die Spannung zwischen persönlichen Bedürfnissen, professionellen Anforderungen und organisationalen Interessen steht die Kette der Beraterin für die Verbindung gegensätzlicher Pole. [...] Alles hat seinen Sinn, so auch (berufsspezifische) Kleidung als Ausdruck sozialer Praxis. [...] Machen wir uns auf den Weg der streitbaren Sinnerschließung.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben von
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Ronny Jahn / Andreas Nolten
Berufe machen Kleider
Dem Geheimnis berufsspezifischen Anziehens auf der Spur
Mit 8 Abbildungen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: VectorKnight/shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6061
ISBN 978-3-647-90112-1
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Einleitung
1Alles hat seinen Sinn
1.1Was ziehe ich an?
1.2Die individuelle Perspektive
1.3Die soziale Perspektive
2Zum Sinn beruflicher Kleidung – Vordergründiges und Hintergründiges
2.1Der weiße Kittel des Arztes
2.2Die Zwischenkleidung des Lehrers
2.3Der normierte Dresscode des Bankers
3Zum Sinn der Kleidung des Beraters – Selbstreflexion
3.1Die Supervisorin
3.2Der Gruppendynamiker
3.3Die Unternehmensberaterin
4Zum Sinn berufsspezifischer Kleidung in der Beratung – Szenen aus der Beratungspraxis
4.1Sakko, Hemd, Jeans und ein missglücktes Erstgespräch
4.2Im Anzug und in Chino Tacheles reden – ein geglücktes Krisengespräch
4.3Blitzlichter
5Alles ist möglich – Auflösungserscheinungen
6Beratungspraktische Empfehlungen
Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Berater/-innen und Personalverantwortliche, die Beratung beauftragen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen, und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforscher/-innen, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mitgestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leserinnen und Lesern die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen, als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe werden Themen bearbeiten, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So werden die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen nochmals offerieren und aufbereiten, sondern sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt bewegen. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und schulenübergreifend, in der nicht einzelne Positionen prämiert werden, sondern zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene angeregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Einleitung
»Es hat sich uns ergeben, dass in der Mode sozusagen die verschiedenen Dimensionen des Lebens ein eigenartiges Zusammenfallen gewinnen.«
(Georg Simmel, 1905)
Ausgangspunkt dieses Buchs bildet die Annahme, dass Kleidung als ein Medium der Mode immer auch arbeits- und lebensweltliche Wirklichkeit abbildet. Jenseits der Intentionen der Träger1 wird die Kleiderwahl damit von mehr als nur dem individuellen Ausdrucksbedürfnis bestimmt. Vor dem Hintergrund unserer gemeinsamen Beratungspraxis glauben wir, dass wir uns insbesondere im beruflichen Kontext weniger anziehen, als vielmehr von unserem Beruf angezogen werden. Wir, das sind ein supervisionsaffiner Soziologe (R. J.) und ein supervisionsaffiner Volkswirt (A. N.). Unsere gemeinsame Beratungspraxis vollzieht sich im weitesten Sinne im organisationalen Kontext in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Funktionsund Rollenträgern. Angefangen von Managern in IT-Unternehmen über Ingenieure, Ärzte, Anwälte, Psychotherapeuten, Lehrer, Pfleger und Erzieher bis hin zu Gas-Wasser-Installateuren. Schon beim Lesen der Aufzählung entstehen vor unserem inneren Auge verschiedene Bilder berufsspezifischer Kleidung. In deren Folge ist beispielsweise nicht zu erwarten, dass ein Hortbetreuer in einem Dreiteiler – einem aus drei Teilen inklusive Weste bestehenden Anzug oder Hosenanzug – erscheint und eine Lehrerin im klassischen blauen Business-kostüm mit halbhohen Schuhen oder ein Unternehmensberater im karierten Holzfällerhemd.
Auch Volkswirte und Soziologen scheinen sich unabhängig von ihren individuellen Kleidungsstilen beim Tragen von Kleidung in beruflichen Zusammenhängen systematisch zu unterscheiden. So sehr wir uns in diagnostischer und interventionspraktischer Hinsicht verstehen, so sehr unterscheiden beziehungsweise unterschieden wir uns in unserem »Outfit«. Während sich der Volkswirt in der Regel mit Anzug und Krawatte kleidet, hält es der Soziologe für angemessen, Jeans, weißes Hemd und blaues Sakko zu tragen. Waren wir zu zweit beim Klienten (sagt der Soziologe) beziehungsweise Kunden (sagt der Volkswirt), führten unsere unterschiedlichen Erscheinungsbilder nicht selten zu mehr oder weniger produktiver Irritation bei unserem Gegenüber und uns. Nach längerer Diskussion über die Frage, wer bezüglich der Frage nach angemessener Kleidung »recht« hat, mündeten unsere kleidungsbezogenen Unterschiede schließlich in beratungspraktischen Überlegungen und Erkenntnissen, die wir den Leserinnen und Lesern mit diesem Band pointiert zur Verfügung stellen wollen.
Pointiert heißt hier für uns, die Frage nach dem Ausdruck von Kleidung in der Beratung weder zu theoretisieren noch zu trivialisieren, vielmehr soll das Buch der mehr oder weniger großen Bedeutsamkeit von Kleidung für die Beratungspraxis gerecht werden und Beraterinnen und Berater für ihre und die berufsspezifische Kleidung ihrer Klienten sensibilisieren.
Damit ist dieses Buch keine wissenschaftliche Einführung in die Psychologie oder Soziologie der Kleidung und auch kein Moderatgeber. Der Text versteht sich als eine theoretisch informierte Anregung zur Auseinandersetzung mit der Frage nach berufsspezifischen Kleidungsdifferenzen sowie deren Bedeutung für die Beratungspraxis.
Wir begreifen Kleidung im Folgenden als soziales Phänomen. Kleidung hat damit wie jedes soziale Phänomen – also etwa grüßen, feiern, beraten, singen, küssen und so fort – einen Sinn, der rekonstruiert werden kann: Berufe machen Kleider! Wir fragen, welche Berufe machen welche Kleidung und warum? So verstanden ist berufsspezifische Kleidung nicht nur Ausdruck von Individualität, sondern immer auch Ergebnis berufsspezifischer Anforderungen und Besonderheiten. Diesen grundlegenden Zugang zum »Geheimnis« berufsspezifischen Anziehens stellen wir im Sinne einer Ausgangshypothese im ersten Kapitel vor, um dessen Erklärungskraft und praktischen Nutzen für Beraterinnen und Berater in den daran anschließenden Kapiteln zu demonstrieren.
1Die vorliegenden triftigen Argumente für eine geschlechtsindifferente Schreibweise anerkennend, haben wir uns entschlossen, das generische Maskulinum zu verwenden. Jenseits zu Gunsten einer hoffentlich besseren Lesbarkeit nutzen wir das generische Maskulinum vor allem, um einen Beruf im Allgemeinen im Unterschied zu einem spezifischen Rollenträger bezeichnen zu können. Also etwa den Beruf Arzt im Allgemeinen im Unterschied zur konkreten Ärztin oder dem konkreten Arzt. Wir sind uns darüber im Klaren, dass auch die Entscheidung für diese Schreibweise nicht vollumfänglich zufriedenstellend ist.
1 Alles hat seinen Sinn
Die Annahme, die soziale Welt sei sinnstrukturiert, bildet die Basis unserer Überlegungen (vgl. Garz u. Kraimer, 1994; Garz u. Rawen, 2015; Oevermann, 2002). Ohne diese Unterstellung müssten wir die Frage nach dem Sinn von Kleidung als eine nicht zu beantwortende zur Seite legen. Kleidung wäre dann sinnentleert und beliebig. Wenn wir im Unterschied dazu davon sprechen, dass Kleidung sinnstrukturiert ist, besagt das, dass sich jede Sozialität – so auch Kleidung – über Bedeutungsstrukturen generiert und innerhalb dieser nichts sinnlos ist. Unter Sozialität verstehen wir so verschiedene Prozesse und Phänomene wie Weihnachten feiern, S-Bahn fahren, frühstücken, Zeitung lesen, unterrichten, Sex haben, Lotto spielen, Brötchen backen, Recht sprechen und auch die Praxis des (berufsspezifischen) Anziehens. All diese Aktivitäten folgen allgemeinen und spezifischen Bedeutungsstrukturen respektive Sinngehalten, die herausgearbeitet werden können. So beinhaltet etwa jedes Weihnachtsfest gleiche grundlegende Elemente und unterscheidet sich zugleich in seiner jeweils spezifischen Ausdrucksgestalt. Weihnachten als Fest der Familie, das unter anderem dazu dient, sich der familiären Bande zu vergewissern, zeitigt überall gleiche erfreuliche und unerfreuliche Dynamiken. Jeder kann ein Lied davon singen. Zugleich ist jedes Weihnachtsfest verschieden und damit ein Unikat. In jedem Fall ist Weihnachten nicht gleich Ostern und jeder, der dies bestreiten wollte, könnte dies nur um den Preis der Attribute »weltfremd«, »kulturfremd« oder »zynisch« tun.
Folgen wir diesem Gedankengang, ist es auch bedeutsam, ob ein Berater von Klienten oder Kunden spricht (vgl. Busse, 2015; Looss, 2014). Während der Begriff »Klient« auf ein Arbeitsbündnis zwischen einem in eine Krise geratenen Ratsuchenden und einem Berater verweist, bezeichnet der Begriff »Kunde« die geschäftsmäßige Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer. Dabei sind die Begriffe »Kunde« oder »Klient« per se weder schlecht noch gut, sondern verweisen auf unterschiedliche Sinnzusammenhänge und begünstigen differenzierte Erwartungen. Der Kunde kauft eine Dienstleistung ein und ist bekanntlich »König«. Kunde und Verkäufer feilschen mehr oder weniger um den für sie jeweils besten Preis. Sie verbindet eine spezifische Rollenbeziehung. Fragt der Verkäufer den Kunden etwa nach seinen Ärgernissen oder nach seinen psychosozialen Belastungen am Arbeitsplatz, wird dieser dies als übergriffig erleben und sich mehr oder weniger deutlich gegen die ungebetene »Grenzüberschreitung« verwehren. Anders verhält sich dies bei dem Klienten des Coachs oder des Supervisors. Hier bittet der Ratsuchende als in seiner Autonomie mehr oder weniger eingeschränkter Klient um Unterstützung zu Problemen im Rahmen seiner Arbeit. Anlass, Beratung zu suchen, ist dabei stets ein hinreichender Leidensdruck. Der Klient ist dann nicht König und der Coach oder Supervisor kein Verkäufer. Beide vereint eine diffuse und spezifische Beziehung, das Arbeitsbündnis. In diesem ist es dem Coach oder Supervisor qua seiner spezifischen Rolle erlaubt, gemeinsam mit dem Klienten nach mehr oder weniger diffusen Gründen für arbeitsbezogene Belastungen zu suchen. Die Grenze zwischen Besprechbarem und Nichtbesprechbarem loten sie dabei zum Zweck der Bewältigung der arbeitsweltlichen Problemstellungen des Klienten immer wieder behutsam aufs Neue aus. Ein Feilschen um den besten Preis verträgt ein Arbeitsbündnis zum Zweck der Krisenbewältigung der Sache nach nicht.
Die skizzierte Auseinandersetzung mit den Begriffen »Kundin/Kunde« und »Klientin/Klient« ist kein Selbstzweck. Vielmehr kann sie Beratende für die Sinnofferten ihres Ausdrucks sensibilisieren und dabei unterstützen, zu klären, welcher Logik ein Beratungsprozess gerade folgt. Dominiert die Kunden- und damit die Geschäftslogik, sollte dies jeden Supervisor oder jeden Coach aufmerksam machen. Die Triftigkeit dieser Aussage untermauert ein Blick auf ärztliches Handeln. Sprechen Ärzte von Kunden und preisen ihr professionelles Handeln – etwa eine Untersuchung bei diffusen Bauchschmerzen – als Ware an, die sie zu einem bestmöglichen Preis verkaufen wollen, stellt sich beim Leidenden, dem Patienten, zurecht ein ungutes Gefühl ein. Auch hier würde die Geschäftslogik die professionell ärztliche Logik dominieren. Dass dies durchaus nicht selten passiert, ist kein Beleg für die Nichtigkeit der Differenz von Geschäftslogik und professioneller ärztlicher Logik. Im Gegenteil, unsere Empörung über ein Geschäftsgebaren im medizinischen Kontext unterstreicht, dass die soziale Praxis des Geschäftemachens von der sozialen Praxis ärztlichen Handelns verschieden ist und diese Differenz bedeutsam ist.
Vor dem Hintergrund unserer Überlegungen zum Weihnachtsfest sowie zu den Begriffen »Kunde/Kundin« und »Klientin/Klient« wird deutlicher, was es mit der Aussage, es existiere kein sinnloses Handeln, auf sich hat. Der Sinn einer Handlung mag sich nicht sofort erschließen oder unseren ethisch-moralischen Vorstellungen entgegenlaufen, sinnhaft ist sie indes immer. Die Suche nach der Bedeutung sozialer Handlungen, sei es in Bezug auf einzelne Akteure, Gruppen oder Organisationen, vereint Beraterinnen und Berater. Der Annahme, dass Sinn die Basis jeder Handlung bildet, steht Beliebigkeit entgegen. Während Beliebigkeit der Differenzen etwa in Alter, Geschlecht, Kleidung und Sprache wenig Aufmerksamkeit schenkt und damit zuweilen Toleranz auszudrücken glaubt, wo Ignoranz der Fall ist, zwingt die prinzipielle Sinnannahme zum Blick auf Differenzen und deren Sinnerschließung. Es ist dann nicht bedeutungslos, ob eine Beratungssitzung mit »dem Laden einer Klangschale«, »Herzlich Willkommen«, »Guten Tag« oder »Ja, wie ist es denn so?« eröffnet wird (Jahn u. Tiedtke, 2014). Vielmehr begünstigen die vier Sitzungseröffnungen unterschiedliche Erwartungen: Im ersten Fall eine Esoterikveranstaltung, im zweiten Fall sich als Gast einzurichten, im dritten Fall eine eher formaldistanzierte Beziehung und schließlich im vierten Fall muss der Adressat die Zumutung ertragen, dass der Ball nun bei ihm liegt und er entscheiden muss, was er mit ihm macht.
Der hier skizzierte Prozess der Sinnerschließung begünstigt den intersubjektiven Streit der Argumente um die angemessene Interpretation und Auslegung einer Handlung. Der damit verbundene Streit um das bessere Argument stört die vermeintlich konfliktlose Ruhe der Unbestimmtheit. Wo hingegen Beliebigkeit herrscht, weichen streitbare Argumente unstreitbaren Meinungen und Empfindungen. Das gilt für den öffentlichen Diskurs wie für den Diskurs der professionellen Community und auch für den Diskurs im Rahmen eines Beratungsprozesses. Wir laden Sie ein, sich im Weiteren auf die Annahme einzulassen: Alles hat seinen Sinn, so auch (berufsspezifische) Kleidung als Ausdruck sozialer Praxis. Machen wir uns auf den Weg der streitbaren Sinnerschließung.
1.1 Was ziehe ich an?