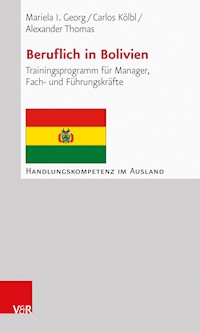
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Handlungskompetenz im Ausland.
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Bolivien übt durch seine kulturelle, klimatische und landschaftliche Vielfalt, seine oftmals dramatische und widersprüchliche Geschichte und Gegenwart eine große Faszination aus. Aktuell steht Bolivien im Zeichen von Transformationsprozessen, die mit der Zurückdrängung der sogenannten neoliberalen Eliten, dem Erstarken unterschiedlicher sozialer und indigener Bewegungen sowie dem Amtsantritt von Evo Morales zu tun haben. Dessen Regierung hat sich die innere Entkolonisierung sowie die Anerkennung der Plurikulturalität und -nationalität Boliviens und eine insgesamt gerechtere Sozial- und Wirtschaftsordnung vorgenommen. Seit jeher ist Bolivien reich an Bodenschätzen, was immer wieder zu erbitterten politischen Auseinandersetzungen im Land geführt hat. Heute spielen insbesondere Erdgas, Eisenerz oder Lithium eine wichtige Rolle. Dem Lithium – dem "weißen Gold" – wird dabei eine große Zukunft als moderner Energiespeicher in Handys oder Notebooks vorhergesagt. Vor dem angedeuteten Hintergrund zieht es Managerinnen und Manager aus dem Bereich der Wirtschaft, aber auch Fach- und Führungskräfte politischer Stiftungen, diplomatischer Dienste, der internationalen Zusammenarbeit, von Bildungseinrichtungen, verschiedener NGO oder der Kirchen immer wieder berufshalber nach Bolivien. An sie alle richtet sich das vorliegende Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Handlungskompetenz im Ausland
herausgegeben von Alexander Thomas, Universität Regensburg
Vandenhoeck & Ruprecht
Mariela I. GeorgCarlos KölblAlexander Thomas
Beruflich in Bolivien
Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 7 Cartoons von Jörg Plannerer.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99717-9Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter:www.v-r.de
© 2015, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen /Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, USAwww.v-r.deAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: Satzspiegel, Nörten-HardenbergUmschlag: SchwabScantechnik, Göttingen
Inhalt
Vorwort
Einführung in das Training
Einleitung
Theoretischer Hintergrund
Aufbau, Ablauf und Ziele des Trainings
Themenbereich 1: Sympathieorientierung
Beispiel 1: Die Begrüßung
Beispiel 2: Der»colado«
Beispiel 3: Die»caserita«
Beispiel 4: Wann geht es mal voran?
Kulturelle Hintergründe zu »Sympathieorientierung«
Themenbereich 2: Indirekte Kommunikation
Beispiel 5: Die Kündigung
Beispiel 6: Der Hausbau
Beispiel 7: Kein Geld für das Dorfprojekt
Beispiel 8: Das Kirchdach
Kulturelle Hintergründe zu »Indirekte Kommunikation«
Themenbereich 3: Flexibilität
Beispiel 9: Einfach aus- und umsteigen
Beispiel 10: Was willst du machen?
Kulturelle Hintergründe zu »Flexibilität«
Themenbereich 4: Zeitverständnis (»Hora boliviana«)
Beispiel 11: Ich komme gleich an der Plaza an
Beispiel 12: Die Einladung
Beispiel 13: Der Vortrag
Kulturelle Hintergründe zu »Zeitverständnis (›Hora boliviana‹)«
Themenbereich 5: Indigenität
Beispiel 14: Die Herzoperation
Kulturelle Hintergründe zu »Indigenität«
Themenbereich 6: Synkretismus
Beispiel 15: Die»Virgencita«
Beispiel 16: »Mesas«
Beispiel 17: »El Tío« in Potosí
Beispiel 18: Auf dem Dorf
Kulturelle Hintergründe zu »Synkretismus«
Themenbereich 7: Hierarchieorientierung
Beispiel 19: Götter in Weiß
Beispiel 20: Wir haben es schon immer so gemacht
Beispiel 21: Die Beschimpfung des Kassierers
Kulturelle Hintergründe zu »Hierarchieorientierung«
Besonderheiten im bolivianischen Alltag
Straßenverkehr
Umweltschutz
Öffentliche Verwaltung
Informationen zu Bolivien
Eine kurze Geschichte Boliviens
Landeskundliche Fakten im Überblick
Kurze Zusammenfassung der kulturellen Themen und der Besonderheiten im bolivianischen Alltag
Literatur
Literaturempfehlungen
»Si se dice que Bolivia es una formación abigarrada es porque en ella no sólo se han superpuesto las épocas ecónomicas (las del uso taxonómico común) sin combinarse demasiado, como si el feudalismo perteneciera a una cultura y el capitalismo a otra y ocurrieran sin embargo en el mismo escenario o como si hubiera un país en el feudalismo y otro en el capitalismo, superpuestos y no combinados sino en poco. Tenemos, por ejemplo, un estrato, el neurálgico, que es el que proviene de la construcción de la agricultura andina o sea de la formación del espacio; tenemos de otra parte […] el que resulta del epicentro potosino, que es el mayor caso de descampesinización colonial; verdaderas densidades temporales mezcladas no obstante no sólo entre sí del modo más variado, sino que también con el particularismo de cada región porque aquí cada valle es una patria, en un compuesto en el que cada pueblo viste, canta, come y produce de un modo particular y hablan lenguas y acentos diferentes sin que unos ni otros puedan llamarse por un instante la lengua universal de todos.«
»Wenn man sagt, dass Bolivien ein buntscheckiges, heterogenes Gebilde ist, so deswegen, weil sich in ihm nicht allein die ökonomischen Epochen (diejenigen der üblichen Taxonomie) übereinander geschichtet haben, ohne sich allzu sehr zu vereinen – so als ob der Feudalismus zu einer und der Kapitalismus zu einer anderen Kultur gehören würde, obgleich sie sich auf derselben Bühne abspielen, oder so als ob es ein Land im Feudalismus und ein anderes im Kapitalismus gäbe, übereinander geschichtet und allenfalls in geringem Maße miteinander verbunden. Wir haben zum Beispiel eine Schicht, die neuralgische, die aus der Konstruktion der andinen Landwirtschaft stammt, also aus der Formung des Raumes; wir haben andererseits […] die Schicht, die aus dem Epizentrum Potosís resultiert, das den größten Fall der kolonialen ›Entbäuerlichung‹ darstellt; das sind wirkliche zeitliche Verdichtungen, die sich gleichwohl nicht nur in sich in höchst variabler Art und Weise vermischen, sondern die sich auch mit dem Partikularismus jeder Region vermischen. Denn hier ist jedes Tal ein Vaterland, in einer Zusammensetzung, in der sich jede Bevölkerung auf eine besondere Art kleidet, singt, isst und produziert und wo unterschiedliche Sprachen und Akzente gesprochen werden, ohne dass die einen oder die anderen sich für einen Augenblick für die universale Sprache aller erklären könnten.«
René Zavaleta Mercado (1983, S. 17)
(Übersetzung: C. K.)
Vorwort
Bolivien übt durch seine kulturelle, klimatische und landschaftliche Vielfalt, seine oftmals dramatische und widersprüchliche Geschichte und Gegenwart eine große Faszination aus. Dieser Faszination erlag etwa im 19. Jahrhundert der französische Naturforscher Alcides d’Orbigny, der schrieb, Bolivien repräsentiere in den Grenzen einer einzelnen Nation die ganze Welt (d’Orbigny, 1844/1945). Auch Deutsche hat es immer wieder aus ganz unterschiedlichen Gründen in dieses Land gezogen. Darunter etwa Hans Ertl, der Leni Riefenstahls Kameramann gewesen war und dessen Tochter Monika mit Régis Debray die Entführung des ebenfalls in Bolivien lebenden Alt-Nazis Klaus Barbie plante und die schließlich als Guerillera in der Nachfolge Che Guevaras getötet wurde (Schreiber, 2009). Darunter auch zahlreiche deutsche Juden, die vor der nationalsozialistischen Vernichtung geflohen waren, wie der aus Breslau stammende und erst vor wenigen Jahren verstorbene Werner Guttentag, der mit »Los amigos del libro« (»Die Freunde des Buches«) einen der einflussreichsten und ambitioniertesten bolivianischen Verlage gegründet und jahrzehntelang geleitet hat (Gurtner, 2012). Davor, daneben und danach haben sich seit den Tagen der Unabhängigkeitskämpfe zu Beginn des 19. Jahrhunderts deutsche Kaufleute, Militärs, Techniker, Bierbrauer und andere Einwanderer in Bolivien dauerhaft niedergelassen oder dort zeitweise gelebt und haben auf je eigene Art und Weise das Land mitgeprägt. Aktuell – auch dies übt (so oder so) eine starke Faszination aus – steht Bolivien im Zeichen mehr oder weniger tiefgreifender, widersprüchlicher und mitunter schwer zu beurteilender gesellschaftlicher Transformationsprozesse, die mit der Zurückdrängung der sogenannten neoliberalen Eliten, dem Erstarken unterschiedlicher sozialer und indigener Bewegungen sowie dem Amtsantritt von Evo Morales zu tun haben. Dessen Regierung hat sich nichts weniger als die innere Entkolonialisierung sowie die Anerkennung der Plurikulturalität und -nationalität Boliviens und eine insgesamt gerechtere Sozial- und Wirtschaftsordnung, kurzum: eine »Revolution in Demokratie«, vorgenommen. Kritiker – und das sind keineswegs bloß ewig gestrige Reaktionäre – werfen der Regierung allerdings eine Aushöhlung rechtsstaatlicher Prinzipien, die Gefährdung der Pressefreiheit, Autoritarismus und Korruption vor.
Bolivien ist nicht China und doch darf man erwarten, dass auch ein Training »Beruflich in Bolivien« auf Interesse und einen entsprechenden Bedarf stößt. Dass Bolivien nicht China ist, ist selbstverständlich nicht allein geographisch, sondern auch ökonomisch zutreffend. Während die großen deutschen Industrieunternehmen häufig Mitarbeiter nach Fernost entsenden und sich davon eine deutliche Erhöhung ihrer Firmengewinne versprechen, gehört das nach gängigen ökonomischen Standards gemessen sehr arme Bolivien mit Sicherheit nicht zu denjenigen Nationen, in die massenhaft Führungskräfte deutscher Wirtschaftsunternehmen geschickt werden. Dennoch gibt es solche Auslandsentsendungen auch im Falle Boliviens, zumal das Land reich an Bodenschätzen ist. In der Kolonialzeit richtete sich die Ausbeutung insbesondere auf das Silber, das man aus dem »Cerro Rico« (»Reicher Berg«) Potosís gewann, später – bis weit in das 20. Jahrhundert hinein – auf das Zinn, das »Teufelsmetall«, wie einer der sozialkritischen Romane des bolivianischen Schriftstellers Augusto Céspedes betitelt ist. Heute spielen vor allem Erdgas, Eisenerz oder Lithium eine wichtige Rolle. Dem Lithium – dem »weißen Gold« – wird dabei eine große Zukunft als moderner Energiespeicher in Handys oder Notebooks vorhergesagt. Dass der Reichtum an Bodenschätzen nicht nur als Segen, sondern immer wieder auch als Fluch empfunden worden ist und bis heute zu erbitterten politischen Auseinandersetzungen führt, weiß man nicht erst seit Eduardo Galeanos (1971/1991) anklagender Schrift über die »offenen Adern Lateinamerikas« (speziell zum Lithium s. Beutler, 2011).
Über den erwähnten Personenkreis der in Industrieunternehmen Tätigen hinaus gibt es zahlreiche deutsche Managerinnen und Manager, Fach- und Führungskräfte gerade auch aus anderen Bereichen als der Wirtschaft, die es beruflich mit Bolivien mehr oder weniger lang zu tun haben. Zu ihnen gehören etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter politischer Stiftungen, diplomatischer Dienste, der Internationalen Zusammenarbeit, von Bildungseinrichtungen, verschiedener NGOs oder Kirchen. Ihre berufliche Tätigkeit dürfte nicht zuletzt durch die vielschichtige kulturelle, sozioökonomische und politische Realität des Landes sowie seiner facettenreichen und bekanntlich auch nicht immer leichten Beziehungen zu Europa motiviert sein.
An sie alle richtet sich das vorliegende Buch, das zu den anderen Lateinamerika-Trainings der Reihe »Handlungskompetenz im Ausland« hinzutritt und sie – so hoffen wir jedenfalls – bereichert: Mexiko (Ferres, Meyer-Belitz, Röhrs u. Thomas, 2005), Brasilien (Brökelmann, Thomas, Fuchs u. Kammhuber, 2005), Argentinien (Foellbach, Rottenaicher u. Thomas, 2002), Chile (Ellenrieder u. Kammhuber, 2009) und Peru (Maurial de Menzel u. Thomas, 2012). Letzteres ist für unseren Zusammenhang besonders wichtig, weil Bolivien und Peru eine lange gemeinsame Geschichte teilen sowie vielfache geographische und gesellschaftliche Ähnlichkeiten aufweisen.
Das Anliegen unseres Trainings ist es, zu einer ersten vorbereitenden Orientierungshilfe beizutragen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dabei gilt es, die hohe Komplexität der bolivianischen Gesellschaft und ihre »Buntscheckigkeit« – im Sinne des eingangs zitierten bolivianischen Soziologen und Politikers René Zavaleta – stets im Bewusstsein zu halten.
Abschließend möchten wir uns noch herzlich bei allen Interviewpartnerinnen und -partnern bedanken, die mit ihren detaillierten Schilderungen kritischer Interaktionen die empirische Grundlage für unser Training geliefert haben. Ohne ihr Interesse für unser Vorhaben, ihr Vertrauen und die Bereitschaft, ihre spannenden Erfahrungen mitzuteilen, wäre das vorliegende Buch nicht möglich gewesen. Unser Dank gilt auch der großen Hilfsbereitschaft zahlreicher Personen vor Ort, die Kontakte zu potenziellen Interviewpartnerinnen und -partnern unbürokratisch angebahnt haben. Last but not least danken wir Andrea Kreuzer (Bayreuth) für ihre wertvollen Kommentare zu einer früheren Fassung des Buches.
Mariela I. Georg
Carlos Kölbl
Alexander Thomas
Einführung in das Training
Einleitung
In modernen Gesellschaften sind im Zuge von Prozessen der Globalisierung und Migration Begegnungen mit anderen Kulturen alltäglich geworden, nicht zuletzt im Kontext beruflicher Aufgaben. Dies bringt es mit sich, dass der – wie auch immer näher definierte – Erfolg beruflichen Handelns nicht allein von fachlichen Kenntnissen abhängt, sondern gerade auch von interkultureller Kompetenz (Kölbl u. Kreuzer, 2014). Das betrifft selbstverständlich Mitarbeiter von Organisationen, die ins Ausland entsandt werden; interkulturelle Kompetenz ist aber auch für die Daheimgebliebenen von Bedeutung, insofern als sie in internationalen Organisationen tätig sind oder medial vermittelt (beispielsweise per Telefon oder E-Mail) mit Angehörigen anderer Kulturen interagieren (müssen). Eine Grundsensibilität für die Besonderheiten einer uns zunächst einmal fremden Kultur – im vorliegenden Falle der bolivianischen – und darauf aufbauendes interkulturelles Wissen sind hilfreich, um tragfähige Beziehungen zu den Interaktionspartnern aufzubauen, mit denen man produktiv zusammenarbeiten möchte. Das vorliegende Training soll zum Verständnis einiger zentraler Besonderheiten der bolivianischen in Relation zur eigenen Kultur beitragen, so dass mögliche Konfliktfelder frühzeitig antizipiert und das eigene Verhalten darauf abgestimmt werden können.
Theoretischer Hintergrund
Kultur kann aufgefasst werden als eine historisch gewordene Ganzheit aus aufeinander verweisenden kollektiv bedeutsamen Regeln, Normen, Werten, Zielen, Deutungsmustern, Symbolen und Geschichten. Dabei richtet Kultur explizit und implizit das Handeln, Wollen, Fühlen und Denken derjenigen Menschen aus, die dieser Kultur angehören (Thomas, 2000; Straub, 2007). Kultur stellt mithin einen Rahmen oder ein Orientierungssystem für das Handeln und Erleben von Menschen dar und wird zugleich selbst durch das Handeln und Erleben von Menschen verändert, ist also nicht allein Struktur, sondern ebenso Prozess (Boesch, 1991). Im Übrigen ist es durchaus nicht eindeutig, wer wann und warum einer Kultur angehört oder nicht, vielmehr ist dies oftmals eine politisch und gesellschaftlich heiß umkämpfte Frage. Darüber hinaus gilt für den Begriff der Kultur – heute mehr denn je –, dass
– Kulturen keine homogenen, sondern in sich differenzierte Gebilde sind, weshalb Redeweisen wie die von einer »bolivianischen« und einer »deutschen Kultur« drastische Vereinfachungen darstellen;
– er auf Kollektive einer variablen Größe und variablen temporalen Dauer verweist;
– Kulturen oder kulturelle Elemente nicht territorial verankert sein müssen;
– er auf »hochkulturelle« genauso wie auf Phänomene der Alltagskultur beziehbar ist;
– es multiple kulturelle Zugehörigkeiten gibt (s. hierzu Straub, 2007).
Die Zugehörigkeit zu einer Kultur bietet in Interaktionen mit Angehörigen derselben Kultur eine gewisse Sicherheit bezüglich des eigenen Verhaltens und Erlebens und desjenigen des Interaktionspartners. Wir wissen, was in etwa erwartbar, angemessen und kulturkonform ist und was eher nicht. Zwar gibt es gewisse Spielräume, aber es gibt auch – nicht immer leicht zu identifizierende – Grenzen dessen, was in einer Kultur als akzeptabel gilt und was als sanktionsbedürftig angesehen wird. Dabei fällt uns in der Regel nicht ohne Weiteres auf, welche Normen, Regeln, kollektiv geteilten Ziele, kulturell bedeutsame Geschichten, Deutungsmuster und Verhaltensweisen wir für selbstverständlich erachten. Im Zuge der Sozialisation sind solche Normen, Regeln, Deutungsmuster und dergleichen von uns so stark internalisiert worden, dass wir wie die sprichwörtlichen Fische im Wasser sind, die das sie umgebende Element gar nicht erkennen (können). Im Umgang mit Angehörigen anderer Kulturen verfügen wir freilich in viel geringerem Ausmaß über die angesprochene Sicherheit im Verhalten und Erleben. Mancherlei am Verhalten des Anderen erscheint uns fremdartig, irritierend und erklärungsbedürftig, weil wir es nicht vergleichsweise problemlos an die uns verfügbaren Schemata anpassen können. Das vorliegende Training soll einen Beitrag dazu leisten, mögliche Irritationen in deutsch-bolivianischen Interaktionen im Hinblick auf das fremd- und das eigenkulturelle Orientierungssystem zu reflektieren.
Die Grundlage dieses Trainingsprogramms sind Interviews mit deutschen bzw. deutsch-bolivianischen Managerinnen und Managern, Fach- und Führungskräften aus ganz unterschiedlichen Berufskontexten sowie Studierenden, die zu selbst erlebten, kritischen Interaktionssituationen mit bolivianischen Partnern vorzugsweise in ihrem Arbeits-, aber auch in ihrem privaten Umfeld befragt wurden. Mithilfe bewährter Methoden der interkulturellen Forschung (Thomas, 2000) wurden aus den Interviews zentrale kulturelle Themenbereiche herausgearbeitet. Ergänzend wurden auch Ergebnisse aus Interviews mit deutschen Studierenden, die einen längeren Bolivienaufenthalt absolviert haben, herangezogen (Georg, 2010; Ergebnisse aus dieser Arbeit fließen insgesamt immer wieder in das Buch ein). Durch Gespräche mit Experten, die mit der bolivianischen Kultur vertraut sind und Lektüren einschlägiger kulturwissenschaftlicher, insbesondere anthropologischer und historischer Literatur, sowie bolivianischer Belletristik und durch Rückgriff auf Dokumentar- sowie Spielfilme wurden kulturell angemessene Erklärungen zu den Situationen erarbeitet. Die in diesem Buch vorgestellten kritischen Interaktionssituationen beruhen allesamt auf authentischen Begegnungen, die aber sprachlich aufbereitet, zugespitzt, pseudonymisiert und verfremdet wurden, nicht zuletzt um die Anonymität der Interviewpartnerinnen und -partner zu gewährleisten. Während solcherart Trainings früher als »Culture-Assimilator« bezeichnet wurden, spricht man heute – unseres Erachtens zu Recht – lieber von »Intercultural Sensitizer« (Leenen, 2007).
Aufbau, Ablauf und Ziele des Trainings
Das vorliegende Training kann im Selbststudium durchgearbeitet werden. Es besteht aus insgesamt 21 deutsch-bolivianischen Begegnungssituationen, die in sieben Themenbereiche zusammengefasst sind. Bei diesen idealtypischen Situationen handelt es sich um Interaktionen mit Bolivianerinnen und Bolivianern – seltener auch um Interaktionen zwischen Bolivianern –, die von deutscher Seite häufig erlebt und in ganz unterschiedlichen Hinsichten als kritisch, irritierend oder unverständlich interpretiert werden; in Ausnahmefällen kann es sich auch um Situationen handeln, die zwar nicht häufig erlebt worden sind, aber eine so hohe kulturelle Relevanz aufweisen, dass sie dennoch mit aufgenommen wurden. Jedem Themenbereich sind ein bis vier Beispielsituationen zugeordnet, die einen speziellen Aspekt bzw. ein spezielles Bündel von Aspekten eines relevanten kulturellen Themas deutlich machen sollen. Der Aufbau ist dabei stets wie folgt: Zunächst wird eine Situation vorgestellt, die für die deutschen Interaktionspartner (potenziell) irritierend ist. Daran schließt sich die Frage an die Leser an, ob sie das als kritisch empfundene bolivianische Verhalten erklären können. Hierzu werden meistens vier Antwortalternativen präsentiert, die in ihrem Erklärungswert einzuschätzen sind. Dabei können mehrere Antwortalternativen den gleichen Erklärungswert haben – eine davon ist aber die, die die Situation am besten erklärt. Die Antwortalternativen werden anschließend erläutert und die Leser zur Reflexion im Hinblick auf einen sinnvollen Umgang mit solchen Situationen aufgefordert. Nach der Durcharbeitung weiterer thematisch verwandter Situationen werden die kulturellen Hintergründe des Themenbereiches deutlich gemacht. Es ist hervorzuheben, dass die einzelnen Themenbereiche aufeinander verweisen und nicht immer völlig trennscharf unterschieden werden können.
Durch das skizzierte Vorgehen sollen die Leser fremdkulturelle Verhaltensweisen kennenlernen, die zu Unverständnis bzw. Missverständnissen zwischen Deutschen und Bolivianern führen können. Dabei soll es aber selbstverständlich nicht bleiben. Vielmehr soll die gedankliche Auseinandersetzung mit möglichen Erklärungen für die beschriebenen Verhaltensweisen und die anschließenden Erläuterungen zu den Erklärungen sowie die Ausführungen zu den kulturellen Hintergründen des jeweiligen Themenbereiches dazu beitragen, die Situationen gewissermaßen mit »bolivianischen Augen« sehen zu können. Das ist aber noch nicht alles. Mindestens genauso wichtig ist nämlich die (im Idealfall) erreichte Sensibilisierung für die kulturelle Standortgebundenheit des eigenen Verhaltens, Fühlens, Wollens und Denkens. Solch eine Sensibilisierung bedarf der Kontrastierung mit fremdkulturellen Verhaltensweisen und Deutungsmustern, um überhaupt ins Blickfeld geraten zu können.
Informationen zu Besonderheiten im bolivianischen Alltag und zu Bolivien allgemein, wie eine kurze Geschichte Boliviens und eine Übersicht über landeskundliche Fakten, leiten die abschließende Zusammenfassung der kulturellen Themen ein, bevor Literaturempfehlungen das Buch abrunden.
Wenn dieses Training nach und nach durchgearbeitet wird, wird es im gelingenden Fall zu einer ersten orientierenden Sensibilisierung für deutsch-bolivianische Begegnungen führen. Im Zuge der Sammlung konkreter Erfahrungen vor Ort kann kulturspezifisches Wissen weiter ausdifferenziert werden und an Komplexität gewinnen. Insbesondere wird aus dem expliziten, ein implizites Handlungswissen werden.
Bevor mit der Durcharbeitung des Trainingsmaterials begonnen wird, müssen einige »Vorwarnungen« und Grenzen angesprochen werden, die teilweise schon angedeutet worden sind. Ein solcher „Beipackzettel“ mit Risiken und Nebenwirkungen erscheint uns deshalb notwendig zu sein, weil die unreflektierte Nutzung interkultureller Trainingsbausteine rasch in das Gegenteil dessen münden kann, wofür sie eigentlich gedacht sind:
– Die Situationen, die auf den folgenden Seiten präsentiert werden, beruhen auf Erfahrungsberichten von Deutschen in Bolivien. Die Charakterisierung »der bolivianischen Kultur« erfolgt aus »deutscher Sichtweise«.1 Die kulturellen Themen, die vorgestellt werden, sind also nicht kulturelle Themen, die an und für sich Gültigkeit für Bolivien beanspruchen können, sondern sind stets in Relation zur deutschen Perspektive zu sehen. Die kulturellen Themen sind mithin relationale Konstrukte (Straub, 2007). Für jemanden aus – sagen wir einmal Peru oder Japan – mögen sich manche der hier vorgestellten Interaktionen keineswegs als kritisch darstellen, dafür aber andere, die im Folgenden nicht aufgeführt sind, weil sie von den deutschen Interviewpartnerinnen und -partnern nicht erlebt oder nicht für berichtenswert erachtet wurden.
– Das Material, mit dem dieses Training arbeitet, besteht aus den angesprochenen Interviews mit Deutschen und Deutsch-Bolivianern, die in Bolivien arbeiten bzw. gearbeitet oder studiert haben. Die Anlage dieser Interviews fordert dazu auf, einer bis zum Zeitpunkt des Interviews meist fremden Interviewerin kritische Interaktionen zu berichten. Es liegt nahe anzunehmen, dass nicht alle kritischen Interaktionen, die man erlebt hat, in so einer Situation ohne Weiteres erzählt werden und es liegt ebenfalls nahe anzunehmen, dass nicht alle kritischen Interaktionen den Interviewpartnern gleich zur Verfügung stehen und problemlos versprachlicht werden können.
– Kulturelle Themen sind höchst komplex und sich mit allen möglichen Besonderheiten davon auseinanderzusetzen, wäre eine dramatische Überforderung und würde den Rahmen eines Orientierungstrainings in jedem Falle sprengen. Insofern wurde die komplexe kulturelle Realität Boliviens auf wenige, aber zentrale Aspekte reduziert. Man muss sich dieser Reduktion aber bewusst sein, um die damit einhergehenden Vereinfachungen niemals für das Ganze zu halten.
– Eine ernst zu nehmende Gefahr, die von interkulturellen Orientierungstrainings ausgehen kann, ist es, eher zur Bildung von Stereotypen als zur interkulturellen Sensibilisierung beizutragen. Daher sollte man sich bei der Bearbeitung dieses Trainings stets vor Augen halten, dass es auch so etwas wie Familien-, Organisations-, Gruppen- und regionale Kulturen gibt. Selbstverständlich verhalten sich nicht alle Bolivianer so wie in den kritischen Interaktionen beschrieben. Kulturen sind keine homogenen Gebilde, sondern in sich kulturell differenziert und heterogen bzw. hybrid.
– Neben kulturellen Faktoren tragen auch persönlichkeitsbedingte, situative, soziale oder sozioökonomische Faktoren zu Irritationen in zwischenmenschlichen Begegnungen bei. Personen sind nicht einfach bloße Träger einer Kultur. Außerdem partizipieren Personen in variierenden Graden an unterschiedlichen Kulturen. Ein Aymara, der beispielsweise in La Paz an der Universität studiert hat, war anderen kulturellen Einflüssen ausgesetzt als ein Aymara, der sein ganzes Leben im heimischen »Ayllu« (dörfliche Gemeinschaft der Aymaras) gelebt hat.
– Interkulturelles Lernen ist ein niemals abschließbarer Prozess. Interkulturelles Lernen kann durch die Durcharbeitung eines Trainings wie diesem, durch die Teilnahme an stärker verhaltensorientierten Trainings, durch Lektüren sowie leibhaftige Begegnungen mit Angehörigen anderer Kulturen und der Reflexion der eigenen kulturellen Standortgebundenheit erfolgen, doch interkulturelle Kompetenz, die man ein für alle Mal »fix und fertig« besitzt, kann all dies nicht bringen. Schon deshalb nicht, weil Kulturen einer permanenten Dynamik unterworfen sind. Nicht zuletzt Manager, Fach- und Führungskräfte, die ins Ausland entsandt werden, also Sie, tragen zu solchen Dynamiken bei. Dies ist auch der Grund dafür, dass ein Training wie das hier vorgelegte zwangsläufig veraltet: Das, was für Deutsche im Umgang mit Bolivianern im Jahre 2015 noch kritisch sein mag, ist es vielleicht schon in zehn Jahren kaum noch – dafür aber möglicherweise anderes.
– Im Folgenden werden ausschließlich potenziell konflikthafte oder verwirrende Situationen vorgestellt. Freilich verläuft eine Vielzahl deutsch-bolivianischer Interaktionen konfliktfrei. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich nicht allein kulturelle Differenzen, sondern auch eine Fülle an Gemeinsamkeiten. Im Übrigen dürfte ihren Interaktionspartnern zumeist nicht verborgen bleiben, dass Sie aus dem Ausland sind und dass Sie sich darum bemühen, sich »richtig« zu verhalten. In solchen Fällen dürften Sie des Öfteren auch Wohlwollen und Nachsicht erfahren.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Bearbeitung der Trainingseinheiten und bei Ihrem Bolivienaufenthalt!
1 Im Folgenden setzen wir aus Gründen der Lesbarkeit nicht permanent Wörter in Anführungszeichen, die Leserinnen und Leser werden aber gebeten, sich diese oftmals mitzudenken.
Themenbereich 1: Sympathieorientierung
Beispiel 1: Die Begrüßung
Situation





























