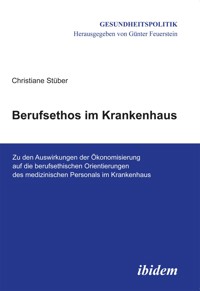
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Gesundheitspolitik
- Sprache: Deutsch
Betriebswirtschaftliche Kalküle bestimmen zunehmend den Arbeitsalltag von Ärztinnen, Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern in deutschen Krankenhäusern. Die Vorgaben resultieren dabei wesentlich aus politisch festgesetzten Sparzwängen und dem Bemühen, das Überleben der jeweiligen Häuser unter Wettbewerbsdruck sicherzustellen. Inwieweit gerät diese Ökonomisierung mit dem traditionell am Patientenwohl ausgerichteten Ethos des medizinischen und pflegerischen Personals in Konflikt? Wie wirkt sich ein solcher Konflikt auf das Vertrauen der Patienten in die Angehörigen von Pflege und Ärzteschaft aus? Und schließlich: Kann das medizinische Personal seinem Berufsethos noch folgen, wenn das System ihm abverlangt, eigene Belastungsgrenzen zu überschreiten – beispielsweise durch die Einführung von 24-Stunden-Schichten? Christiane Stüber zeigt, wie kommerzielle Erwägungen, Anreizsysteme und Kontrollen im Krankenhaus die Orientierung des medizinischen Personals an berufsethischen Normen systematisch unter Druck setzen. Führt dieser Druck dazu, dass es Pflegekräften und Ärzten in der Praxis de facto nicht mehr zumutbar ist, ihrem Berufsethos zu folgen, verliert das Vertrauen der Patienten in das medizinische und pflegerische Personal seine Grundlage. Das geschieht insbesondere dann, wenn Krankenhäuser weiterhin damit werben, dass bei ihnen das Wohl der Patienten an erster Stelle stehe. Das Buch richtet sich an alle, die im und für den Krankenhausbereich tätig sind, aber auch an (potentielle) Patienten, die sich mit der Situation des Medizinpersonals auseinandersetzen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen
AQUAInstitut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen
ArbZGArbeitszeitgesetz
AR-DRGAustralian Refined Diagnosis Related Groups
BQSBundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung
CMCase-Mix
CMICase-Mix-Index
CSRCorporate Social Responsibility
CTComputer Tomographie
DRGDiagnosis Related Groups
EGMREuropäischer Gerichtshof für Menschenrechte
FPÄndGFallpauschalenänderungsgesetz
FPGFallpauschalengesetz
G-BAGemeinsamer Bundesausschuss
G-DRGGerman Diagnosis Related Groups
GGGrundgesetz
GKVGesetzliche Krankenversicherung
GKV-FinGGKV-Finanzierungsgesetz
GKV-GMGGKV-Modernisierungsgesetz
GKVRefGGKV-Gesundheitsreformgesetz
GKV-VStGGKV-Versorgungsstrukturgesetz
GKV-WSGGKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes
GSGGesundheitsstrukturgesetz
ICNInternational Council of Nurses
InEKInstitut für das Entgeltsystem im Gesundheitswesen
IQWiGInstitut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
ITSIntensivstation
KHGKrankenhausfinanzierungsgesetz
KHRGKrankenhausfinanzierungsreformgesetz
LBFWLandesbasisfallwert
MRTMagnetresonanztomographie
MVZMedizinisches Versorgungszentrum
NCNumerus Clausus
NUBNeue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
PPRPflege-Personalregelung
QMQualitätsmanagement
SGBVSozialgesetzbuchV
StabGGesetz zur Stabilisierung der Krankenhausausgaben
TQMTotal Quality Management
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im November 2012 mit dem Titel"Berufsethos im Krankenhaus"an der Fakultät für Philosophie, Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften der Universität Regensburg als Dissertation angenommen. Es handelt sich um eine Arbeit zur Angewandten Ethik im Bereich des Gesundheitswesens. Im Praxiskapitel werden die gesundheitspolitischen Entwicklungen in Deutschland bis Ende 2011 berücksichtigt.
Ich möchte an dieser Stelle folgenden Personen herzlich für ihre Unterstützung bei der Fertigstellung dieses Forschungsprojekts danken: Prof. Dr. Weyma Lübbe, Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, PD Dr. Arne Manzeschke, Prof. Dr. Dr. Karl-H. Wehkamp, Prof. Dr. Thomas Kater, PD Dr. Friedrich Heubel, Prof. Dr. Harald Wagner, Prof. Dr. Ulf Liedke, Robert Klemm, Dr. Thomas Karlas, Dr. Michael Kunze, Dr. Anja Philipp, Andrea Klonschinski, Brigitte Hund, Bernd Knüfer SJ, Edward Drath sowie Inge und Hartwig Stüber.
Außerdem bin ich zahlreichen Krankenhausmitarbeitern zu Dank verpflichtet, die mir in den letzten Jahren Einblicke in den Arbeitsalltag deutscher Krankenhäuser gewährt haben. Weil ich diesen Menschen Anonymität zugesichert habe, verbietet sich eine namentliche Erwähnung. Das mir von ihnen entgegengebrachte Vertrauen hat mich aber in den letzten Jahren stärker als alles andere dazu motiviert, das vorliegende Buch tatsächlich zu schreiben.
Lichtenberg, im Juli 2013
I. Einleitung
In dieser Arbeit steht das Berufsethos des medizinischen Personals in deutschen Krankenhäusern im Mittelpunkt. Es wird untersucht, wie sich das in den letzten Jahren fortschreitende Eindringen betriebswirtschaftlicher Kalküle in die Krankenhäuser auf den Arbeitsalltag berufsethisch motivierter Krankenschwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte ausgewirkt hat. Betriebswirtschaftliche Vorgaben resultieren dabei wesentlich aus dem Bemühen, das Überleben der jeweiligen Häuser unter Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen. Insbesondere soll herausgearbeitet werden, inwieweit diese"Ökonomisierung"mit dem traditionellen Berufsethos des medizinischen und pflegerischen Personals im Krankenhaus in Konflikt gerät, und wie ein etwaiger Konflikt normativ zu bewerten ist.
1.Was ist ein Berufsethos?
Unter einem Berufsethos verstehen wir bestimmte Vorstellungen einer guten Berufspraxis, die von den Berufsangehörigen geteilt werden. Diese Vorstellungen und die damit verbundenen Wertungen prägen das Selbstverständnis der Berufsangehörigen als Angehörige einer bestimmten Berufsgruppe. Sie geben dem Handeln in der Berufspraxis einen Sinn, motivieren und legitimieren es sowohl vor den Handelnden selbst als auch vor anderen.[1]
Ein Berufsethos geht mit der Bindung an bestimmte Normen einher, die das Verhalten der Berufsangehörigen entsprechend den Vorstellungen einer guten Berufspraxis steuern. Wir betrachten diese Normen in dem Sinne als moralische Normen als sie angeben, was in einer bestimmten Gesellschaft und in einem bestimmten Bereich, in dem das Aufkommen moralischer Konflikte absehbar ist, als"richtig"oder"falsch"gilt. Der einzelne Berufsangehörige muss aber keine eigenständige moralische Beurteilung berufsethischer Normen vorgenommen haben, um diesen Normen als verbindlich folgen zu können.
Berufsethische Normen werden zum Teil explizit ausformuliert. Sie werden in Ethikkodizes für die Pflege und die Ärzteschaft wie dem ICN-Ethikkodex für Pflegende, der Rahmen-Berufsordnung für professionell Pflegende des Deutschen Pflegerates, der Musterberufsordnung für Ärztinnen und Ärzte oder der Charta zur ärztlichen Berufsethik festgeschrieben. Allerdings gewährleistet die Lektüre solcher Normenkodizes noch kein umfassendes Verständnis dessen, was das Berufsethos von Ärzteschaft und Pflege beinhaltet. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Zum einen findet sich nicht alles, was das pflegerische und ärztliche Berufsethos ausmacht, in derartigen Berufsordnungen und Ethikkodizes wieder. Das Berufsethos dieser Berufe beinhaltet auch Vorstellungen guter Arbeit, die historisch gewachsen sind, die nicht ausformuliert werden, aber dennoch identitätsstiftend bleiben. Dazu gehört z. B. die Verpflichtung auf eine auf bestimmte Art und Weise zu leistende Fürsorge für den Patienten (engl."Care") in der Pflege. Deshalb werden wir uns im Anschluss an dieses Einleitungskapitel zunächst der geschichtlichen Entwicklung von Ärzteschaft und Pflege zuwenden, um auch dieser Dimension zumindest in Ansätzen gerecht werden zu können.
Des Weiteren gibt es ausformulierte Leitsätze, die das Selbstverständnis der Berufsangehörigen in der Praxis kaum zu prägen scheinen. Schaut man sich beispielsweise die hohe Rate von Präsentismus (Arbeitnehmer gehen krank zur Arbeit)[2]in den Pflegeberufen an, wird deutlich, wie wenig etwa folgende Forderung aus dem ICN-Ethikkodex in der Berufspraxis umgesetzt wird. Im entsprechenden Kodex heißt es unter Punkt 2:
"Die Pflegende achtet auf ihre Gesundheit, um ihre Fähigkeit zur Berufsausübung zu erhalten und nicht zu beeinträchtigen."[3]
Darüber hinaus sind die in den vorhandenen Ethikkodizes von Pflege und Ärzteschaft festgehaltenen Normen häufig so formuliert, dass sie zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Rahmenbedingungen auch verschieden gedeutet werden können. Dann und wann wird das"zeitgemäße"Verständnis einer Norm durch eine konkretisierende Bemerkung genauer festgeschrieben. Eine Anpassung dessen, was es für die Ärzte und Ärztinnen in Deutschland heißen soll in ihren Entscheidungen unabhängig zu bleiben, d. h. in ihrer Entscheidungsfindung nicht von Dritten beeinflusst zu werden, wird beispielsweise in der 2011 novellierten Musterberufsordnung vorgenommen. Darin wird als Ausnahme konkretisiert, dass eine Beeinflussung durch Dritte dann nicht berufswidrig ist,"wenn sie einer wirtschaftlichen Behandlungs- oder Verordnungsweise auf sozialrechtlicher Grundlage dient und dem Arzt die Möglichkeit erhalten bleibt, aus medizinischen Gründen eine andere als die mit finanziellen Anreizen verbundene Entscheidung zu treffen."[4]
Trotz der Möglichkeit einzelne Normen zu konkretisieren, bleibt in der Regel ein gewisser Auslegungsspielraum für berufsethische Normen bestehen, innerhalb dessen neue Deutungen Platz gewinnen können, ohne dass dadurch (zunächst) der Wortlaut der entsprechenden Norm eine Veränderung erfahren müsste.
2.Grundlegende Inhalte berufsethischer Normen
Bei den Ärzten, wie bei anderen freien Berufen auch, ist das Berufsethos der Berufsangehörigen auf das Wohl der Leistungsempfänger ausgerichtet, in diesem Falle auf das Wohl der Patienten. Insbesondere die finanziellen Interessen des Leistungserbringers, aber auch die Interessen Dritter haben hinter diesem Wohl im Konfliktfall zurückzustehen. Diese Zurückstellung der Interessen der Leistungserbringer hinter das Patientenwohl ist für den Inhalt berufsethischer Normen maßgeblich. In der ärztlichen Berufsordnung werden die Ärztinnen und Ärzte demgemäß darauf verpflichtet, dem Patienten zu nützen, Schaden zu vermeiden, die Patienten aufzuklären, ihre Selbstbestimmung grundsätzlich zu respektieren und Verschwiegenheit zu wahren.[5]Die Verpflichtung auf das Wohl des individuellen Patienten findet sich ebenso im Berufsethos der Pflege. In der Präambel der Rahmen-Berufsordnung für professionell Pflegende heißt es beispielsweise:
"Pflege heißt, den Menschen in seiner aktuellen Situation und Befindlichkeit wahrnehmen, vorhandene Ressourcen fördern und unterstützen, die Familie und dassoziale, kulturelle und traditionelle Umfeld des Menschen berücksichtigen und in die Pflege einbeziehen sowie gegebenenfalls den Menschen auf seinem Weg zum Tod begleiten."[6]
Außerdem werden Schweigepflicht, Auskunftspflicht und Beratungspflicht ausdrücklich für die Angehörigen der Pflegeberufe festgeschrieben.[7]Den Patienten in seiner aktuellen Situation wahrzunehmen, bedeutet ihn in seiner Verletzlichkeit wahrzunehmen. Diese Verletzlichkeit resultiert zum einen aus dem Kranksein des Patienten selbst, zum anderen aber auch daraus, dass es notwendig werden kann, den Kranken aus seinem gewohnten Umfeld herauszunehmen und in einem Krankenhaus zu behandeln, wo er fremden Menschen Einblicke und sogar Eingriffe in seinen Intimbereich erlauben muss. Diese Umstände machen es dem Ethos der Pflege gemäß notwendig, sich dem Patienten zuzuwenden, auf seine Bedürfnisse zu achten, ihm zuzusprechen und seine vorhandenen Ressourcen soweit zu fördern, dass er trotz der bestehenden Einschränkungen eine gewisse Kontrolle über sich und seine Situation behält.[8]Diese Art der Pflege geht über ein Versorgen des Patienten hinaus und wird als"Fürsorge"bezeichnet. Im Laufe der Geschichte hat sich das Fürsorgegebot in der Pflege insofern gewandelt, als dass heute der Förderung der Selbstständigkeit des Patienten eine große Bedeutung zukommen und Pflege, wo möglich, stärker unterstützend als zuvorkommend wirken soll.[9]
Des Weiteren regeln berufsethische Normen die kollegialen Beziehungen innerhalb eines Berufsstandes und ggf. zwischen den Angehörigen verschiedener Berufsstände. In unserem Kontext sind das z. B. die Kooperationsverhältnisse innerhalb der Ärzteschaft und innerhalb der Pflege, aber auch die Zusammenarbeit zwischen beiden Berufsgruppen. Darüber hinaus bestimmen berufsethische Normen das Verhältnis zwischen den Berufsangehörigen und der Gesellschaft, welche die Berufsstände mit einer spezifischen Aufgabe betraut hat. Für das medizinische Personal im Krankenhaus besteht diese Aufgabe in einer angemessenen, dem Erkenntnisstand der Pflegewissenschaft und der Medizin entsprechenden Versorgung der Bevölkerung. Sowohl für die Ärzte und Ärztinnen als auch für die Angehörigen der Pflegeberufe wird zudem das Prinzip der"sozialen Gerechtigkeit"formuliert. Das bedeutet, dass die Patienten unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Religion oder Kultur behandelt werden sollen (Diskriminierungsverbot). In der Charta zur ärztlichen Berufsethik heißt es dementsprechend:
"Die Ärzteschaft ist dazu aufgerufen, Gerechtigkeit im Gesundheitswesen zu fördern. Dies schließt die faire Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel ein. Ärzte sollen sich aktiv daran beteiligen, Diskriminierungen im Gesundheitswesen auszumerzen. Dies bezieht sich auf die ethnische Herkunft, das Geschlecht, den Sozialstatus, die Religion oder auf jede andere gesellschaftliche Kategorie."[10]
Zu einer gerechten Mittelverteilung gehört nach dieser Charta aber auch die Verpflichtung, die vorhandenen Ressourcen"kosteneffektiv"einzusetzen. Dementsprechend heißt es:
"Bei der Berücksichtigung der Bedürfnisse individueller Patienten müssen Ärzte eine Gesundheitsversorgung anbieten, die auf einem klugen und effektiven Einsatz der begrenzten Mittel beruht. Sie müssen mit anderen Ärzten, Krankenhäusern und Versicherungen zusammenarbeiten, um Leitlinien für eine kosteneffektive Versorgung zu entwickeln. […]"[11]
Eine unter berufsethischen Gesichtspunkten"gute"Leistungserbringung verlangt somit auch einen kosteneffektiven Ressourceneinsatz und beinhaltet in diesem Sinne das Gebot"wirtschaftlich"zu arbeiten. Was genau es heißt, Ressourcen"kosteneffektiv"bzw."wirtschaftlich"einzusetzen, ist allerdings auch in Anbetracht einiger neuer Formulierungen im Sozialgesetzbuch V mittlerweile strittig geworden. Darauf werden wir im zweiten Kapitel dieser Arbeit zurückkommen.
Schließlich findet sich zumindest im ICN-Ethikkodex für Pflegende unter der Überschrift"Pflegende und Berufsausübung"eine bereits erwähnte Formulierung, die für das Verhältnis der Berufsangehörigen zu sich selbst Folgendes fordert:
"Die Pflegende achtet auf ihre Gesundheit, um ihre Fähigkeit zur Berufsausübung zu erhalten und nicht zu beeinträchtigen."[12]
Auf diese Norm werden wir im Laufe dieser Arbeit zurückkommen. Sie ist Bestandteil dessen, was wir später unter dem Begriff der"Selbstsorge"genau erfassen wollen.
3.Berufsethos und Vertrauen
Das Berufsethos von Ärzten und Ärztinnen, Krankenschwestern und Krankenpflegern wird in dieser Arbeit als eine Grundlage für das Vertrauen betrachtet, das Patienten und die Gesellschaft begründet in die Angehörigen dieser Berufsgruppen haben können. Vertrauen ist aus zwei Gründen Voraussetzung einer guten medizinischen Versorgung: Zumeinen ist eine wirkungsvolle Leistungserbringung davon abhängig, dass sich der Patient auf den Mediziner einlässt. Dieses"Sich-Einlassen"ist die Bedingung dafür, dass der Patient persönliche Informationen an den Mediziner weitergibt, diesem einen Einblick in seine Intimsphäre gewährt, um Diagnose und Behandlung überhaupt zu ermöglichen, und dafür, dass der Patient die Anweisungen desmedizinischen Personals befolgt.[13]Zum anderen können medizinische Leistungen von medizinischen Laien nur unzureichend kontrolliert werden. Selbst bei rechtlichen Prüfungen medizinischer Leistungen bezieht man sich auf den"medizinischen Standard". Deshalb ist es wichtig, auf eine gewisse Integrität der Berufsangehörigen vertrauen zu können, die es glaubhaft macht, dass diese ihr Fachwissen tatsächlich zum Wohle ihrer Patienten einsetzen werden.
Inwiefern das Berufsethos von Ärzten und Krankenpflegern das Vertrauen der Patienten in die im Krankenhaus tätigen Angehörigen dieser Berufe begründet, wollen wir durch eine Diskussion der begrifflichen Grundlagen dieses Themas untersuchen. In Kapitel IV dieser Arbeitwerden wir uns deshalb mit zwei Vertrauenstheorien auseinandersetzen. Wir beginnen mit der spieltheoretischen Rekonstruktion des Vertrauensbegriffs durch Russell Hardin. Hardin definiert Vertrauen als eine rationale Erwartung, die sich bei einem Vertrauensgeber dann einstellt, wenn er"begründet"davon ausgehen kann, dass ein Vertrauensträger an einer fortgesetzten nutzenbringenden Kooperation mit ihm interessiert ist und sich deshalb"vertrauenswürdig"erweisen wird. Ein Vertrauensträger erweist sich in diesem Ansatz"vertrauenswürdig", wenn ihm"vertrauenswürdiges"Verhalten derart nützt, dass es ihm zusätzliche Kooperationsvorteile verschaffen wird. Hardins Theorie ziehen wir als eine Kontrastfolie heran, von der wir später unsere eigene Vertrauenskonzeption absetzen wollen.Wir gehen auch darauf ein, weil im Krankenhausbereich die Tendenz besteht, eine"gute"Leistungserbringung der Mitarbeiter und eine gute Qualität der medizinischen Versorgung zunehmend über äußere Anreize und Vorgaben sicherstellen zu wollen (siehe dazu Kapitel III). In einer solchen Umgebung liegt es nahe, auch die"Vertrauenswürdigkeit"der Mitarbeiter als das Ergebnis der bestehenden Steuerungs- und Kontrollmechanismen aufzufassen. Zudem erlaubt es uns die Beschäftigung mit Hardins Ansatz darauf einzugehen, inwiefern die Bevorzugung der ökonomischen Rationalität in Theorie und Praxis einschränkt, was es für Menschen heißen kann vernünftig, d. h. begründet, zu entscheiden und zu handeln.Mithilfe eines Ansatzes von Bernd Lahno werden wir anschließend zeigen, warum Hardins spieltheoretische Lösung von"Vertrauensproblemen"zu kurz greift und wie man darüber hinausgehen muss, um zu einer angemessenen Vertrauenskonzeption zu gelangen. Insbesondere Lahnos Konzeption des"institutionellen Vertrauens"wird es uns erlauben, die Verpflichtung der Berufsangehörigen auf berufsethische Normen als einen wichtigen Faktor zu benennen, der die Ausbildung und Aufrechterhaltung von Vertrauen zwischen Patienten und medizinischem Personal im Krankenhaus unterstützt.
4.Ethoswandel durch Ökonomisierung
Betrachten wir das Berufsethos des medizinischen Personals im Krankenhaus wesentlich in Hinblick auf seine Vertrauen begründende Funktion, müssen wir ein Merkmal dieses Ethos im Auge behalten: Obschon das Berufsethos in Abhängigkeit von der Kernaufgabe des Personals, in unserem Fall der guten Versorgung kranker Menschen, eine gewisse Stabilität aufweist, ist es veränderlich. Veränderungen können aus dem Wandel der medizinischen Praxis und ihrer Rahmenbedingungen und aus den sich wandelnden Erwartungen der Patienten, der Gesellschaft und der Berufsangehörigen selbst an eine gute Versorgung im Krankenhaus resultieren.[14]Ein Wandel kann mehr oder weniger offen erfolgen. Die Anpassung der berufsethischen Orientierungen von Krankenpflegern und Ärzten an wirtschaftliche Erfordernisse wird in den bestehenden Ethikkodizes an einigen Stellen explizit gemacht, wenn etwa, wie schon zitiert, gefordert wird, dass sich Ärzte um den"klugen und effizienten Einsatz der begrenzten Mittel"bemühen müssen, und dass sie mit"anderen Ärzten, Krankenhäusernund Versicherungen zusammenarbeiten[müssen], um Leitlinien für eine kosteneffektive Versorgung zu entwickeln".[15]Dieses Mandat der"kosteneffektiven"Versorgung und der sparsamen Leistungserbringung wird zum Bestandteil einer guten Leistungserbringung erklärt und durch die schriftliche Festsetzung offen kommuniziert. Die Vertrauen begründende Funktion des derartig spezifizierten Ethos wird dadurch nicht gefährdet.
Im Gegensatz dazu wird ein über das Mandat der Sparsamkeit hinausgehender Wandel berufsethischer Orientierungen durch die zunehmende Handlungsrelevanz betriebswirtschaftlicher Faktoren im Krankenhaus bis hin zur Akzeptanz von Behandlungsentscheidungen, die nicht primär zum Wohl des einzelnen Patienten, sondern aus gewinnorientierten Erwägungen zum Wohle der Organisation heraus getroffen werden, bislang von den meisten Berufsangehörigen nur unter vorgehaltener Hand zugestanden. Oftmals gibt es allein anekdotische Hinweise, die auf einen derartigen graduellen"Ethoswandel"bzw. auf einen"Ethosabbau"hindeuten, nicht selten mit Verweis darauf, dass derartige Entwicklungen in anderen Häusern und in anderen Abteilungen stattfinden, nicht aber im eignen Umfeld. Ein solcher"Ethoswandel"wird dann nicht offen kommuniziert. Eine solche Situation ist für die Vertrauensgrundlage Berufsethos problematisch.
Tatsächlich ist es schwierig einen"Ethoswandel"einwandfrei festzustellen. Diese Schwierigkeit liegt zum Teil darin begründet, dass das Berufsethos ein komplexes Gebilde ist. Es besteht aus einer Vielzahl expliziter und impliziter Normen, die sich im Falle eines Wandels nicht alle, und schon gar nicht gleichmäßig, verändern können. Da die Anpassungsfähigkeit außerdem zum Wesen eines Berufsethos gehört, ist es schwer zu sagen, ab wann ein altes Ethos durch ein neues ersetzt wurde. Trotzdem lassen sich Tendenzen in der Entwicklung der berufsethischen Orientierungen der Berufsangehörigen erfassen, die Hinweise auf einen sich vollziehenden Wandel geben und Haltepunkte markieren, an denen eine Reflexion über die Entwicklung berufsethischer Normen und ihrer Bedeutung angestoßen werden kann und nach unserem Dafürhalten auch angestoßen werden sollte. In Kapitel V werden wir darüber hinaus versuchen in Anlehnung an dasdurch Immanuel Kant formulierte Prinzip der Publizität ein Kriterium für die Beurteilung der Legitimität eines wahrgenommenen Ethoswandels zu entwickeln.
5.Der Homo honestus und der Begriff der"Selbstsorge"
Die Verpflichtung des medizinischen Personals im Krankenhaus auf berufsethische Normen kann den Aufbau und den Erhalt von Vertrauensbeziehungen nur dann stützen, wenn die Befolgung dieser Normen von den Mitarbeitern auch wirklich erwartet werden kann. Nur wenn Bedingungen bestehen, unter denen eine Normbefolgung den Mitarbeitern tatsächlich"zumutbar"ist und sie nicht davon abhält ihre eigenen billigenswerten Interessen wahrzunehmen, ist es sowohl kognitiv als auch normativ zu erwarten, dass die Mitarbeiter den entsprechenden Normen langfristig folgen werden. Um diesen Punkt klarer zu machen, wollen wir in Kapitel V den Typus des"anständigen Mitarbeiters"entwickeln, der zur Bindung an berufsethische Normen fähig ist, in der Befolgung dieser Normen aber nachlassen darf, wenn das seine eigenen billigenswerten Interessen erheblich gefährdet.
Unsere Position entwickeln wir, indem wir sie von einem Ansatz Michael Baurmanns abgrenzen, den wir im ersten Teil von Kapitel V vorstellen. Nach Baurmann erhält sich eine"Disposition zur Normbefolgung"solange, wie sie dem Normbefolger einen zusätzlichen Vorteil verschafft. Sie wird durch ihre Nützlichkeit für den Normbefolger begründet. Der von Baurmann entwickelte"dispositionelle Nutzenmaximierer"soll sich durch seine Orientierung am eigenen Vorteil einerseits von einem kategorischen Pflichterfüller unterscheiden. Andererseits grenzt Baurmann ihn aufgrund seiner Fähigkeit zur"Normbindung"vom klassischen Homo oeconomicus ab. Wir werden zeigen, warum es Baurmann nicht gelingt, mit seinem dispositionellen Nutzenmaximierer eine abgrenzbare Position zwischen einem Homo oeconomicus und einem kategorischen Pflichterfüller zu formulieren. Sein Versuch scheitert daran, dass sich ein dispositioneller Nutzenmaximierer nicht glaubhaft an Normen binden kann. Sobald ihm die entsprechende Normbefolgung nicht mehr in dem Sinne nützt, dasssie ihm"per saldo"größere Vorteile verschafft als er ohne sie verwirklichen könnte, hat er keinen Grund mehr seine Normbindung aufrecht zu erhalten. Sie löst sich nach einer gewissen Verzögerung auf. Für einen dispositionellen Nutzenmaximierer gibt es kein von Nützlichkeitserwägungen unabhängiges"richtig"oder"falsch", das ihn von dieser Auflösung abhalten könnte. Das zwingt ihn dazu, in die Position des klassischen Homo oeconomicus zurückzufallen, wenn seine"Normbindung"ihm über kurz oder lang nicht mehr nützt.
Wie Baurmann suchen auch wir nach einer mittleren Position zwischen einem rigorosen Normbefolger und einem klassischen Nutzenmaximierer. Uns geht es dabei darum, die legitimen Anforderungen an solche Berufsangehörige zu bestimmen, die ihr Berufsethos als richtig und verbindlich begreifen, den entsprechenden Normen aber aufgrund einer steigenden Belastung im Arbeitsalltag nicht mehr gerecht werden können, wenn sie nicht selbst daran Schaden nehmen wollen. Wir wollen zeigen, dass es unter bestimmten Umständen auch für einen"anständigen"Mitarbeiter gerechtfertigt ist, in der Befolgung berufsethischer Normen nachzulassen. Dabei handelt es sich nicht nur um Umstände, die einem Mitarbeiter eine Normbefolgung unmöglich machen. Unter solchen Umständen wäre eine Aussetzung der Normbefolgung auch für einen rigorosen Pflichterfüller moralisch unproblematisch. Auf der anderen Seite ist eine Aussetzung der Normbefolgung aber im Gegensatz zu dem, was Baurmann vorschlägt, nicht schon dann legitim, wenn dem Mitarbeiter die fragliche Normbefolgung über kurz oder lang keinen zusätzlichen Vorteil mehr verschafft. Die Aussetzung einer Normbefolgung ist vielmehr dann gerechtfertigt, wenn Bedingungen bestehen, unter denen eine fortgesetzte Normbefolgung den"Normbefolger"von der Wahrnehmung seiner eigenen billigenswerten Interessen abhalten und ihm in diesem Sinne schaden würde.
Um diesen Sachverhalt klarer zu machen, widmen wir uns im zweiten Teil von Kapitel V dem Konzept der"Selbstsorge"und grenzen es von einer egoistischen Orientierung am eigenen Vorteil im Sinne einer ökonomischen Rationalität ab. Als Ergebnis dieser Abgrenzung werden wir unseren eigenen Handlungstypus vorstellen: den Homo honestus. Er wird uns gestatten, die Lage des"anständigen"Mitarbeiters im Krankenhaus zu erfassen und zu zeigen, wann diesem die Befolgung berufsethischer Normen in der Praxis nicht mehr zumutbar ist, inwiefern er sich aber dennoch dafür einsetzen muss seine Arbeit"gut"machen zu können und an welcher Stelle die Verantwortung für eine gute Leistungserbringung an andere Verantwortungsebenen übergeht.
6.Individuelle und kollektive Verantwortung
Die Einsicht, dass die Sorge um sich selbst legitim und von einer einseitigen Orientierung am eigenen Vorteil verschieden ist, kann für berufsethisch motivierte Berufsangehörige eine Entlastung bedeuten. Tatsächlich zeigen viele Interviews mit dem medizinischen Personal im Krankenhaus einen Konflikt auf: Mitarbeiter wollen dem traditionellen Bild der guten Schwester und des guten Arztes entsprechen und sich bestmöglich am Wohle des Patienten orientieren. Sie merken aber, wie sie sich in diesem Bemühen aufreiben.[16]Oft erscheinen dann nur zwei Alternativen:"Dienst nach Vorschrift"oder der Ausstieg aus dem Beruf. Erkennen die Mitarbeiter aber an, dass die Sorge um das eigene Wohl nicht nur legitim, sondern auch eine Voraussetzung dafür ist, ihre Arbeit langfristig gut zu machen, können sie auch sich und anderen gegenüber eher eingestehen und begründen, dass ihnen die Umsetzung mancher berufsethischer Anforderungen unter den bestehenden Bedingungen nicht zumutbar ist. An diesem Punkt kann die Reflexion darüber einsetzen, was es unter den gegebenen Umständen überhaupt heißen kann, seine Arbeit gut zu machen, und welche Bedingungen einem guten Arbeiten entgegenstehen. Während wir zeigen werden, dass es im Verantwortungsbereich des Mitarbeiters liegt, für ebensolche Bedingungen aufmerksam zu sein und die zuständigen Stellen darauf aufmerksam zu machen, istes eine kollektive Aufgabe zu überlegen, welche medizinische Versorgung die Gesellschaft will und welche Veränderungen notwendig sind, um ggf. mehr Raum für die Umsetzung berufsethischer Normen zu schaffen. Es ist aber auch möglich, dass das Erstarken betriebswirtschaftlicher Kalküle als notwendig akzeptiert und daraus resultierende Änderungen des traditionellen Ethos von der Gesellschaft und dem medizinischen Personal als unvermeidlich angenommen werden – ggf. unter einer Umformung des Verständnisses davon, was eine gute Krankenversorgung im Krankenhaus bedeuten soll. Erweisen sich die Änderungen berufsethischer Normen als gut begründbar und allgemein zustimmungsfähig, kann das geänderte Ethos weiterhin als Grundlage von Vertrauensbeziehungen dienen. Ein Beharren auf der Existenz eines traditionellen Ethos, dessen Umsetzung den Berufsangehörigen jedoch nicht zumutbar ist und sich deshalb in der Praxis auch nur solange halten kann, bis sich der letzte rigorose Pflichterfüller daran aufgerieben hat, gefährdet hingegen nicht nur die psychische und physische Gesundheit der"anständigen"Mitarbeiter, sondern auch das Vertrauen der Menschen in die Krankenhausversorgung.
7.Der Homo honestus im Krankenhaus
Im letzten Kapitel dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit der Organisationstypologie von Amitai Etzioni. Dabei gehen wir auf Etzionis Kategorisierung"professioneller Organisationen", wie z. B. dem Krankenhaus, als"normativer Organisationen"ein. Im Kontrast dazu wenden wir uns der aktuellen Managementliteratur für den Krankenhausbereich zu. Darin tritt das Krankenhaus zwar als normative Organisation in Erscheinung, insofern nämlich als die berufsethische Orientierung der Mitarbeiter am Wohl des Patienten weiterhin vorausgesetzt wird. Das Krankenhaus wird aber zunehmend als ein Unternehmen verstanden, dem es darum gehen muss im Wettbewerb zu bestehen. Der damit verbundene Druck wird an das Personal weitergegeben. Wir werden Beispiele dafür anführen, wie in der Managementliteratur mit dem Konflikt zwischen dem"Wohl des Hauses"und dem"Wohl des Patienten"umgegangen wird. Ferner wollen wir untersuchen, inwieweit die von uns aufgestellte Figur des anständigen, berufsethischgebundenen Mitarbeiters als Homo honestus, der sich dauerhaft an berufsethische Normen binden kann, sich aber auch um sein eigenes Wohl sorgt, mit den in dieser Literatur propagierten Managementkonzepten kompatibel ist. Wir werden zeigen, dass die Grundlage für das Vertrauen der Patienten in das medizinische Personal und in die Krankenhausversorgung gefährdet wird, wenn der berufsethisch motivierte Mitarbeiter allein auf werbewirksamen Webseiten angepriesen, nicht aber als solcher gefördert wird. Das Vertrauen in das medizinische Personal und in die Krankenhausversorgung wird hingegen gestärkt, wenn das Berufsethos der Mitarbeiter von der Organisationsleitung ggf. auch in seiner Widerständigkeit gegen bestimmte Veränderungen als schützenswerte Ressource anerkannt und dementsprechend gestützt wird.
8.Anliegen dieser Arbeit
Wie eine gute medizinische Versorgung letztlich aussehen soll und welche Erwartungen an das Berufsethos des medizinischen Personals dementsprechend vernünftig sind, muss unter Einbeziehung der Stimmen des medizinischen Personals und der Patientenschaft in einem öffentlichen Diskurs unter Berücksichtigung der bestehenden Werte der Gesellschaft und der zur Verfügung stehenden Ressourcen erörtert werden. In einer solchen Debatte sollte nicht nur diskutiert werden, wie viel Ethos wir uns heute noch leisten wollen, sondern auch, was ggf. verloren ginge, wenn die Arbeit des medizinischen Personals im Krankenhaus immer weniger durch die Orientierung an berufsethischen Normen und immer mehr über kommerzielle Erwägungen, Anreizsysteme und Kontrollen gesteuert wird. In der vorliegenden Arbeit versuchen wir die Entwicklungen im Krankenhaussektor, die das Berufsethos des medizinischen Personals betreffen, in angemessenen Kategorien zu beschreiben und dadurch transparenter zu machen. Damit wollen wir einen Input für den eingeforderten öffentlichen Diskurs geben. Dieser Absicht entsprechend richtet sich dieses Buch nicht nur an ein wissenschaftliches Publikum, sondern auch an diejenigen, die im und für den Krankenhausbereich tätig sind: an das Pflegepersonal, die Ärzte, an Krankenhausmanager und Politiker.
II.Kurze Betrachtung der Berufsentwicklung von Pflege und Ärzteschaft
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Berufsethos bedeutet in dieser Arbeit eine Auseinandersetzung mit dem Berufsethos von Ärzti
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























