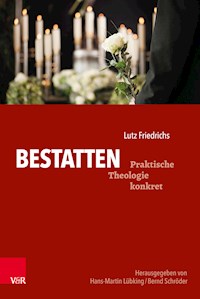
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Praktische Theologie konkret
- Sprache: Deutsch
Mit dem Wandel der Bestattungskultur verändert sich auch die kirchliche Bestattungspraxis. Das Buch informiert über neuere praktisch-theologische Ansätze und deren Erkenntnisgewinn für die Praxis. Es beschreibt das spannungsreiche Praxisfeld zwischen den Bedürfnissen der Trauernden, den Dienstleistungen der Bestatter*innen und den kirchlichen Anliegen. Für das praktische Handeln werden Impulse anhand von Fallbeispielen gegeben. Diese helfen, eigene Handlungsspielräume auch in Konfliktsituationen und strittigen Fragen zu erweitern. Pfarrer*innen, Vikar*innen und Prädikant*innen erhalten konkrete Anregungen für Gottesdienst, Predigt und neue Formen der Trauerbegleitung. Ebenso werden besondere Herausforderungen bedacht, so etwa das Bestatten von Sternenkindern, interreligiöse Trauerfeiern oder Tierbestattungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Praktische Theologie konkret
Band 2
Herausgegeben vonHans-Martin Lübking und Bernd Schröder
Lutz Friedrichs
Bestatten
Mit einem Geleitwort von Reiner Sörries
Mit 1 Abbildung und 8 Tabellen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2020, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: © Kzenon/Adobe Stock
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99953-1
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
Geleitwort
Vorwort
Einleitung
1Situation
1.1Historische Skizze
1.2Gesetzliche Regelungen
1.3Statistik der Bestattungen in Deutschland
1.4Gesellschaftliche Entwicklungen
1.5Kirchliche Herausforderungen
2Update – neue Ansätze und Aufbrüche
2.1Trauergottesdienst als Übergangsritual
2.2Dialog mit Bestatter*innen
2.3Bestatten als religiöse Dienstleistung
2.4Milieusensibel bestatten
2.5Trauern auf virtuellen Friedhöfen
2.6Initiativen zur Trauerbegleitung
2.7»Zarter Amtsbestatter«
3Essentials – Handlungsspielräume in Spannungsfeldern
3.1Amtshandlung und Kasualie
3.2Intimität und Öffentlichkeit
3.3Abschiedsritual und Gemeindegottesdienst
3.4Lobrede und Auferstehungspredigt
3.5Popmusik und Choral
3.6Kirchenrecht und Seelsorge
3.7»Einfach so da sein«
4Anregungen für die Praxis
4.1Aussegnungen
4.2Trauergespräch
4.3Totenfürsorge
4.4Werkstattimpuls menschlich reden
4.5Trauerpredigt
4.6Heiligabend auf dem Friedhof
4.7»Ohne Würde ist der Mensch ein Nichts« – Modernes Memento Mori in Gemeinden
5Zehn goldene Regeln
6Besondere Fälle
6.1Sternenkinder
6.2Früh verstorbenes Kind
6.3Ohne Angehörige
6.4Werkstattimpuls einfach reden
6.5Trauern in der Schule – multireligiös
6.6Tiere
6.7»There is a crack, a crack, in everything« – Bestatten in der Coronapandemie
7Literatur
1Bestattungsagenden der Landeskirchen (ab 2000 in Auswahl)
2Handreichungen
3Praxismaterialien
4Literatur
5Belletristik, Kinderbuch und Film
Vorwort der Herausgeber
Die Reihe »Praktische Theologie konkret« will Pfarrer*innen sowie Mitarbeitende in Kirche und Gemeinde mit interessanten und innovativen Ansätzen in kirchlich-gemeindlichen Handlungsfeldern bekannt machen und konkrete Anregungen zu guter Alltagspraxis geben.
Die Bedingungen kirchlicher Arbeit haben sich in den letzten Jahren zum Teil erheblich verändert. Auf viele heutige Herausforderungen ist man in Studium und Vikariat nicht vorbereitet worden und in einer oft belastenden Arbeitssituation fehlt meist die Zeit zum Studium neuerer Veröffentlichungen. So sind interessante neuere Ansätze und Diskussionen in der Praktischen Theologie in der kirchlichen Praxis oft kaum bekannt.
Der Schwerpunkt der Reihe liegt nicht auf der Reflexion und Diskussion von Grundlagen und Konzepten, sondern auf konkreten Impulsen zur Gestaltung pastoraler Praxis:
–praktisch-theologisch auf dem neuesten Stand,
–mit Informationen zu wichtigen neueren Fragestellungen,
–Vergewisserung über bewährte »Basics«
–und einem deutlichen Akzent auf der Praxisorientierung.
Die einzelnen Bände sind von Fachleuten geschrieben, die praktisch-theologische Expertise mit gegenwärtiger Erfahrung von konkreter kirchlicher Praxis verbinden. Wir erhoffen uns von der Reihe einen hilfreichen Beitrag zu einem wirksamen Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis kirchlicher Arbeit.
Dortmund/GöttingenHans-Martin Lübking und Bernd Schröder
Geleitwort
»Der Tod ist die Pforte zum Leben« steht am Eingangstor zum Inneren Neustädter Friedhof in Dresden. So kann man auf wenige Worte reduziert die evangelische Bestattungstheologie zusammenfassen. Doch wie tragfähig ist diese Botschaft heute? Das Dresdner Tor stammt von 1731, und die meisten Friedhofsportale trugen zu dieser Zeit ähnliche Inschriften, oft genug sogar bildhafte Motive der Auferstehung und der letzten Dinge. Aber so einfach ist es heute nicht mehr, und Friedhofseingänge sind sprachlos geworden. Bestenfalls liest man dort einen Auszug aus der Friedhofssatzung mit allen Hinweisen, was auf dem Friedhof verboten ist. Spiegelt diese Entwicklung auch die kirchliche Bestattungspraxis? Immerhin ist offenkundig, dass Bestatten schwieriger geworden ist als noch vor Generationen, was allein an der steigenden Zahl von Handreichungen, Aufsätzen und Büchern zur Bestattungskultur abzulesen ist.
Warum ist Bestatten heute so schwierig? Eine Erklärung mag darin liegen, dass die Ansprüche gestiegen sind sowohl bei den Hinterbliebenen wie bei den Bestattenden. »Mit Fried und Freud ich fahr dahin« dichtete Martin Luther 1524 im Zuge seines ersten Kirchenliederschaffens. Welche Pfarrerin oder welcher Prädikant wünschte sich nicht solche Glaubensstärke bei der Trauergemeinde, die ihr oder ihm da erwartungsvoll gegenübersitzt? Aber wer mag das noch singen? Wer mag im Trauergottesdienst überhaupt noch singen? Stattdessen wünschen sich die Angehörigen das Lieblingslied des oder der Verstorbenen am besten klangvoll und raumfüllend von einer mitgebrachten Tonkonserve. Dies soll keineswegs abwertend klingen, sondern nur an einem Beispiel verdeutlichen, mit welch hohen Erwartungen an Individualität die Trauernden kommen, wenn sie von einem lieben Menschen Abschied nehmen müssen. Inwieweit wollen und können Pfarrer*innen und Prädikant*innen diesen Ansprüchen gerecht werden?
Der Tod ist die Pforte zum Leben. Diese Botschaft in die Moderne zu übersetzen, hat man 2012 bei der Gestaltung des Eingangs zum Predigergärtlein genannten Urnenfriedhof der Christkönigskirche in Basel versucht. Beauftragt wurde der junge Street-Art-Künstler mit dem Künstlernamen Paris, der im Stil des Graffiti-Writing in großen Lettern die Worte mors porta vitae an das Tor sprayte. Bewusst gewählt wurde die lateinische Variante, um das Geheimnisvolle, das Andersartige auszudrücken. In der Farbwahl changieren die Buchstaben von schwarz (mors) nach gelb und gold (vita). Golden glänzen ebenfalls der Nimbus über der Inschrift und das »t« von vitae, das zum Kreuz geformt ist. Das i-Tüpfelchen erscheint wie eine Flamme des Heiligen Geistes. Die Botschaft vom Durchgang zum Leben durch den Tod ist hier in eine künstlerische Alltagssprache gekleidet, die sonst dazu dient, Claims abzustecken.
Das, was ich hier am Beispiel der Friedhofskultur beschreibe, unternimmt Lutz Friedrichs für die kirchliche Bestattungskultur in der Vielfalt ihrer Aspekte. Historisch kundig beobachtet er aufmerksam unsere Zeit mit ihren Veränderungen. Der alte Gedanke, Bestatten im christlichen Sinn als ein Werk der Barmherzigkeit zu sehen, tritt in seiner Aktualität neu hervor. In diesem Sinn wünscht sich Friedrichs das kirchliche Personal als »zarte Amtsbestatter«, die sich von den Nöten, Bedürfnissen und Fragen der Menschen leiten lassen – und für Würde und Humanität in der heutigen Bestattungspraxis eintreten.
Bestatten ist heute schwieriger geworden. Eigentlich sind die auf beiden Seiten gestiegenen Erwartungen eine gute Voraussetzung, um der Bestattung als dem zentralen religiösen Element im kirchlichen Handeln die ihr angemessene Bedeutung (zurück?) zu geben. Die Frage ist nur, wie geschieht dies unter den Bedingungen einer postmodernen, in Teilen säkularen Gesellschaft bei gleichzeitiger theologischer Angemessenheit?
Lutz Friedrichs entwickelt hilfreiche Impulse, die eigenen Handlungsspielräume auch in Konfliktsituationen und bei strittigen Fragen zu erweitern. In Fallbeispielen kommen auch besondere und schwierige Sterbefälle in den Blick, wenn etwa Kinder sterben oder Menschen durch Katastrophen in höchste Unsicherheiten gestürzt sind. Ganz aktuell wird die Frage des Bestattens unter Bedingungen der Coronapandemie aufgegriffen.
Heute ist mehr denn je gefordert, eine standardisierte oder gar erstarrte Bestattungspraxis durch das Bewusstsein des diakonischen Handelns und einer zeitgemäßen Kommunikation aufzubrechen. Gleichwohl hat sich an der Substanz christlicher Bestattung nichts geändert. Es stellt sich die zentrale Herausforderung, wie die alte Botschaft, dass der Tod die Pforte zum Leben sei, Menschen heute trösten und begleiten kann. Das Buch von Lutz Friedrichs kommt mit dem Titel »Bestatten« schlicht daher. Im Untertitel drückt es aus, dass es konkret wird. In dieser Zielrichtung, dass Theorie praktisch und konkret wird, empfehle ich das Buch all denjenigen, die als Pfarrer*innen und Prädikant*innen in der Praxis, aber ebenso auch denen, die in Studium und Ausbildung stehen. Auch wenn der Autor seinen Schwerpunkt auf die evangelische Bestattung legt, so mag es gerade deshalb gelingen, dass die Bestattenden der anderen christlichen Konfessionen oder jene ohne Glaubenshintergrund ihr eigenes Profil schärfen.
Kröslin im Mai 2020Reiner Sörries
Apl. Prof. Dr. Reiner Sörries war 1992–2015 Direktor des Zentralinstituts und Museums für Sepulkralkultur in Kassel.
Vorwort
Schon seit längerer Zeit befasse ich mich mit dem Thema »Bestatten«. Das Schreiben des Buchs gab mir die Möglichkeit, meine Einsichten unter praktisch-theologischer Perspektive zu bündeln.
Ein Buch über das Bestatten zu schreiben, löst unweigerlich persönliche Erinnerungen aus. Meine erste Erinnerung zum Thema »Bestatten« ist die Bestattung unseres Kanarienvogels Hansi im Hinterhof unserer Drogerie in dem Dorf, in dem ich als Kind aufgewachsen bin (siehe Tierbestattungen unten in 6.6).
Als mein Vater im Jahr 2003 bestattet wurde, habe ich etwas von dem erlebt, was Peter Handke in seinem Buch »Wunschloses Unglück« über das Begräbnis seiner Mutter schreibt: Das Ritual »entpersönlichte« (Handke 1974, 97) ihn endgültig. Das ist kein Vorwurf, sondern eher die Einsicht, wie schwer es ist, im Bestattungsgespräch so über ein zu Ende gegangenes Leben zu sprechen, dass es in guter Weise öffentlich gewürdigt werden kann.
Als mein Schwiegervater im Jahr 2016 bestattet wurde, war ich berührt, wie sich der Schatz der christlichen Tradition entfalten kann. Die Aussegnung im Garten seines Hauses unter seinem Lieblingsapfelbaum werde ich nicht vergessen.
In dem Buch sind persönliche Erinnerungen ebenso verarbeitet wie Szenen, Erzählungen und Begegnungen aus meiner Berufspraxis. Aber das ist ja Teil einer praktisch-theologischen Identität: Dass man nicht über das Bestatten und den Trost des christlichen Glaubens schreiben kann, ohne sich mit dem auseinandergesetzt zu haben, was einen selbst tröstet – oder nachdenklich macht.
In das Schreiben des Buchs fiel zunächst der schreckliche Terrorakt in Hanau am Abend des 19. Februar 2020. Dann kam Mitte März 2020 die Coronakrise mit ihren derzeit nicht absehbaren Folgen, auch für die Bestattungskultur. Für mich war es nicht vorstellbar, ein Buch über das Bestatten zu schreiben, ohne auf diese Krise einzugehen. Beide Krisen, Hanau und Corona, zeigen, wie krisengeschüttelt unsere Gesellschaft ist und wie stark sich Trauer- und Bestattungskultur wandeln (müssen).
Ganz herzlich danke ich den Kolleg*innen, die mir Materialien für dieses Buch zur Verfügung gestellt oder erarbeitet haben: Anne Gidion, Lars Hillebold, Beate Kemmler, Katharina Scholl, Anna Scholz und Anke Trömper; Birte Friedrichs, Jonathan Friedrichs und Lars Hillebold danke ich für die aufmerksame Lektüre des Manuskripts mit vielen hilfreichen Hinweisen und Anregungen. Mein Dank geht auch an die Herausgeber der Reihe Hans-Martin Lübking und Bernd Schröder sowie an Jana Harle vom Verlag.
Kassel und Steinhude im Mai 2020
Lutz Friedrichs
Einleitung
In Uberto Pasolinis Film »Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit« (2013, dt. 2014) wird die Geschichte von John May erzählt, der sich als funeral officer um die Bestattung von Menschen kümmert, die keine Hinterbliebenen haben oder bei denen es fraglich ist, wer zu den Hinterbliebenen zählt. John May besucht Trauerfeiern, an denen mit Ausnahme des Priesters niemand sonst teilnimmt.
Er erfüllt seine Aufgabe mit Leidenschaft und Unbeirrbarkeit. Er sucht nach Fotos, Briefen, Gegenständen, die etwas über das Leben der Verstorbenen verraten. Er breitet sie auf seinem Schreibtisch aus und schreibt mit Hingabe die Bestattungsansprache für den Priester. Als sein Vorgesetzter ihm mitteilt, dass er zu langsam arbeite, zu teuer sei und entlassen werden müsse, nimmt er sich umso beherzter seines letzten Falls an.
Mr. May wirkt wie aus der Zeit gefallen. Man hat aber den Eindruck, er tue genau das Richtige. Er steht für Werte der Humanität, die drohen, verloren zu gehen. »Ich denke«, so der Regisseur, »dass die Qualität unserer Gesellschaft im Grunde durch den Wert bestimmt wird, den sie ihren schwächsten Mitgliedern zuerkennt. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Toten umgehen, reflektiert den Umgang unserer Gesellschaft mit den Lebenden.« (Booklet, Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit)
Der Film lenkt den Blick auf die Frage der Haltung derer, die bestatten. Mr. May erscheint als »zarter Amtsbestatter«, dessen Anliegen es ist, Lebensgeschichten ohne Ansehen der Person zu würdigen, Trauernde zu versammeln und mit ihnen das Leben zu feiern. Kann er nicht Vorbild für die sein, die im Auftrag der Kirche bestatten?
Bestatten wird in diesem Buch als eine spezifische Form der Kommunikation des Evangeliums verstanden. Sie drückt sich nach jesuanischem Vorbild in drei kommunikativen Grundformen aus: »Gemeinschaftlich feiern«, »Helfen zum Leben« sowie »Lehren und Lernen«. Mit diesem Zugang nehme ich den Ansatz »Kommunikation des Evangeliums« von Christian Grethlein auf, beziehe ihn auf Fragen des Bestattens und versuche, ihn pastoraltheologisch weiterzudenken. Die drei Grundformen sind Reflexionskategorien, die zu einem kritischen Wahrnehmen und Reflektieren kirchlicher und religiöser Prozesse und ihrer Veränderungen anleiten (siehe Grethlein 2018, 41–45). Ihr Verständnis ist programmatisch partizipativ und ergebnisoffen.
Der kommunikative Ansatz strukturiert das Buch und bestimmt den Kurs. Es will als Update über Neuansätze und Anregungen für die kirchliche Praxis der letzten zwanzig Jahre informieren. Aber es soll nicht bei Information und Bericht bleiben. Es soll deutlich werden, wie sich das Feld unter dem kommunikativen Blickwinkel darstellt, was sich entwickelt hat und in welche Richtung Entwicklungen anstehen.
Als Entdeckungszusammenhang hilft der Ansatz, die verschiedenen Entwicklungen im Bereich des kirchlichen Bestattens wahrzunehmen und zu sortieren. Längere Zeit standen primär liturgische Aspekte (»gemeinschaftlich feiern«) im Vordergrund. Inzwischen lässt sich jedoch ein neues Interesse an diakonischen Initiativen (»Helfen zum Leben«) ebenso ausmachen wie zum Teil sehr einfallsreiche Formen des Umgangs mit Sterben und Tod, also der Frage der Endlichkeit als einer Schöpfungswirklichkeit (»Lehren und Lernen«).
Als Begründungszusammenhang lässt der Ansatz nach dem Zusammenspiel der drei Grundformen fragen. So lässt sich begründen, inwiefern es gefordert ist, kirchliches Bestatten als eine pastorale Leitungsaufgabe aufzufassen: In einem normativen Sinn gilt es, Bestatten nicht isoliert auf den Bestattungsakt, sondern als Prozess partizipativ und vernetzt zu denken. Bestatten kommt damit als Werk der Barmherzigkeit in den Blick.
Update, Essentials, Anregungen für die Praxis und Besondere Fälle enden jeweils mit einem kulturellen Kontrapunkt. Darin kommt zum Ausdruck, dass das praktisch-theologische Nachdenken auf den Dialog mit der Kultur der Gegenwart (Kino, Literatur, Popmusik) angewiesen ist. Sichtbar werden kulturelle Einsprüche, die jeweils auf ihre Art und Weise auf zentrale biblisch-theologische Anliegen verweisen.
Der Umgang mit Sterben, Tod und den Grenzen menschlichen Lebens tritt als gesellschaftliches Thema neu hervor, ohne dass absehbar ist, wie nachhaltig es die Gesellschaft beschäftigen wird.
Die Coronapandemie stellt auf den Kopf, was bisher zentral für die kirchliche Trauerkultur war: eine Form von Trost, der sich über soziale Nähe und das Erleben einer tragenden Gemeinschaft vermittelt. So endet das Buch mit einem letzten kulturellen Kontrapunkt als Impuls für die kirchliche Bestattungspraxis: »There is a crack, a crack, in everything. That’s how the light gets in.« (»Anthem« von Leonard Cohen)
Der Begriff »Bestatten« steht in diesem Buch im Gegensatz zum Begriff »Beerdigen« für einen längeren Prozess der kirchlichen Trauerbegleitung, umfasst also mehr als nur die kirchliche Trauerfeier und Beisetzung.
Die Überlegungen sind auf Fragen der evangelischen Bestattung konzentriert. Die Unterschiede zum katholischen Bestattungsverständnis sind zwar erheblich, da es sich bei der katholischen Liturgie um keine Kasualliturgie handelt, sondern »um eine Sterbe- und Trauerbegleitung in unterschiedlichen Formen des Gebets und des Gottesdienstes« (Gerhards 2011, 53 f.). Dennoch sind ohne Zweifel gemeinsame Anliegen wie das Begleiten des ganzen Trauerprozesses, gemeinsame Initiativen etwa im sozialdiakonischen Bereich der Ordnungsamtsbestattungen oder auch gegenseitige Beeinflussungen im Bereich der Trauerrede (siehe Pock/Feeser-Lichterfeld 2011) oder Ritualkultur (Entdeckung des Sechswochengedenkens, siehe Bestattung UEK 2004, 168–174) feststellbar.
In den evangelischen Kirchen bestatten in der Regel Pfarrer*innen. In manchen Landeskirchen wie beispielsweise der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck haben auch Prädikant*innen nach entsprechenden Ausbildungsgängen das Recht, kirchlich zu bestatten. Von daher haben die pastoraltheologischen Überlegungen des Buchs Prädikant*innen und Pfarrer*innen im Blick.
Das Gemeinsame ihrer Aufgabe besteht in der »Versorgung mit unmittelbarer religiöser Kommunikation« (Hauschildt 2013, 405). Der wesentliche Unterschied besteht im Grad der Professionalisierung: Anders als Prädikant*innen haben Pfarrer*innen die Aufgabe, das Praxisfeld als Ganzes theologisch-konzeptionell zu leiten. Dazu gehört, in einer sich stark wandelnden Bestattungskultur die Rahmenbedingungen der religiösen Kommunikation zu klären, der Situation entsprechende Handlungskonzepte zu entwickeln und das Praxisfeld mit anderen Akteuren zu vernetzen.
Diese Differenzierung in den Ämtern und Verantwortlichkeiten ist in den entsprechenden Passagen (besonders 2.7 und 3.7) mitzudenken, ohne sie hier im Einzelnen entfalten zu können.
1Situation
»Der Gärtner geht« war Anfang Februar 2020 in der Kasseler Lokalpresse zu lesen (Pflüger-Scherb 2020, 6). Der Artikel berichtet über Jürgen Rehs, Leiter der Friedhofsverwaltung in Kassel. Nach 38 Jahren Arbeit auf den Friedhöfen tritt er in den Ruhestand. Tatsächlich hat Rehs, bevor er Gartenbau studierte, das Gärtnerhandwerk erlernt; er steht damit für die Tradition der Gartenkunst der Friedhöfe, die sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert entwickelt hatte.
Den Wandel der Bestattungskultur im Spiegel eines städtischen Friedhofs erlebt Rehs als dramatisch. Er macht diesen an folgenden Entwicklungen fest:1
–Die Anzahl der Urnenbestattungen auf dem Hauptfriedhof in Kassel sei von knapp 35 % (1973) auf 75 % (2017) gestiegen. Der Anteil in den Stadtteilfriedhöfen sei geringer, dort gebe es noch etwas mehr als 50 % Erdbestattungen, die Menschen seien hier teilweise noch »traditioneller« eingestellt; auf dem Westfriedhof sei die Erdbestattungsquote besonders hoch, da hier viele Russlanddeutsche und Muslim*innen ihre letzte Ruhestätte fänden.
–Die Anzahl der Beisetzungen auf dem Hauptfriedhof in Kassel sei von 1527 (1973) auf 397 (2017) zurückgegangen. Das habe verschiedene Ursachen, unter anderem habe die Zulassung von Friedwaldbestattungen im Jahr 2001 (im nahe gelegenen Reinhardwald als dem ersten Friedwald in Deutschland) diese Entwicklung gefördert, auch habe die Anzahl der Seebestattungen stark zugenommen.
–Der Hauptfriedhof biete inzwischen eine Vielfalt von Gräbern an: elf verschiedene Formen der Urnenbestattung, darunter anonyme Urnenreihengräber, Urnenreihengräber mit Stein, Urnenwahlgräber, »Kulturgrabstätten« (mit Förderung des Denkmalschutzes) oder »Baumgräber« als Alternative zu Ruheforst und Friedwald; die Kosten für eine Urnenbestattung (ohne Einäscherung) liegen zwischen 909 Euro und 8855 Euro (Stand 2018), sind aber in der Regel deutlich geringer als bei einer Erdbestattung.
–Immer stärker sei die Nachfrage nach pflegelosen Gräbern, immer geringer werde der traditionelle Besuch auf dem Friedhof auch am Totensonntag; die Anzahl der kirchlichen Bestattungen gehe deutlich zurück, zudem seien die Kapellen und Räume oft viel zu groß für die kleinen Trauergemeinden.
Die Einblicke weisen unverkennbar Lokalkolorit auf, zumal alle Kasseler Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft liegen. Dennoch stimmen sie anschaulich und konkret auf den Wandel der Bestattungskultur am Beispiel eines städtischen Friedhofs ein.
1.1Historische Skizze
Die Geschichte der christlichen Bestattung ist mit kulturgeschichtlichen (Wandel der Trauerkultur), theologiegeschichtlichen (Deutungen von Sterben, Tod und Auferstehung) und pastoraltheologischen (Begleitung von Sterbenden und Trauernden) Phänomenen und Entwicklungen der Bestattungspraxis verbunden. Die folgende Skizze konzentriert sich auf die für die Praxis des Bestattens wesentlichen Aspekte.
In der biblischen Tradition finden sich keine Schlüsselstellen, aus denen eine Theologie oder Pastoraltheologie des Bestattens zu entwickeln wäre. Es gibt nur einzelne Stellen, von denen aus auf ein biblisches Grundverständnis von Tod und Bestatten geschlossen werden kann.
In biblischer Tradition erscheint das Bestatten als eine Aufgabe der Familie, die offensichtlich mit der Armenfürsorge verbunden ist (siehe Tobias 4,3–11). Typisch biblisch ist eine Art gelassener Realismus im Umgang mit dem Tod: Er wird ernst genommen, ohne ihn zu dramatisieren. So hält Jesus Sirach dazu an (38,16–24), die Trauer nicht übermächtig werden zu lassen:
»Denn vom Trauern kommt der Tod, und die Traurigkeit des Herzens schwächt die Kraft.« (Sirach 38,18)
Diesen gelassenen Realismus spiegelt auch die Botschaft von der Auferstehung Jesu, die das christliche Verständnis von Sterben und Tod bestimmt: Sie werden »entdramatisiert, ohne […] überspielt zu werden« (Grethlein 2007, 274). Auch das jesuanische Wort: »Lass die Toten ihre Toten begraben …« (Lk 9,60) lässt davon etwas erkennen, da es als Plädoyer verstanden werden kann, dem Tod und dem Ritus des Bestattens nicht zu viel Platz im Leben einzuräumen. Da, »wo keine Hoffnung war« (Röm 4,18), hofft der Glaube auf Gott, »der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei« (Röm 4,17).
Die Sprache dieser Hoffnung sind Bilder. In ihnen verdichten sich die Würde des Einzelnen (Lk 10,20: »eure Namen im Himmel geschrieben«), die himmlische »Heimat« bei Gott (2 Kor 5,8: »daheim zu sein bei dem Herrn«) oder ein sozialkritisches Verständnis derer, die im Reich Gottes »zu Tisch sitzen« (Lk 13,29) werden: Der Zugang zum Himmel ist »überraschend weit und nicht reguliert nach welthaften Maßstäben« (Röhring/Kemler 2000, 51).
Die biblischen Erzählungen setzen als Bestattungsart die Erdbestattung oder die Bestattung in Felsengräbern voraus. Das Verbrennen gilt im Alten Testament als Strafe (siehe Gen 38,24). Im Neuen Testament werden der Trauerzug (Lk 7,12), das Bestellen von Klagefrauen (Mk 5,38) und das Verhüllen des Gesichts der Verstorbenen (Joh 11,44) erwähnt. Als Jesus bestattet wird, war er in ein Leinentuch gewickelt (Mk 15,46; Mt 27,59 f.); die Art, wie er bestattet worden ist, ist – unterstützt von gesetzlichen Regelungen – bis in die Zeit der Aufklärung kulturprägend:
»Und Josef (aus Arimathäa) nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon.« (Mt 27,59 f.)
Das pietätvolle Bestatten des Leichnams entspricht der theologischen Deutung des Leibes als »Tempel des Heiligen Geistes« (1 Kor 6,19); Leiber, die auf die Auferstehung warten, »dürfen nach ihrem Tod nicht nachlässig behandelt werden, obwohl der natürliche Leib vom geistlichen zu unterscheiden ist« (Winkler 1995, 167).
In der alten Kirche wird das Bestatten in Ergänzung der neutestamentlichen Werke der Barmherzigkeit (Mt 25,35–46: Hungrigen zu essen geben, Durstigen zu Trinken geben, Fremde aufnehmen, Nackte bekleiden, Kranke aufnehmen, Gefangene besuchen) als siebtes Werk der Barmherzigkeit aufgefasst.
Die Bestattungspraxis orientiert sich an der griechisch-römischen Kultur. Zur Vorbereitung werden den Toten Augen und Mund geschlossen; sie werden gewaschen, in Tücher gehüllt, aufgebahrt und von einem Leichenzug zum Bestattungsplatz begleitet. Einzelne Riten werden christlich akzentuiert und umgedeutet. Die Toten werden mit dem Gesicht nach Osten bestattet; an die Stelle der Totenklage tritt der Psalmengesang und an die Stelle des Totenopfers das Abendmahl am offenen Grab – Ansatzpunkt für die Entwicklung der mittelalterlichen Totenmesse. Die Leichenverbrennung ist verboten, sie widerspricht der Auferstehungshoffnung sowie dem sich entwickelnden Reliquienkult mit der Bestattung ad sanctos, also in der Nähe von Märtyrern und Heiligen. So entwickelt sich die christliche Bestattungskultur in der Wahl des Ortes und der Art der Bestattung in Abgrenzung zur römisch-antiken Kultur. In diesem Sinn erlässt Karl der Große 785 das Verbot der Leichenverbrennung und der Bestattung auf heidnischen Grabhügeln (Happe 2015, 254).
Schon früh werden auch Fürbitten für die Verstorbenen erwähnt. Die Leichenrede wird in der Tradition der antiken Leichenrede (laudatio funebris) gehalten; bemerkenswert ist, »wie stark die antike Rhetorik in die christliche Verkündigung hineinwirkt« (Winkler 1995, 168). In der »Güte gegenüber Fremden« und der »Sorgfalt, die sie auf die Bestattung ihrer Toten verwenden«, sieht der römische Kaiser Julian wesentliche Gründe für die Anziehungskraft der christlichen Religion (siehe Grethlein 2007, 275).
Aus dem Abendmahl am offenen Grab entwickelt sich in einem längeren Prozess im Mittelalter die Tradition der Totenmesse (missa pro defunctis), tradiert im »Missale Romanum«. Die Messe hat drei Grundelemente: Aussegnung im Sterbehaus, Messe in der Kirche und Grablegung. Der Beginn der Totenmesse (Introitus) ist von dem Flehen für das Seelenheil der Verstorbenen bestimmt. Der Begriff »requiem« ist das erste Wort des Introitus »Gib ihnen ewige Ruhe« (requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis). Er bezeichnet auf der einen Seite die Liturgie der Totenmesse, auf der anderen Seite kirchenmusikalische Kompositionen für das Totengedenken. Der Totenmesse voraus gehen Riten der Sterbebegleitung; auf die Feier folgen das Totengedenken am zweiten, siebten und dreißigsten Tag nach dem Tod sowie das Jahresgedenken.
Die Sorge um die Toten in Form von Segnung, Fürsprache und Hilfe wird zum zentralen Thema; es entwickelt sich eine christliche Frömmigkeit der Totenfürsorge: Messopfer, Gebet und Almosen gelten als »Seelgerät«, um etwas für die Toten machen und ihre Seelenqualen lindern zu können. Als Ausdruck dieser Frömmigkeit finden sich in Grabsteinen kleine Wasserschalen, um beim Besuch des Verstorbenen das Grab rituell besprengen und damit die Seelenqualen des Verstorbenen mildern zu können. Biblischer Bezugspunkt dieser Totenfürsorge ist die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus (»… und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge; denn ich leide Pein in dieser Flamme«, siehe Lk 16,21–24).
Mit der Reformation verbindet sich eine religionskulturelle Zäsur. Sie manifestiert sich in besonderer Weise in einer neuen Form der Frömmigkeit und Friedhofskultur.
An die Stelle der rituellen Totenfürsorge tritt der Trost für die Hinterbliebenen. Die Reformation lehnt die Totenmesse ab und richtet den Blick ganz auf die Trauernden. Der Glaube könne nichts für die Toten, sondern nur für die Trauernden tun, ihnen das Evangelium verkündigen und sie mit der biblischen Botschaft trösten. An die Stelle der Totenfürsorge tritt programmatisch die Auferstehungspredigt. Dem Totengebet räumt Luther noch ein gewisses Recht im Privaten ein, von Calvin wird es abgelehnt.
Ein eigenes Formular für die Bestattung wird nicht entwickelt, die vorreformatorischen Formen werden weitgehend beibehalten. Nicht nur die Form, auch Ort und Bestattungsart bleiben theologisch sekundär. So kann Luther auf dem Hintergrund von Pest und steigenden Hygienebedürfnissen nicht nur der Leichenverbrennung zustimmen, sondern auch Begräbnisplätze außerhalb von Ortschaften empfehlen: Es kämen auch die »Elbe« oder der »Wald« infrage, wesentlich sei nur, dass der Ort so hergerichtet sei, dass er »die, die darauf gehen wollen, zur Andacht reizte« (Luther 1527/1982, 249). Auch damit ist eine religionskulturelle Zäsur verbunden: War bisher die Vorstellung leitend, dass die Nähe zu Altar, Reliquien oder der Kirche eine Form der Totenfürsorge sei, wird auch dieser Form der Frömmigkeit widersprochen.
Ein eindrückliches Dokument reformatorischer Frömmigkeit im Umfeld von Sterben und Tod ist Luthers »Sermon von der Bereitung zum Sterben« (1519). Er kann als eine »reformatorische Transformation der ars moriendi« (Grethlein 2007, 283) gelesen werden. Der Sermon rät, mit Bildern des Guten die Angst vor Sterben und Tod zu vertreiben.





























