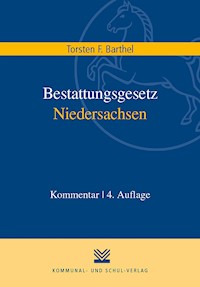
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kommunal- und Schul-Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Praxis-Ausgabe erläutert die einzelnen Vorschriften des Bestattungsgesetzes Niedersachsen umfassend und praxisorientiert und lässt auch die aktuellen Entwicklungstendenzen – wie z.B. die Bestattung von Muslimen, Ausnahmen von Friedhofs- und Bestattungszwang, Privatisierung von Bestattungseinrichtungen – nicht aus. Bereits die 1. Auflage des Werkes wurde in Fachkreisen mit Anerkennung aufgenommen: "Es scheint, Barthel übertreffe hier sogar das Standardwerk von Gaedke/Diefenbach zum Friedhofs- und Bestattungsrecht an Genauigkeit und Aktualität. Zum anderen – und dies ist nicht hoch genug anzurechnen – bedient der Kommentar zielgruppengerecht den Praktiker. […] Barthel hat offenbar ein neues Standardwerk des Friedhofs- und Bestattungsrechts geschaffen. Für den Praktiker in Niedersachsen ist eine neue Pflichtlektüre entstanden." (Prof. Holger Weidemann in Friedhofskultur 2006, Heft 11, S. 44). Der Verfasser hat in seiner Kommentierung alle wesentlichen Rechtsvorschriften des Landes- und des Bundesrechts ebenso wie die aktuelle Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit berücksichtigt. Themenpunkte sind: Friedhofswesen, Grabstätten, Verkehrssicherungspflicht, Satzungsrecht, Gestaltungsvorschriften, Bestattungspflicht alleinstehender Verstorbener (auch § 74 SGB XII) und Kosten. Daneben finden sich Musterbescheide wie Anhörungs-, Leistungsbescheide und Ordnungsverfügungen. Der kompetente Praxis-Kommentar eignet sich für die Kommunalverwaltung und deren Friedhofsverwaltungen, die Polizei- und Ordnungsbehörden, Bestattungsinstitute und Kirchen, Friedhofs-Dienstleister, Verwaltungsgerichte, Rechtsanwälte, alle interessierten Einzelpersonen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 743
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BestattungsgesetzNiedersachsen
Kommentar
von
Dr. Torsten F. Barthel, LL.M.Rechtsanwalt, Berlin, Justiziar der ArbeitsgemeinschaftFriedhof und Denkmal (AFD), Kassel
4. Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© Copyright 2006 Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG · Wiesbaden
4. Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
Satz: C.H.Beck.Media.Solutions · Nördlingen
ISBN 978-3-8293-1373-5
eISBN 978-3-8293-1398-8
Bestattungsgesetz Niedersachsen
KOMMENTAR
von Dr. Torsten F. Barthel, LL.M., Rechtsanwalt, Berlin, Justiziar der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal (AFD), Kassel
Inhaltsübersicht
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (Nds. BestattG)– Text –
Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (Nds. BestattG)– Kommentar –
Einführung
§ 1Grundsatz
§ 2Begriffsbestimmungen
§ 3Verpflichtung zur ärztlichen Leichenschau
§ 4Durchführung der Leichenschau
§ 5Innere Leichenschau
§ 6Todesbescheinigungen und Datenschutz
§ 7Aufbewahrung und Beförderung von Leichen
§ 8Bestattung
§ 9Zeitpunkt der Bestattung, Bestattungsdokumente
§ 10Bestattungsarten
§ 11Erdbestattung
§ 12Feuerbestattung
§ 13Friedhöfe
§ 14Mindestruhezeiten
§ 15Ausgrabungen und Umbettungen
§ 16Aufhebung von Friedhöfen
§ 17Vollstreckungshilfe
§ 18Ordnungswidrigkeiten
§ 19Übergangsvorschriften
§ 20Zuständigkeit, Kostendeckung
§ 21Aufhebung von Vorschriften
§ 22In-Kraft-Treten
Anhang
1.Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.1.2012 (BGBl. I S. 98), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 23.7.2013 (BGBl. I S. 2586)
2.Internationales Abkommen über Leichenbeförderung vom 10.2.1937 (RGBl. 1938 II S. 199)
3.Strafprozeßordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.4.1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 30.10.2017 (BGBl. I S. 3618)
4.Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) in der Fassung vom 25.4.2007 (Nds. GVBl. S. 172), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 15.2.2016 (Nds. GVBl. S. 301) – Auszug –
5.Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.1.2005 (Nds. GVBl. S. 9), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 6.4.2017 (GVBl. S. 106) – Auszug –
6.Mustertext für eine Friedhofssatzung
7.Verordnung über die Todesbescheinigung (TbVO) vom 5.6.2009 (Nds. GVBl. 2009 S. 230), geändert durch Verordnung vom 15.10.2014 (Nds. GVBl. S. 300)
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Bis Ende 2005 war das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen in Niedersachsen unübersichtlich in veralteten Rechtsvorschriften wie etwa dem Nds. Leichenwesengesetz sowie z. T. durch Gewohnheitsrecht geregelt und entsprach den heutigen Anforderungen bei Weitem nicht mehr. Als eines der letzten Bundesländer nahm das Land Niedersachsen durch den Erlass des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (Nds. BestattG) die Chance wahr, sein Bestattungsrecht zu modernisieren.
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung sind politische Schwerpunkte im Land und im Bund. Der seinerzeitige Ministerpräsident hatte bereits in seiner Regierungserklärung 2003 angekündigt, die Zahl der Gesetze und Verordnungen, vor allem aber die der Verwaltungsvorschriften, erheblich zu reduzieren. Ziel des Nds. BestattG ist daher auch der Abbau entbehrlicher Rechtsvorschriften und bürokratischer Belastungen durch Deregulierung. Es sollten lediglich insoweit Regelungen geschaffen werden, als juristische und/oder gesundheitliche Aspekte eine einheitliche Verfahrensweise erforderlich machen. Wo dies nicht der Fall ist, wird den bestattungsberechtigten Personen für die Totenfürsorge bzw. im Friedhofswesen den Gemeinden und Kirchen sowie anderen Religions- und Weltanschauungsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, Handlungsfreiheit eingeräumt. Diese Gesetzesziele sind zum Teil erreicht worden.
Das am 1.1.2006 in Kraft getretene Gesetz greift bewährte friedhofs- und bestattungsrechtliche Prinzipien auf und kann in seiner Gesamtdiktion als konservativ gelten, wenngleich einige liberale Ansätze durchweg nicht zu verkennen sind. Allerdings hat der Gesetzgeber sich in Niedersachsen (noch) nicht zu einer Freigabe des Friedhofswesens hin zu nicht öffentlich-rechtlichen Trägern, zur Abschaffung des Friedhofszwangs und zu einer Urnenaufbewahrungsmöglichkeit „zu Hause“ entschließen können.
Ein überall spürbarer gesellschaftlicher Sinneswandel im Umgang mit dem Thema „Tod“ zu einer Diskussion um die weit reichende Ablösung staatlich verordneter Uniformität durch an den Freiheitsgrundrechten orientierte individuelle Bestattungsformen. Dass das Friedhofs- und Bestattungsrecht durchweg kein statisches Rechtsgebiet (mehr) ist, wird auch durch die seinerzeitigen Debatten mit langwierigen und kontroversen Diskussionen im Gesetzgebungsverfahren (vgl. etwa Protokoll der 76. Plenarsitzung des Nds. Landtages am 7.12.2005 [S. 8653–8863]) und an Themen wie „Bestattung von Fehlgeburten“, „Friedwälder“ und der Marktöffnung für Krematorien deutlich. Kontroverse Diskussionen drehen sich thematisch u. a. auch um eine Freigabe des Friedhofswesens hin zu nicht öffentlich-rechtlichen Trägern, um die Abschaffung des Friedhofszwangs und hin zu einer Urnenaufbewahrungsmöglichkeit „zu Hause“. Auch werden Rechtsfragen um „Tod und Trauer im World Wide Web“ in der Fachliteratur behandelt (vgl. Spranger, Friedhofskultur 2014, Heft 1, S. 32–33).
Eine erste Novellierung des Nds. BestattG war für das Jahr 2017 geplant, fiel dann aber wegen Neuwahlen der Diskontinuität zum vorzeitigen Ende der Legislaturperiode zum Opfer. In einem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen waren Neuregelungen über
–die Einführung einer erweiterten Leichenschau,
–die Einführung von Meldepflichten in konkreten Situationen bei der äußeren Leichenschau,
–den Schutz vor ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der Konvention ILO 182,
–die öffentliche Ausstellung von Leichen,
–die Zulassung neuer Bestattungsformen,
–die Bestattung ohne Sarg, zum Beispiel im Leichentuch,
–die Beisetzung in einer Gruft oder im Mausoleum (oberirdische Bestattungsformen),
–die Gebühren für die Inanspruchnahme von Friedhofsleistungen,
–die Ruhezeiten und
–die Umbettung
vorgesehen. Mit diesen Änderungen sollte das Bestattungsgesetz zukunftsorientiert weiterentwickelt und rechtssicher ausgestaltet werden. Gegenwärtig wird das ambitionierte Gesetzgebungsvorhaben allerdings nicht weiterverfolgt.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Fortschritte in Gesetzgebung und Rechtsprechung hinsichtlich der Modernisierung dieses immer noch betont anstaltsrechtlich geprägten Rechtsgebietes weiterhin gestalten werden.
Die Entwicklung in den Ländern verläuft durchaus unterschiedlich, so dass man sagen kann: Das Rechtsgebiet des Friedhofs- und Bestattungsrechts bietet erlebbaren Föderalismus. Seine praktische Bedeutung dabei ist nicht zu unterschätzen, es betrifft das tägliche Verwaltungsgeschäft der Ordnungsbehörden und der kommunalen sowie kirchlichen Friedhofsträger.
Die vorliegende Kommentierung wendet sich an den Nutzerkreis der Reihe Praxis der Kommunalverwaltung, also insbesondere an die Praktiker in Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städte, welche das Gesetz auszuführen haben. Diesem Ansatz wird die Gewichtung der Einzelthemen gerecht, ohne die erforderliche Tiefenschärfe zu vernachlässigen. Nachdem das Werk von Anfang an sehr freundlich aufgenommen worden war, sind weitere Erfahrungen aus Rechtsprechung und Praxis aufgenommen worden. Insbesondere die Kommentierung des kommunal besonders relevanten § 8 BestattG wurde wiederum erweitert; die Problematik der Verkehrssicherungspflichten (Stichwort: Inkrafttreten der BIV-Richtlinie 2017) vertieft. Somit ist der Kommentar auf den neuesten Stand gebracht worden.
Für Verbesserungsvorschläge und Anregungen ist der Verfasser stets dankbar. Diese können per E-Mail ([email protected]) oder über den Verlag zugeleitet werden.
Februar 2018
Torsten F. Barthel
Abkürzungsverzeichnis
a. A.
=anderer Ansicht
a. a. O.
=am angegebenen Ort
Abs.
=Absatz
a. E.
=am Ende
a. F.
AG
=Amtsgericht, Aktiengesellschaft
Alt.
=Alternative
AöR
=Archiv des öffentlichen Rechts (Zeitschrift)
Art.
=Artikel
BAnz
=Bundesanzeiger
Bay
=Bayern, bayerisch
BayVBl
=Bayerische Verwaltungsblätter (Zeitschrift)
BDAK
=Bundesarbeitsgemeinschaft der Deutschen Kommunalversicherer
Beschl.
=Beschluss
BestattG
=Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Niedersachsen
BestG
=Bestattungsgesetz
BestGew
=Das Bestattungsgewerbe (seit April 2002: Bestattungskultur), (Zeitschrift)
BestG NRW
=Bestattungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
BestV
=Bestattungsverordnung
BGB
=Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
=Bundesgesetzblatt
BGH
=Bundesgerichtshof
BGHZ
BImSchG
=Bundes-Immissionsschutzgesetz
BSHG
=Bundessozialhilfegesetz (veraltet)
Buchholz
=Sammelwerk der Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
BVerfG
BVerfGE
BVerwG
BVerwGE
BWGZ
=Baden-Württembergische Gemeindezeitung (Zeitschrift)
bzw.
=beziehungsweise
Can
=canon
CIC
=Codex Iuris Canonici
cm
=Zentimeter
ders.
DFK
DIN
=Deutsches Institut für Normung
DÖV
=Die Öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)
Drs.
=Drucksache
DSchG
=Denkmalschutzgesetz
DStZ
DVBl
=Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift)
DVP
EGInsO
=Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung
Erl.
=Erläuterung(en)
ESVGH
=Entscheidungssammlung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes
FamRZ
=Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
FK
=Friedhofskultur (Zeitschrift); bis August 1997: DFK
GBl.
=Gesetzblatt
GG
=Grundgesetz
GVBl.
=Gesetz- und Verordnungsblatt
HGZ
=Hessische Gemeindezeitung
h. M.
=herrschende Meinung
HPflG
=Haftpflichtgesetz
hrsg.
=herausgegeben
Hrsg.
=Herausgeber(in)
i. d. F.
=in der Fassung vom
i. E.
=im Ergebnis
IfSG
=Infektionsschutzgesetz
i. S. d.
=im Sinne des (der)
i. V. m.
=in Verbindung mit
i. w. S.
=im weiteren Sinne
JURA
=Juristische Ausbildung (Zeitschrift)
JuS
=Juristische Schulung (Zeitschrift)
JW
=Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
KAG
=Kommunalabgabengesetz
Kap.
=Kapitel
KirchE
=Entscheidungen in Kirchensachen (Entscheidungssammlung)
KostO
=Kostenordnung
KStZ
=Kommunale Steuerzeitschrift
LG
=Landgericht
LKV
=Landes- und Kommunalverwaltung (Zeitschrift)
LPartG
=Lebenspartnerschaftsgesetz
LReg
=Landesregierung
LSA
LT-Drs.
=Landtagsdrucksache
MBl.
MDR
=Monatsschrift für Deutsches Recht (Zeitschrift)
MedR
M-V
=Mecklenburg-Vorpommern
m. w. N.
=mit weiteren Nachweisen
Nds.
=Niedersachsen, niedersächsisch
Nds. SOG
=Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
NdsVBl.
=Niedersächsische Verwaltungsblätter (Zeitschrift)
NGO
=Niedersächsische Gemeindeordnung (veraltet)
NJW
NJW-RR
=NJW-Rechtsprechungsreport (Zeitschrift)
NKomVG
=Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKomZG
=Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit
NordÖR
=Zeitschrift für Öffentliches Recht in Norddeutschland
Nr./Nrn.
=Nummer(n)
NRW, NW
=Nordrhein-Westfalen
NStrG
=Niedersächsisches Straßengesetz
n. v.
=nicht veröffentlicht
NVwKostG
=Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz
NVwZ
NVwZ-RR
=NVwZ-Rechtsprechungsreport (Zeitschrift)
NWVBl.
=Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter (Zeitschrift)
OLG
=Oberlandesgericht
OLGZ
OVG
=Oberverwaltungsgericht
OVGE
OWiG
=Ordnungswidrigkeitengesetz
PStG
PStV
=Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
Rdnr(n).
=Randnummer(n)
RG
=Reichsgericht
RGBl.
=Reichsgesetzblatt
RGZ
RiStBV
=Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren
s.
=siehe
S.
=Seite
SGB XII
=Sozialgesetzbuch, 12. Buch – Sozialhilfe –
SGV
SOG LSA
=Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt
Sp.
=Spalte
StGB
=Strafgesetzbuch
StPO
=Strafprozessordnung
StVG
=Straßenverkehrsgesetz
StVO
=Straßenverkehrsordnung
TPG
=Transplantationsgesetz
u. Ä.
=und Ähnliches
Urt.
=Urteil
usw.
=und so weiter
UWG
=Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.
=vom, von
VBlBW
=Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg (Zeitschrift)
VerfGH
=Verfassungsgerichtshof
VerfGHE
VersR
=Versicherungsrecht (Zeitschrift)
VerwArch
=Verwaltungsarchiv (Zeitschrift)
VG
=Verwaltungsgericht
VGH
=Verwaltungsgerichtshof
VGHE
vgl.
=vergleiche
VO
=Verordnung
VwGO
=Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG
=Verwaltungsverfahrensgesetz
WRP
=Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift)
WRV
z. B.
=zum Beispiel
ZevKR
=Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht
ZfSH/SGB
=Sozialrecht in Deutschland und Europa (Zeitschrift)
ZustVO
=Zuständigkeitsverordnung
Literaturverzeichnis
Barthel, Torsten F. Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (BestG LSA), Kommentar, 2. Aufl., Wiesbaden 2013
Barthel, Torsten F., Gaedke, Jürgen Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts, 11. Aufl., Köln 2016
Deinert, Horst/Jegust, Wolfgang/Lichtner, Rolf Todesfall- und Bestattungsrecht, Sammlung bundes- und landesrechtlicher Bestimmungen, 5. Aufl., Düsseldorf 2014
Fischer, Norbert Zwischen Trauer und Technik, Feuerbestattung, Krematorium, Flamarium. Eine Kulturgeschichte, Berlin 2002
Gabriel, Friedhelm/Huckenbeck, Wolfgang Grundlagen der Rechtsmedizin für die Praxis, Düsseldorf 2004
Großes Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Wörterbuch zur Sepulkralkultur, bearbeitet von Sörries, Reiner, hrsg. vom Zentralinstitut für Sepulkralkultur, Band 1, Kassel 2002; Band 2, Kassel 2005, Band 3, Kassel 2010
Hönes, Ernst-Rainer Kernfragen des Rechts des Bestattungs- und Friedhofswesens, LKV 2002 S. 49–57
Horn, Thomas Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Kommentar, 2. Aufl., Kiel 2009
Husvogt, Frank Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Kommentar, 2. Aufl., Wiesbaden 2012
Klatt, Richard u. a. Thanatopraxie in Deutschland – Lehrbuch, Düsseldorf 2001
Klingshirn, Heinrich (Begr.) Bestattungsrecht in Bayern, Stuttgart 1971, Loseblattsammlung, 30. Ergänzungslieferung, Stand: Oktober 2015
Lichtner, Rolf (Hrsg.) Bestattung in Deutschland – Lehrbuch, 2. Aufl., Düsseldorf 2015
Menzel, Matthias/Hamacher, Claus Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW), Kommentar, 3. Aufl., Wiesbaden 2015
Müller-Hannemann, Hannes-Rainer (Hrsg.) Lexikon Friedhofs- und Bestattungsrecht, und zu anderen friedhofsrelevanten Gebieten, Hannover 2002
Spranger, Tade Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Kommentar, 3. Aufl., Stuttgart 2015
Spranger, Tade Ordnungsamtsbestattungen, Berlin 2011
Völsing, Willibald (Hrsg.) Die Feuerbestattung – Weg und Wirkung, Giesen/Hasede 2001
Widmann, Hans-Joachim Der Bestattungsvertrag, 6. Aufl., Köln 2015
Internetseiten
Als Informationsquellen über Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung sowie interessante Themen des Leichen-, Friedhofs- und Bestattungswesens können die folgenden Internetseiten dienen:
www.dejure.org Rechtsdatenbank zum aktuellen Bundesrecht
www.rechtsprechung.niedersachsen.de Rechtsprechung der niedersächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
www.bverwg.de Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
www.bundesverfassungsgericht.de Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Entscheidungen ab 1.1.1998)
www.postmortal.de Diese Seite enthält ein weites Kompendium auch rechtlich relevanter Inhalte. Es finden sich Rechtsvorschriften und Aufsätze.
www.aeternitas.de Homepage der Verbraucherinitiative Aeternitas e. V. zur Bestattungskultur
www.bestattungsinstitut.de Zahlreiche und übersichtlich sortierte Links zu anderen Seiten im Zusammenhang mit dem Bestattungswesen. Die Seite ist daher als Ausgangspunkt einer Suche in diesem Bereich gut geeignet.
www.bestatter.de Homepage des Bundesverbandes des deutschen Bestattungsgewerbes e. V. (BDB): Informationen über den BDB, Leitfaden sowie Adressen
www.dauergrabpflege.de Informationen über die Dauergrabpflege und andere Leistungen, die von Friedhofsgärtnern erbracht werden.
www.friedhof-und-denkmal.de Homepage der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V., s. auch Museum für Sepulkralkultur
www.friedhof-hamburg.de Informationen zu Hamburger Friedhöfen, Bilanz der Anstalt des öffentlichen Rechts „Die Hamburger Friedhöfe“.
www.biv-steinmetz.de Homepage des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetzhandwerks
www.kgst.de Homepage der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Es findet sich hier ein Zugang zum Informations- und Kommunikationssystem der KGSt.
www.nwstgb.de Homepage des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen mit Rechtsprechung und einer Auswahl von Mustersatzungen, u. a. auch Musterfriedhofssatzung.
Gesetzüber das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen(BestattG)
vom 8. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 381) – VORIS 21068 –
– Text –
Inhaltsübersicht
§ 1Grundsatz
§ 2Begriffsbestimmungen
§ 3Verpflichtung zur ärztlichen Leichenschau
§ 4Durchführung der Leichenschau
§ 5Innere Leichenschau
§ 6Todesbescheinigungen und Datenschutz
§ 7Aufbewahrung und Beförderung von Leichen
§ 8Bestattung
§ 9Zeitpunkt der Bestattung, Bestattungsdokumente
§ 10 Bestattungsarten
§ 11 Erdbestattung
§ 12 Feuerbestattung
§ 13 Friedhöfe
§ 14 Mindestruhezeiten
§ 15 Ausgrabungen und Umbettungen
§ 16 Aufhebung von Friedhöfen
§ 17 Vollstreckungshilfe
§ 18 Ordnungswidrigkeiten
§ 19 Übergangsvorschriften
§ 20 Zuständigkeit, Kostendeckung
§ 21 Aufhebung von Vorschriften
§ 22 In-Kraft-Treten
§ 1Grundsatz
Leichen und Aschen Verstorbener sind so zu behandeln, dass die gebotene Ehrfurcht vor dem Tod gewahrt wird und das sittliche, religiöse und weltanschauliche Empfinden der Allgemeinheit nicht verletzt wird.
§ 2Begriffsbestimmungen
(1) 1 Leiche ist der Körper eines Menschen, der keine Lebenszeichen mehr aufweist und bei dem der körperliche Zusammenhang noch nicht durch den Verwesungsprozess völlig aufgehoben ist. 2 Leichen sind auch Totgeborene (Absatz 3 Satz 1), jedoch mit Ausnahme der Fehlgeborenen (Absatz 3 Satz 2), und die den Totgeborenen entsprechenden Ungeborenen (Absatz 3 Satz 3).
(2) Ist der körperliche Zusammenhang des menschlichen Körpers in anderer Weise als durch Verwesung aufgehoben worden, so gelten auch der Kopf und der Rumpf bereits als Leiche.
(3) 1 Eine Leiche ist auch eine Leibesfrucht mit einem Gewicht von mindestens 500 Gramm, bei der nach der Trennung vom Mutterleib kein Lebenszeichen (Herzschlag, pulsierende Nabelschnur oder Einsetzen der natürlichen Lungenatmung) festgestellt wurde (Totgeborenes). 2 Fehlgeborenes ist eine tote Leibesfrucht mit einem Gewicht unter 500 Gramm.3 Die Leibesfrucht aus einem Schwangerschaftsabbruch (Ungeborenes) gilt unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ebenfalls als Leiche.
(4) Friedhöfe sind alle von einem Träger nach § 13 Abs. 1 für die Beisetzung Verstorbener oder deren Asche besonders gewidmeten und klar abgegrenzten Grundstücke, Anlagen oder Gebäude bis zu deren Aufhebung.
§ 3Verpflichtung zur ärztlichen Leichenschau
(1) Jede Leiche ist zur Feststellung des Todes, des Todeszeitpunktes, der Todesart und der Todesursache von einer Ärztin oder einem Arzt äußerlich zu untersuchen (Leichenschau).
(2) 1 Die Leichenschau haben in folgender Rangfolge unverzüglich zu veranlassen
1.die zum Haushalt der verstorbenen Person gehörenden Personen,
2.die Person, in deren Wohnung oder Einrichtung oder auf deren Grundstück sich der Sterbefall ereignet hat, und
3.jede Person, die bei dem Tode zugegen war oder die Leiche auffindet.
2 Die Pflicht nach Satz 1 kann auch durch Benachrichtigung der Polizei erfüllt werden.
(3) 1 Zur Vornahme der Leichenschau sind verpflichtet:
1.beim Sterbefall in einem Krankenhaus oder einer anderen Einrichtung, zu deren Aufgaben auch die ärztliche Behandlung der aufgenommenen Personen gehört, die diensthabenden Ärztinnen und Ärzte der Einrichtung,
2.beim Sterbefall außerhalb einer in Nummer 1 genannten Einrichtung die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, denen der Sterbefall bekannt gegeben worden ist, sowie die Ärztinnen und Ärzte im Notfall- oder Rettungsdienst und
3.im Übrigen eine Ärztin oder ein Arzt der für den Sterbe- oder Auffindungsort zuständigen unteren Gesundheitsbehörde.
2 Die Leichenschau kann auf die Feststellung des Todes beschränken, wer durch weitere Feststellungen sich selbst oder eine in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichnete Person der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde, wenn dafür gesorgt ist, dass eine andere Ärztin oder ein anderer Arzt eine vollständige Leichenschau durchführt.
(4) 1 Ärztinnen und Ärzte im Notfall- oder Rettungsdienst können sich auf die Feststellung des Todes sowie des Todeszeitpunktes oder des Zeitpunktes der Leichenauffindung beschränken, wenn sie durch die Durchführung der vollständigen Leichenschau an der Wahrnehmung der Aufgaben im Notfall- oder Rettungsdienst gehindert wären und, insbesondere durch Benachrichtigung der Polizei, dafür sorgen, dass eine andere Ärztin oder ein anderer Arzt eine vollständige Leichenschau durchführt. 2 Die Ärztinnen und Ärzte im Notfall- oder Rettungsdienst haben im Fall des Satzes 1 unverzüglich eine auf die getroffenen Feststellungen beschränkte Todesbescheinigung auszustellen.
§ 4Durchführung der Leichenschau
(1) 1 Die Leichenschau ist unverzüglich durchzuführen. 2 Sie soll an dem Ort vorgenommen werden, an dem sich die Leiche zum Zeitpunkt der Hinzuziehung der Ärztin oder des Arztes (§ 3 Abs. 3) befindet. 3 Befindet sich die Leiche nicht in einem geschlossenen Raum oder lässt sich dort eine Leichenschau nicht ordnungsgemäß durchführen, so kann sich die Ärztin oder der Arzt auf die Todesfeststellung beschränken, wenn sichergestellt ist, dass die vollständige Leichenschau an einem geeigneten Ort durchgeführt wird. 4 Die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Leichenschau durchführen will, und die von der Ärztin oder dem Arzt als Helferin oder Helfer hinzugezogene Person dürfen jederzeit den Ort betreten, an dem sich die Leiche befindet; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird eingeschränkt.
(2) Die Leichenschau ist sorgfältig durchzuführen; sie hat an der vollständig entkleideten Leiche zu geschehen und alle Körperregionen einzubeziehen.
(3) 1 Angehörige sowie Personen, die die verstorbene Person behandelt oder gepflegt haben, sind verpflichtet, der Ärztin oder dem Arzt auf Verlangen Auskunft über Krankheiten und andere Gesundheitsschädigungen der verstorbenen Person und über sonstige für ihren Tod möglicherweise ursächliche Ereignisse zu erteilen. 2 Sie können die Auskunft verweigern, soweit sie durch die Auskunft sich selbst oder eine in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichnete Person der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würden.
(4) 1 Besteht ein Anhaltspunkt für einen nichtnatürlichen Tod, ist die Todesart ungeklärt oder kann die Ärztin oder der Arzt die verstorbene Person in angemessener Zeit nicht identifizieren, so ist sie oder er verpflichtet, unverzüglich die Polizei oder die Staatsanwaltschaft zu benachrichtigen. 2 Die Ärztin oder der Arzt hat in einem solchen Fall von der Leichenschau abzusehen oder diese zu unterbrechen und bis zum Eintreffen der Polizei oder der Staatsanwaltschaft darauf hinzuwirken, dass keine Veränderungen an der Leiche und der unmittelbaren Umgebung vorgenommen werden.
(5) Die Ärztin oder der Arzt hat die Leiche deutlich sichtbar zu kennzeichnen, wenn ein Anhaltspunkt dafür besteht, dass
1.die verstorbene Person an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt war oder
2.von der Leiche eine sonstige Gefahr ausgeht.
§ 5Innere Leichenschau
1 Die innere Leichenschau (Sektion) ist außer in den bundesrechtlich geregelten Fällen zulässig, wenn
1.ein erhebliches rechtliches Interesse oder ein erhebliches medizinisches Interesse an der Überprüfung oder weiteren Aufklärung der Todesursache besteht und die nach § 8 Abs. 3 in erster Linie Bestattungspflichtigen der Sektion nicht widersprechen oder
2.die Sektion Zwecken der Forschung oder der medizinischen Ausbildung dient und die verstorbene Person schriftlich ihr Einverständnis mit der Sektion erklärt hatte.
2 Die Sektion darf nur durch Ärztinnen oder Ärzte oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden. 3 Sie ist in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 auf den zur Erreichung ihres Zwecks notwendigen Umfang zu beschränken. 4 Die Vorschriften über die Bestattung (§ 8) bleiben unberührt. 5 Ergibt sich während der inneren Leichenschau ein Anhaltspunkt für einen nichtnatürlichen Tod, so hat die Person, die die Sektion durchführt, unverzüglich die Polizei oder die Staatsanwaltschaft zu benachrichtigen; § 4 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.
§ 6Todesbescheinigungen und Datenschutz
(1) 1 Unverzüglich nach Beendigung der Leichenschau hat die Ärztin oder der Arzt eine Todesbescheinigung mit den in § 3 Abs. 1 genannten Feststellungen auszustellen. 2 Die Todesbescheinigung dient auch der Prüfung, ob seuchenhygienische oder sonstige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, sowie Zwecken der Statistik und der Forschung.
(2) 1 Alle Todesbescheinigungen sind von der für den Sterbeort zuständigen unteren Gesundheitsbehörde auf ihre ordnungsgemäße Ausstellung zu überprüfen. 2 Wer eine Todesbescheinigung ausgestellt hat, ist verpflichtet, auf Verlangen der unteren Gesundheitsbehörde die Angaben darin zu vervollständigen und zur Überprüfung erforderliche Auskünfte zu erteilen. 3 Wer die verstorbene Person vor dem Tod ärztlich behandelt hat, ist verpflichtet, auf Verlangen der unteren Gesundheitsbehörde Auskünfte zu erteilen, die zur Überprüfung der Todesbescheinigung erforderlich sind.
(3) Das Fachministerium kann durch Verordnung regeln
1.den Inhalt der Todesbescheinigung,
2.die Übermittlung der Todesbescheinigung an das Standesamt und die untere Gesundheitsbehörde,
3.die Pflicht zur Übermittlung der Todesbescheinigung an die Landesstatistikbehörde und an Polizeidienststellen,
4.die Verarbeitung personenbezogener Daten aus Todesbescheinigungen,
5.die Auswertung von Todesbescheinigungen sowie
6.die Aufbewahrung von und den sonstigen Umgang mit Todesbescheinigungen.
(4) 1 Die untere Gesundheitsbehörde hat Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Todesumstände glaubhaft machen, auf Antrag Einsicht in die Todesbescheinigung zu gewähren oder Auskünfte daraus zu erteilen, wenn kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange der verstorbenen Person oder ihrer Angehörigen beeinträchtigt werden. 2 Hochschulen und anderen mit wissenschaftlicher Forschung befassten Stellen kann sie nach Maßgabe des § 25 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes auf Antrag Einsicht in Todesbescheinigungen gewähren, soweit dies für ein wissenschaftliches Vorhaben erforderlich ist. 3 Nach Satz 1 oder 2 übermittelte personenbezogene Daten dürfen nur für die im Antrag angegebenen Zwecke verarbeitet werden.
§ 7Aufbewahrung und Beförderung von Leichen
(1) 1 Jede Leiche soll innerhalb von 36 Stunden nach Eintritt des Todes, bei späterem Auffinden unverzüglich nach Durchführung der Leichenschau, in eine Leichenhalle überführt werden. 2 Leichenhallen sind ausschließlich zur vorübergehenden Aufnahme von Leichen bestimmte Räume auf Friedhöfen, in Krematorien, in medizinischen Einrichtungen, in pathologischen Instituten, bei Polizeibehörden sowie bei Bestattungsunternehmen und ähnlichen Einrichtungen.
(2) 1 Es ist unzulässig, eine Leiche öffentlich auszustellen. 2 In den Fällen des § 4 Abs. 5 ist der Sarg geschlossen zu halten. 3 Die untere Gesundheitsbehörde kann im Einzelfall eine Ausnahme von den Sätzen 1 und 2 zulassen.
(3) 1 Leichen sind in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zu befördern. 2 In den Fällen des § 4 Abs. 5 ist ein widerstandsfähiger und feuchtigkeitsundurchlässiger Sarg zu verwenden. 3 Dabei sind die für die Bestattung nach § 9 Abs. 3 erforderlichen Bescheinigungen mitzuführen. 4 Für die Beförderung in einem Fahrzeug im Straßenverkehr dürfen nur Fahrzeuge verwendet werden, die ausschließlich für den Transport von Särgen und Urnen bestimmt und hierfür eingerichtet sind. 5 Unterbrechungen bei der Beförderung sind zu vermeiden. 6 Die untere Gesundheitsbehörde kann von den Anforderungen der Sätze 4 und 5 im Einzelfall eine Ausnahme zulassen.
(4) Absatz 3 Sätze 3 bis 5 gilt nicht für die Überführung der Leiche zur örtlichen Leichenhalle und zum örtlichen Bestattungsplatz oder zum örtlichen Krematorium.
(5) Wer eine Leiche einsargt, die nach § 4 Abs. 5 besonders zu kennzeichnen ist, hat den Sarg entsprechend zu kennzeichnen.
(6) 1 Aus dem Ausland dürfen Leichen nur dann nach Niedersachsen befördert werden, wenn aus einer Kennzeichnung auf dem Sarg und zusätzlich aus einem Leichenpass oder einer amtlichen Bescheinigung hervorgeht, ob die verstorbene Person an einer übertragbaren Krankheit gelitten hat. 2 Die untere Gesundheitsbehörde kann Ausnahmen zulassen. 3 Für die Beförderung einer Leiche von Niedersachsen an einen Ort außerhalb Niedersachsens stellt die untere Gesundheitsbehörde auf Antrag einen Leichenpass aus. 4 Sie kann die dafür erforderlichen Nachweise verlangen und Auskünfte einholen.
(7) Das Fachministerium kann durch Verordnung den Inhalt des Leichenpasses nach Absatz 6 Satz 3 regeln.
§ 8Bestattung
(1) 1 Leichen sind zu bestatten. 2 Auf Verlangen eines Elternteils ist auch ein Fehlgeborenes oder Ungeborenes (§ 2 Abs. 3 Sätze 2 und 3) zur Bestattung zuzulassen. 3 Abgetrennte Körperteile oder Organe verstorbener Personen (Leichenteile) sind, wenn sie nicht bestattet werden, von demjenigen, der den Eingriff vorgenommen hat, zu verbrennen; Absatz 2 Satz 4 und Absatz 4 Satz 1 gelten entsprechend. 4 Die untere Gesundheitsbehörde kann Ausnahmen von Satz 3 Halbsatz 1 für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, der medizinischen Ausbildung oder der geschichtlichen Darstellung zulassen.
(2) 1 Werden Fehlgeborene und Ungeborene nicht bestattet, so sind sie hygienisch einwandfrei und dem sittlichen Empfinden entsprechend zu verbrennen. 2 Ist bei einem Fehlgeborenen die Trennung vom Mutterleib in Gegenwart einer Ärztin oder eines Arztes erfolgt, so hat die Ärztin oder der Arzt die Eltern auf die Bestattungsmöglichkeit nach Absatz 1 Satz 2 hinzuweisen. 3 Wünschen beide Eltern keine Bestattung, so hat die Ärztin oder der Arzt die Verbrennung gemäß Satz 1 sicherzustellen. 4 Hat sich die Fehlgeburt in einer medizinischen Einrichtung ereignet, so trifft auch diese die Verpflichtung nach Satz 3.
(3) Für die Bestattung der verstorbenen Person haben in folgender Rangfolge zu sorgen:
1.die Ehegattin oder der Ehegatte oder die eingetragene Lebenspartnerin oder der eingetragene Lebenspartner,
2.die Kinder,
3.die Enkelkinder,
4.die Eltern,
5.die Großeltern und
6.die Geschwister.
(4) 1 Sorgt niemand für die Bestattung, so hat die für den Sterbe- oder Auffindungsort zuständige Gemeinde die Bestattung zu veranlassen. 2 Die nach Absatz 3 vorrangig Bestattungspflichtigen haften der Gemeinde als Gesamtschuldner für die Bestattungskosten. 3 Diese werden durch Leistungsbescheid festgesetzt. 4 Lassen sich die Bestattungskosten von den vorrangig Verpflichteten nicht erlangen, so treten die nächstrangig Verpflichteten an deren Stelle.
§ 9Zeitpunkt der Bestattung, Bestattungsdokumente
(1) 1 Leichen dürfen erst nach Ablauf von 48 Stunden seit Eintritt des Todes bestattet werden. 2 Die untere Gesundheitsbehörde kann aus wichtigem Grund Ausnahmen zulassen.
(2) 1 Leichen sollen innerhalb von acht Tagen seit dem Eintritt des Todes bestattet oder eingeäschert worden sein. 2 Soll die Leiche an einen anderen Ort befördert (§ 7 Abs. 3) oder eingeäschert werden, so genügt es, wenn die Leiche in der Frist des Satzes 1 auf den Weg gebracht wird. 3 Die Gemeinden können Tage bestimmen, an denen in der Gemeinde keine Bestattungen stattfinden; diese Tage sind bei der Berechnung der Fristen der Sätze 1 und 2 nicht mitzuzählen. 4 Urnen sind innerhalb eines Monats nach der Einäscherung beizusetzen.
(3) 1 Die Bestattung darf erst erfolgen, wenn der Sterbefall durch das für den Sterbeort zuständige Standesamt beurkundet worden ist oder die ortspolizeiliche Genehmigung nach § 39 Satz 1 des Personenstandsgesetzes vorliegt. 2 In den Fällen des § 4 Abs. 4 muss auch die schriftliche Genehmigung der Staatsanwaltschaft nach § 159 Abs. 2 der Strafprozessordnung vorliegen.
(4) Zur Bestattung eines Fehlgeborenen oder eines Ungeborenen ist dem Träger des Friedhofs oder des Krematoriums lediglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der sich das Datum der Trennung vom Mutterleib sowie der Name und die Anschrift der Mutter ergeben.
§ 10Bestattungsarten
(1) 1 Die Bestattung kann nur als Begräbnis (Erdbestattung) oder als Einäscherung mit anschließender Aufnahme der Asche in einer Urne und Beisetzung der Urne (Feuerbestattung) durchgeführt werden. 2 Art und Ort der Bestattung sollen dem Willen der verstorbenen Person entsprechen. 3 Ist der Wille nicht bekannt, entscheiden die Bestattungspflichtigen in der Rangfolge des § 8 Abs. 3. 4 Hat die Gemeinde nach § 8 Abs. 4 Satz 1 für die Bestattung zu sorgen, dann entscheidet sie über Art und Ort der Bestattung; liegen Anhaltspunkte für den Willen der verstorbenen Person oder der Personen nach § 8 Abs. 3 vor, so hat die Gemeinde diese bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. 5 Die Leiche einer unbekannten Person darf nur eingeäschert werden, wenn die für die Gemeinde nach Satz 4 zuständige Polizeidienststelle mitgeteilt hat, dass ihr kein Anhaltspunkt für einen nichtnatürlichen Tod bekannt ist.
(2) Das für das Bestattungswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung als weitere Bestattungsart eine Tieftemperaturbehandlung, mit anschließender Erdbestattung auf einem Friedhof in einem kompostierbaren Sarg, zuzulassen und zu regeln; § 12 Abs. 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden.
§ 11Erdbestattung
(1) 1 Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen und nur auf Friedhöfen (§ 2 Abs. 4, § 19 Abs. 1 Satz 2) zulässig. 2 Die untere Gesundheitsbehörde kann Ausnahmen von der Sargpflicht nach Satz 1 zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.
(2) Unberührt bleibt die Möglichkeit, kirchliche Würdenträger wie bisher auch in kirchlichen Gebäuden beizusetzen, die nicht ausschließlich der Totenruhe dienen.
§ 12Feuerbestattung
(1) 1 Einäscherungen dürfen nur in einem Krematorium vorgenommen werden. 2 Die Einäscherung einer Leiche darf erst durchgeführt werden, wenn eine zweite Leichenschau zweifelsfrei ergeben hat, dass kein Anhaltspunkt für einen nichtnatürlichen Tod besteht. 3 Satz 2 gilt nicht, wenn die schriftliche Genehmigung der Staatsanwaltschaft nach § 159 Abs. 2 der Strafprozessordnung vorliegt.
(2) 1 Die zweite Leichenschau ist von einer Ärztin oder einem Arzt durchzuführen, die oder der von der unteren Gesundheitsbehörde hierfür ermächtigt worden ist oder dieser Behörde angehört. 2 Es dürfen nur Ärztinnen und Ärzte ermächtigt werden, die die Gebietsbezeichnung „Rechtsmedizin“, „Pathologie“ oder „Öffentliches Gesundheitswesen“ führen dürfen. 3 § 4 Abs. 2 bis 4 Satz 1 und Abs. 5 gilt entsprechend.
(3) 1 Zur Einäscherung müssen sich die Leichen in einem feuchtigkeitshemmenden Sarg befinden. 2 Sie dürfen nur einzeln eingeäschert werden. 3 Die Asche einer jeden Leiche ist in einer Urne aufzunehmen. 4 Diese ist zu verschließen und mit dem Namen der verstorbenen Person zu kennzeichnen. 5 Bevor das Krematorium die Urne mit der Asche aushändigt oder versendet, muss es sich vergewissern, dass eine ordnungsgemäße Beisetzung gesichert ist. 6 Die Beisetzung ist in der Regel als gesichert anzusehen, wenn die Urne mit der Asche an ein Bestattungsunternehmen übergeben wird.
(4) 1 Das Krematorium hat jede Einäscherung mit der Angabe des Einäscherungstages, des Namens der verstorbenen Person und des Verbleibs der Urne mit der Asche in ein Verzeichnis einzutragen. 2 Die Eintragungen müssen mindestens fünf Jahre lang für die untere Gesundheitsbehörde zur Einsicht bereitgehalten werden.
(5) 1 Die Urne mit der Asche ist auf einem Friedhof (§ 2 Abs. 4, § 19 Abs. 1 Satz 2) beizusetzen; § 11 Abs. 2 gilt entsprechend. 2 Die Urne mit der Asche darf auf Wunsch der verstorbenen Person von einem Schiff aus im Küstengewässer beigesetzt werden. 3 Für die Seebestattung dürfen nur Urnen verwendet werden, die wasserlöslich und biologisch abbaubar sind und keine Metallteile enthalten. 4 Die Urnen sind so zu verschließen und durch Sand oder Kies zu beschweren, dass sie nicht aufschwimmen können. 5 Veranlasst eine Gemeinde nach § 8 Abs. 4 die Bestattung, so ist eine Urnenbeisetzung nach Satz 2 nicht zulässig.
(6) 1 Krematorien sind im Fall des § 8 Abs. 1 Satz 2 verpflichtet, Fehlgeborene und Ungeborene einzuäschern; das Grundrecht auf Berufsausübung (Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes) wird eingeschränkt. 2 Die Absätze 3 bis 5 gelten entsprechend.
§ 13Friedhöfe
(1) 1 Träger von Friedhöfen (§ 2 Abs. 4) können nur sein:
1.Gemeinden,
2.Kirchen, Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, wenn sie Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sind.
2 Friedhofsträger können mit der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben, insbesondere mit der Errichtung und dem Betrieb des Friedhofs, Dritte beauftragen; ihre Verantwortlichkeit für die Erfüllung der mit der Trägerschaft verbundenen Pflichten wird durch die Übertragung nicht berührt.
(2) Der Träger eines Friedhofs hat über die Bestattungen so Buch zu führen, dass sich nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Mindestruhezeit abläuft.
(3) Die Friedhofsträger sind im Fall des § 8 Abs. 1 Satz 2 verpflichtet, die Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen zuzulassen.
(4) 1 Der Friedhofsträger im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 erhebt, soweit nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird, für die Benutzung des Friedhofs Gebühren nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG). 2 Für die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Grabstätten gelten ergänzend die folgenden Bestimmungen:
1.Als Beginn der Inanspruchnahme der Grabstätte kann der Zeitpunkt bestimmt werden, zu dem das Nutzungsrecht begründet oder verlängert wird.
2.Die Gebühren für die Nutzung der Grabstätte können bereits bei der Begründung oder Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Nutzungszeit erhoben werden.
3.§ 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 NKAG ist auf Gebühren für die Nutzung von Grabstätten nicht anzuwenden.
3 Grabstätten können aus mehreren einzelnen Gräbern bestehen.
§ 14Mindestruhezeiten
1 Die Mindestruhezeit nach jeder Bestattung beträgt 20 Jahre. 2 Die untere Gesundheitsbehörde kann
1.für einzelne Friedhöfe oder Teile davon eine längere Mindestruhezeit nach Erdbestattungen festlegen, wenn anderenfalls für die Umgebung eine gesundheitliche Gefahr zu erwarten ist,
2.eine kürzere Mindestruhezeit festlegen, wenn ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht, und
3.im Einzelfall eine Ausnahme von der Einhaltung der Mindestruhezeit zulassen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.
§ 15Ausgrabungen und Umbettungen
1 Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen außer in den bundesrechtlich geregelten Fällen vor Ablauf der Mindestruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden. 2 Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 3 Die Umbettung darf auch zugelassen werden, wenn ein öffentliches Interesse dafür vorliegt, einen Friedhof ganz oder teilweise aufheben zu können (§ 16).
§ 16Aufhebung von Friedhöfen
Friedhöfe und Teile von Friedhöfen dürfen nur aufgehoben werden, wenn die Mindestruhezeit nach allen Bestattungen abgelaufen ist.
§ 17Vollstreckungshilfe
Bei kirchlichen Friedhofsgebühren, die aufgrund kirchenbehördlich genehmigter Gebührenordnungen durch Bescheid des Friedhofsträgers festgesetzt wurden, sind die Gemeinden zur Vollstreckungshilfe verpflichtet.
§ 18Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.entgegen § 3 Abs. 2 die Leichenschau nicht oder nicht unverzüglich veranlasst,
2.entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 die Leichenschau nicht durchführt,
3.entgegen § 3 Abs. 4 Satz 2 eine Todesbescheinigung nicht ausstellt,
4.als für die Leichenschau verantwortliche Ärztin oder Arzt die Leichenschau nicht unverzüglich oder nicht in der in § 4 Abs. 2 beschriebenen Weise durchführt,
5.entgegen § 4 Abs. 3 oder § 6 Abs. 2 Satz 3 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt,
6.entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 eine Todesbescheinigung nicht ausstellt,
7.eine Todesbescheinigung nicht richtig ausstellt oder dabei die Anforderungen einer Verordnung nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 nicht beachtet, die für eine bestimmte Anforderung auf diesen Ordnungswidrigkeits-Tatbestand verweist,
8.entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 eine Todesbescheinigung nicht vervollständigt,
9.entgegen § 6 Abs. 4 Satz 3 personenbezogene Angaben zu einem anderen als dem im Antrag angegebenen Zweck verarbeitet,
10.entgegen § 8 Abs. 1 und 2 Satz 1 eine Leiche, ein Fehlgeborenes oder Ungeborenes, ein Leichenteil oder ein Organ nicht bestattet oder in den Fällen des § 8 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 nicht verbrennt, obwohl er dazu verpflichtet ist,
11.eine Leiche in anderer Weise als durch Erd- oder Feuerbestattung beseitigt oder Handlungen vornimmt, um eine nach § 8 Abs. 1 gebotene Bestattung oder in den Fällen des § 8 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 die Verbrennung zu verhindern,
12.entgegen § 9 Abs. 1 eine Leiche vor Ablauf von 48 Stunden seit Eintritt des Todes bestattet,
13.eine Leiche bestattet, ohne dass die nach § 9 Abs. 3 erforderlichen Bescheinigungen vorliegen,
14.eine Erdbestattung entgegen § 11 nicht in einem geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Sarg oder außerhalb eines Friedhofs (§ 2 Abs. 4, § 19 Abs. 1 Satz 2) vornimmt, es sei denn, es liegt ein Fall des § 19 Abs. 1 Satz 3 vor,
15.eine Urne mit der Asche entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 nicht beisetzt, obwohl er dazu verpflichtet ist,
16.eine Urne mit der Asche entgegen § 12 Abs. 5 oder außerhalb eines Friedhofs (§ 2 Abs. 4, § 19 Abs. 1 Satz 2) beisetzt, es sei denn, es liegt ein Fall des § 19 Abs. 1 Satz 3 vor,
17.eine Leiche oder eine Urne entgegen § 15 Satz 1 ausgräbt oder umbettet.
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Vorschrift einer aufgrund des § 6 Abs. 3 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, wenn die Verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.
§ 19Übergangsvorschriften
(1) 1 Als Friedhöfe im Sinne der §§ 14 bis 16 gelten auch alle im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bereits vorhandenen privaten Bestattungsplätze, soweit sie bereits mit behördlicher Duldung belegt worden sind. 2 Soweit Anlagen nach Satz 1 den sachlichen Anforderungen des § 2 Abs. 4 an einen Friedhof entsprechen, kann die untere Gesundheitsbehörde dem Betreiber des Friedhofs die Vornahme von weiteren Bestattungen und Urnenbeisetzungen gestatten. 3 Im Übrigen können von der unteren Gesundheitsbehörde auf Anlagen nach Satz 1 im Einzelfall Bestattungen und Urnenbeisetzungen gestattet werden.
(2) § 8 Abs. 1 Satz 3 gilt nicht für Leichenteile, die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes abgetrennt oder ausgegraben wurden und seither aus Gründen der Forschung, der medizinischen Ausbildung, der geschichtlichen Darstellung oder der religiösen Verehrung aufbewahrt werden.
§ 20Zuständigkeit, Kostendeckung
1 Die Aufgaben der Gemeinden nach den §§ 13 und 17 gehören zum eigenen Wirkungskreis; die übrigen durch dieses Gesetz den Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten zugewiesenen Aufgaben gehören zum übertragenen Wirkungskreis. 2 Die den Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten aus der Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 Halbsatz 2 entstehenden Kosten werden im Rahmen ihrer Finanzausstattung durch Finanzausgleichszuweisungen und sonstige Einnahmen gedeckt.
§ 21Aufhebung von Vorschriften
(1) Es werden aufgehoben:
1.das Gesetz über die Feuerbestattung vom 15. Mai 1934 (Nds. GVBl. Sb. II S. 279), geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 30. Juli 1985 (Nds. GVBl. S. 246),
2.die Verordnung zur Durchführung des Feuerbestattungsgesetzes vom 10. August 1938 in der Fassung der Verordnung vom 24. April 1942 (Nds. GVBl. Sb. II S. 280),
3.das Gesetz über das Leichenwesen vom 29. März 1963 (Nds. GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 22. März 1990 (Nds. GVBl. S. 101),
4.die Verordnung über die Bestattung von Leichen vom 29. Oktober 1964 (Nds. GVBl. S. 183), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. September 1986 (Nds. GVBl. S. 303),
5.das Gesetz betreffend die Feuerbestattung vom 14. September 1911 (Nds. GVBl. Sb. III S. 61),
6.das Gesetz über die Einäscherung vom 22. Oktober 1925 (Nds. GVBl. Sb. II S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Dezember 1983 (Nds. GVBl. S. 281),
7.das Gesetz betreffend die Organisation der Herrschaft Kniphausen vom 27. Dezember 1854 (Nds. GVBl. Sb. III S. 15),
8.Abschnitt XXI der Dritten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens (Dienstordnung für die Gesundheitsämter – Besonderer Teil) vom 30. März 1935 (Nds. GVBl. Sb. II S. 170) und
9.die Verordnung betreffend die Regulirung einiger Verhältnisse der verschiedenen Religionsgesellschaften zu einander vom 14. Januar 1851 (Nds. GVBl. Sb. III S. 123).
(2) § 15a des Kirchensteuerrahmengesetzes in der Fassung vom 10. Juli 1986 (Nds. GVBl. S. 281), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2001 (Nds. GVBl. S. 760), wird gestrichen.
§ 22In-Kraft-Treten
1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. 2 Abweichend von Satz 1 treten § 6 Abs. 3 und § 7 Abs. 7 am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.
Gesetzüber das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen(BestattG)
vom 8. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 381) – VORIS 21068 –
– Kommentar –
Einführung
Übersicht
1.Verfassungsrechtliche Einordnung
2.Historische Entwicklung des Friedhofsrechts in Niedersachsen
3.Zielsetzungen des Nds. BestattG
4.Aufbau des Nds. BestattG
5.Friedhofs- und Bestattungswesen als kommunale Aufgabe
5.1Friedhofswesen und Satzungsrecht
5.1.1Rechtsgrundlage
5.1.2Inhalt der Satzung
5.2Friedhofsbenutzungsanspruch
5.2.1Bedeutung des Zulassungsanspruchs
5.2.2Anspruchsberechtigte
5.2.3Bestattung sonstiger ortsfremder Verstorbener
6.Grabstätten
6.1Begriff der Grabstätte
6.2Arten von Grabstätten
6.2.1Reihengrab
6.2.2Wahlgrab
6.2.2.1Kein Kaufvertrag
6.2.2.2Verwaltungsakt
6.2.2.3Nutzung und Nutzungszeit
6.2.2.4Übertragung und Beendigung des Nutzungsrechts
6.2.2.5Herabsetzung der Nutzungsdauer
7.Gestaltung des Friedhofs
7.1Grundsätzliches
7.2Allgemeine und zusätzliche Gestaltungsvorschriften
7.3Zulässigkeit besonderer Gestaltungsvorschriften
7.4Zwei-Felder-System
7.5Rechtliche Bewertung einzelner Grabgestaltungsklauseln
7.5.1Grabeinfassungen
7.5.2Aufstellung von Fotos und Anbringung von QR-Codes
7.5.3Grababdeckplatten
7.5.4Kombination verschiedener Materialien und Massenware
7.5.5Skulpturen und sonstige Kunst auf Gräbern
7.5.6Größenbeschränkungen für Grabmale
7.6Grabfelder für Kinder
7.7Weitergehende Anforderungen bei konfessionellen Friedhöfen
7.8Nachträgliche Änderung der Gestaltungsanforderungen
7.9Aufklärungs- und Hinweispflicht des Friedhofsträgers
8.Grabbepflanzung und Grabpflege
8.1Grundsätzliches
8.2Pflicht zur dauerhaften Grabpflege
8.3Musterbescheid: Ordnungsverfügung wegen Vernachlässigung der Grabpflege
9.Grabsteine und Grabmale und die Verkehrssicherungspflicht
9.1Grundsätzliches
9.2Verkehrssicherungspflicht und Baumkontrolle
9.3Überwachung der aufgestellten Grabmäler
9.3.1Verwendung technischer Messinstrumente
9.3.2Zeitpunkt der Überprüfung
9.4Ordnungsverfügung und Ersatzvornahme
9.5Bescheidmuster: Ordnungsverfügung wegen Gefährdung der Verkehrssicherungspflicht
9.6Verkehrssicherungspflicht zwischen Friedhofsträger und Nutzungsberechtigtem
9.7Haftung des Nutzungsberechtigten
9.8Vandalismus und Schäden durch Tiere
10.Bestattungswesen
11.Leichenwesen
12.Denkmal- und Naturschutzrecht
1.Verfassungsrechtliche Einordnung
Das Friedhofs- und Bestattungsrecht ist ebenso wie Denkmalrecht nach der Kompetenzzuweisung des Grundgesetzes nach Art. 30, 70, 83, 104a GG Ländersache. Da diese Regelungen, die Kompetenzabgrenzungen zum Gegenstand haben, nach dem Muster von Regel und Ausnahme formuliert sind, hat der Bund auch keine Mitzuständigkeit im Friedhofsrecht oder im Denkmalrecht. Ihm wurde lediglich für das Friedhofswesen die Sorge für die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer von Gewaltherrschaft nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 10 GG (abgedruckt in Anhang 1) als konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis übertragen.
Andere Kompetenzen – vom bürgerlichen Recht und Strafrecht nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG über das Personenstandswesen nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 2 GG, das Bodenrecht nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG oder Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG – können in Teilbereichen im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung einwirken. Entsprechendes gilt für den Naturschutz und die Landschaftspflege nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG oder die Raumordnung nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG.
Es sollte auch in der täglichen kommunalen Arbeitspraxis nicht verkannt werden, dass das Friedhofswesen ebenso wie die Denkmalpflege in hohem Maße ein grundrechtsrelevanter Bereich ist. Zu nennen sind die Würde des Menschen nach Art. 1 Abs. 1 GG, die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG), der Gleichheitssatz (Art. 3 GG), die Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 4 Abs. 1, 2 GG), die Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) und die Gewährleistung des Eigentums (Art. 14 GG) sowie die über Art. 140 GG weiter geltenden Artikel der Weimarer Reichsverfassung (WRV) von 1919.
Staatsziele wie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen nach Art. 20a GG sowie der Kulturstaatsgedanke sind ebenfalls relevant. Ergänzt werden diese Vorgaben durch das Landesverfassungsrecht des Landes Niedersachsen mit entsprechenden Staatszielen und Landesgrundrechten. Die Verfassung von Niedersachsen nennt in Art. 3 ausdrücklich die Grundrechte, in Art. 6 die Kultur. Regelungen zwischen Staat und Kirchen bzw. Glaubensgemeinschaften runden das Bild ab. Vgl. auch Hönes, Kernfragen des Rechts des Bestattungs- und Friedhofswesens, LKV 2002 S. 49 – 57 (50).
2.Historische Entwicklung des Friedhofsrechts in Niedersachsen
Zur Geschichte des Friedhofs- und Bestattungsrechts im Allgemeinen vgl. Gaedke/Diefenbach, Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts, 10. Auflage, Köln 2010, S. 1–10.
Das Land Niedersachsen wurde mit Wirkung vom 1.11.1946 aus der früheren preußischen Provinz Hannover und den Ländern Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe gebildet. Daher galten landesrechtliche Bestimmungen zunächst noch für einzelne Landesteile fort. Das braunschweigische Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 23.11.1927 (GuVS 1927 S. 405) gilt aus kirchenzuwendungsrechtlichen Gründen sogar auch heute weiter fort (vgl. Erl. zu § 21 BestattG). Die Vorschriften des seinerzeitigen schaumburg-lippischen Rechts wurden durch Gesetz vom 12.7.1960 (Nds. GVBl. S. 138) außer Kraft gesetzt.
Die bis zum 31.12.2005 geltende Rechtslage war zersplittert. Die Bestattung von Leichen war geregelt durch das Niedersächsische Gesetz über das Leichenwesen (Nds. LeichenG) vom 29.3.1963 (Nds. GVBl. S. 142 – VORIS 21068 05 00 00 000 –), zuletzt geändert durch Art. 22 des Gesetzes vom 22.3.1990 (Nds. GVBl. S. 101) und die darauf beruhende Verordnung über die Bestattung von Leichen (LeichenV) vom 29.10.1964 (Nds. GVBl. S. 183 – VORIS 21068 05 01 00 000 –), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 17.9.1986 (Nds. GVBl. S. 303).
Die Feuerbestattung war ergänzend geregelt durch das Gesetz über die Feuerbestattung vom 15.5.1934 (Nds. GVBl. Sb. II S. 279), geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 30.7.1985 (Nds. GVBl. S. 246), und die Verordnung zur Durchführung des Feuerbestattungsgesetzes vom 10.8.1938 in der Fassung der Verordnung vom 24.4.1942 (Nds. GVBl. Sb. II S. 280).
Daneben beanspruchten weitere Rechtsvorschriften aus vorkonstitutioneller Zeit sowie gewohnheitsrechtliche Rechtsinstute Geltung (vgl. § 21 BestattG).
Die unübersichtliche und z. T. ungeordnete Gesetzeslage ist kritisiert worden. Dennoch hatte sich der Gesetzgeber – wie in anderen Bundesländern auch, die sogar, wie etwa Sachsen-Anhalt, ohne jegliche parlamentsgesetzliche Rechtsgrundlage auszukommen hatten – Zeit gelassen mit der Durchführung einer Bestattungsrechtsreform. Eine Erklärung hierfür mag sich in der stark traditionell-konservativen Verhaftung dieses Rechtsgebietes finden, d. h. wesentliche, gesetzlich ungeregelte Fragen, wie etwa die der Bestattungspflicht und der Kostentragungspflicht, hatten eine Klärung durch die Rechtsprechung der niedersächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (und des Bundesverwaltungsgerichts) gefunden, der es gelungen war, die tradierten Anschauungen der Bevölkerung in richterrechtliche Formen zu gießen, um dem Rechtsanwender, insbesondere den Kommunen, eine Handlungsanleitung an die Hand zu geben.
3.Zielsetzungen des Nds. BestattG
Zur Zielsetzung des Nds. BestattG siehe die Begründung zum Gesetzentwurf vom 2.6.2004 (LT-Drs. 15/1150 S. 1, 8 – 9) sowie ausführlich Horn, Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Kommentar, 1. Aufl., Abschnitt B – Einleitung, S. 13 – 20 und Abschnitt C 5 – Gesetzesmaterialien, S. 168 – 237.
Mit dem Nds. BestattG sollten erhebliche Rechtsunsicherheiten auf dem Gebiet des Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesens beseitigt, eine Vielzahl von unterschiedlichen Regelungen in einem Gesetz zusammengefasst und zugleich neue Entwicklungen berücksichtigt und die verfassungsrechtlich notwendige gesetzliche Grundlage dafür gegeben werden, um insbesondere Pflichten beim Umgang mit Leichen festzulegen.
Die o. g. früheren Rechtsnormen waren tw. nur in der Form von Rechtsverordnungen erlassen worden. Die meisten Vorschriften enthielten aber Pflichten, die in Grundrechte eingreifen, und bedürfen daher nach dem Grundsatz des Gesetzesvorbehalts, abgeleitet aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 2 Abs. 2, Art. 41 Niedersächsische Verfassung), einer (parlaments-)gesetzlichen Grundlage. Besonders unter Berücksichtigung der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten sog. Wesentlichkeitslehre, nach der für das staatliche Leben bedeutsame Grundentscheidungen durch den parlamentarischen Gesetzgeber zu treffen sind, wurde die nunmehr erfolgte Kodifizierung durch den niedersächsischen Gesetzgeber für dringend erforderlich erachtet.
Die in der Praxis aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Auslegung und Anwendung der im Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen geltenden Regelungen sind durch das Gesetz im Wesentlichen beseitigt worden.
Die früher geltende 1 000 g-Grenze als Maßstab für die Abgrenzung der Totgeborenen von den Fehlgeborenen wird auf 500g herabgesetzt. Damit ist sowohl dem medizinischen Fortschritt Rechnung getragen, als auch eine Anpassung an eine entsprechende Vorschrift in § 29 der Verordnung des Bundes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStG) vorgenommen worden.
Neuen Entwicklungen im Bestattungswesen ist Raum gelassen worden; auf elterlichen Wunsch ist die Bestattung eines Fehlgeborenen ebenso zulässig wie die eines Ungeborenen. Die Verwendung von umweltverträglichen Särgen („Peace-Boxes“) wird vorgesehen.
Eine Vielzahl von Regelungen in Verordnungen, Anordnungen und Ausführungsbestimmungen wird im BestattG zusammengefasst. Hierdurch wird Auslegungsschwierigkeiten in der Rechtsanwendung entgegen gewirkt. Um auf zukünftige Entwicklungen zügig reagieren zu können, sind in § 7 Abs. 7 und in § 10 Abs. 2 Nds. BestattG Verordnungsermächtigungen für das Fachministerium vorgesehen. Unter dem 16.1.2007 ist danach die Verordnung über die Todesbescheinigung (TbVO) des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit erlassen worden (Nds. GVBl. Nr. 1/2007, S. 2), vgl. Erl. 3 zu § 6 BestattG (mit Abdruck des Verordnungstextes).
Unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben zu kommunalen Aufgaben (Art. 57 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung) werden die behördlichen Aufgaben entsprechend dem Verwaltungsaufbau des Landes den Kommunen zugeordnet (vgl. auch § 20 Abs. 1 Satz 1 Nds. BestattG).
4.Aufbau des Nds. BestattG
Das Gesetz gliedert sich in fünf Abschnitte.
Im ersten Abschnitt werden allgemeine Grundsätze und Definitionen vorangestellt. Der zweite Abschnitt (Leichenwesen) enthält Vorschriften über die Leichenschau und den Umgang mit Leichen. Im dritten Abschnitt wird das Bestattungswesen geregelt. Der vierte Abschnitt betrifft das Friedhofswesen, der fünfte Abschnitt die Ordnungswidrigkeiten und die Zuständigkeiten sowie Schlussvorschriften.
Der wesentliche Inhalt des Nds. BestattG umfasst Vorschriften über:
–die Veranlassung zur Leichenschau und die Durchführung der Leichenschau (§§ 3 bis 6 Nds. BestattG),
–die Voraussetzungen für Leichenöffnungen (§ 5 Nds. BestattG),
–die Überführung von Leichen und den Transport von Urnen (§ 7 Nds. BestattG),
–die Pflicht zur Bestattung und die zulässigen Bestattungsarten (§§ 8 bis 12 Nds. BestattG),
–den Betrieb von Friedhöfen (§§ 13 bis 16 Nds. BestattG),
–die Zuweisung der behördlichen Aufgaben an die Kommunen (§ 20 Nds. BestattG),
–die Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen dieses Gesetz (§ 18 Nds. BestattG).
5.Friedhofs- und Bestattungswesen als kommunale Aufgabe
Vorliegend werden durch das Nds. BestattG drei Rechtsgebiete in einer einheitlichen gesetzlichen Ummantelung zusammengefasst, nämlich das Leichenwesen, das Bestattungswesen und das Friedhofswesen. Dementsprechend sind hier differenzierende Betrachtungen anzustellen (vgl. instruktiv zur Differenzierung zwischen Aufgaben des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises: VGH Mannheim, Urt. vom 28.2.2005 – 1 S 1312/04 –, www.vghmannheim.de).
5.1Friedhofswesen und Satzungsrecht
Literatur:Von der Beeck, Friedhofssatzungen oft fehlerhaft, DFK 1994 S. 59 ff.; Fischer, Vom Gottesacker zum Krematorium – Eine Sozialgeschichte der Friedhöfe in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert, Diss. phil., Hamburg 1995, www.sub.uni-hamburg.de/opus/volltexte/1996/37/html/inhalt.html (Volltext); Gaedke, Grundsätze der Friedhofsordnungen, Der Landkreis 1981 S. 687 ff.; Gaedke/Diefenbach, Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts, 10. Aufl., Köln 2010, S. 69–78; Klingshirn, Bestattungsrecht in Bayern, München 1971, Stand: 18.12.2006, Kap. XIII Rdnrn. 21 ff.; Menzel/Hamacher, BestG NRW, Kommentar, Wiesbaden 2003, S. 58 – 61; Sperling, Welchen Spielraum lassen Musterordnungen bei der individuellen Gestaltung von Friedhofssatzungen zu?, Friedhofskultur 1999 S. 22 ff.; Spranger, BestG NRW, Kommentar, Stuttgart 2003, S. 56 – 62. Sehr instruktiv zum Friedhofs-Satzungsrecht auch: Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung, Projekt A10 „Farbe? Leben? Friedhof! – Friedhöfe planen“, Endbericht vom 21.10.2002, www.geocities.com/idealfriedhof/home.html (Abrufdatum: 2.1.2009).
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es 28 000 Kommunalfriedhöfe mit insgesamt mehr als 30 Millionen Gräbern (vgl. Menzel/Hamacher, BestG NRW, a. a. O., S. 8). Seit jeher wird das Friedhofswesen als öffentliche Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft angesehen, die von den Gemeinden zu erfüllen ist. Das Friedhofswesen (siehe § 1 Abs. 4, § 13 Nds. BestattG) gehört als Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft zu den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften im Sinne des § 5 Abs. 1 NKomVG. Es handelt sich um eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, die dem Schutzbereich der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG und des Art. 57 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung unterliegt. Die Gemeinden und Landkreise verwalten danach ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Diese Zuordnung stellt § 20 Abs. 1 Satz 1 Nds. BestattG deklaratorisch klar, wenn dort geregelt ist, dass die Gemeinden ihre Aufgaben als Friedhofsträger im eigenen Wirkungskreis (im Rahmen des kommunalen Anstaltsrechts) erfüllen.
In der Konsequenz bedeutet diese Kompetenzverteilung, dass die Gemeinde lediglich der Kommunal-(Rechts-)aufsicht des Kommunalrechts (s. § 170 Abs. 1 Satz 2 NKomVG) unterliegt und über die Art und Weise der Erfüllung der ihr zugewiesenen Aufgabe in eigener Verantwortung entscheiden darf. Sie kann sich z. B. dafür entscheiden, keinen eigenen Friedhof anzulegen und zu unterhalten, wenn und soweit anderweitig (etwa in der Nachbargemeinde oder durch einen bestehenden kirchlichen Friedhof) die vom Gesetz geforderten Bestattungsmöglichkeiten vorhanden sind.
Ausfluss der Selbstverwaltungsaufgabe ist das gemeindliche Satzungsrecht. Nach § 10 Abs. 1 NKomVG kann die Gemeinde ihre eigenen Angelegenheiten nämlich durch (i. d. R. genehmigungsfreie) Satzungen regeln. Ihr kommt also ein gerade im Friedhofswesen mit erheblicher Bedeutung versehenes örtliches Rechtsetzungsrecht zu. Sie ist indes nicht nur befugt, sondern sogar gehalten, die Benutzung der Friedhöfe durch den Erlass einer Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung zu regeln.
Eine § 25 BestattG LSA vergleichbare ausdrückliche fachgesetzliche Vorschrift über das Satzungsrecht des Friedhofsträgers enthält das Nds. BestattG nicht.
Die Gemeinde als Friedhofsträgerin hat die Benutzung ihres Friedhofs öffentlich-rechtlich durch Erlass einer Satzung zu regeln. Es ist derzeit in Niedersachsen – anders nach dem BayBestG – nicht zulässig, das Benutzungsverhältnis ausschließlich privatrechtlich durch allgemeine Geschäfts- und Benutzungsbedingungen zu regeln. Friedhofssatzungen werden z. T. auch als Friedhofsordnungen bezeichnet; dies ist zulässig, bedarf aber hier der Abgrenzung zu einer sog. Anstaltsordnung, die lediglich den Charakter einer intern bindenden Verwaltungsvorschrift entfaltet, die nicht geeignet ist, unmittelbare Außenwirkung gegenüber den Normadressaten zu entfalten, jedenfalls nicht hinsichtlich der Begründung von Pflichten (ähnlich Gaedke/Diefenbach, a. a. O., S. 65). Die Rechtsform der Satzung ist geboten. Sollte die Gemeinde zudem eine Straßenordnung als Gefahrenabwehrverordnung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf der Grundlage der gesetzlichen Ermächtigung der §§ 93, 55 Abs. 1 Nr. 1 Nds. SOG (dazu: Barthel, SOG LSA, Einführung, Praxis der Kommunalverwaltung, Beitrag K 30 SAn, Stand: November 2013, S. 8 f.) erlassen haben, ist darauf zu achten, dass letztere die Gemeindefriedhöfe aus dem örtlichen Anwendungsbereich ausnimmt.
5.1.1Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für den Erlass einer Friedhofssatzung ist § 10 Abs. 1 NKomVG. Danach können die Gemeinden ihre eigenen Angelegenheiten durch Satzung regeln. Das Friedhofswesen gehört als Pflichtaufgabe (s. § 20 Abs. 1 Satz 1 Nds. BestattG) zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinde nach § 5 Abs. 1 Satz 1 NKomVG (s. Einführung Erl. 5.1). Die gemeindliche Friedhofssatzung beschränkt sich in ihrem Geltungsbereich auf den gemeindlichen Friedhof. Bestehen in einer Gemeinde mehrere Friedhöfe, so kann die Gemeinde, sofern es sachlich geboten ist, in der Friedhofssatzung Differenzierungen vornehmen (z. B. bei der Grabmalgestaltung). Die Notwendigkeit dafür kann sich insbesondere dann ergeben, wenn eine Gemeinde im Zuge der gemeindlichen Neuordnung Trägerin mehrerer Friedhöfe geworden ist.
5.1.2Inhalt der Satzung
Der Inhalt einer Friedhofssatzung ergibt sich aus der öffentlichen Zweckbestimmung des Friedhofs (§§ 1 Abs. 4, 13 Nds. BestattG) unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Eine Friedhofssatzung muss insbesondere Vorschriften enthalten über die Art, Ruhezeit, Gestaltung und Unterhaltung der Grabstätten sowie die Bestattungseinrichtungen einschließlich der Erhebung von Gebühren.
Folgende Gegenstände werden regelmäßig per Satzung geregelt (vgl. auch Klingshirn, a. a. O., Kap. XIII Rdnr. 23; Gaedke/Diefenbach, a. a. O., S. 77; s. Mustertext für eine Friedhofssatzung, abgedruckt in Anhang 6):
–Aufbahrung und Bestattung der Leichen,
–Anlage von Grabstätten, insbesondere deren Ausmaße sowie der Abstand zwischen den einzelnen Grabstätten,
–Gestaltung der Grabstätten, insbesondere die Grabmalgestaltung, die Instandhaltung der Grabstätte und ihre Pflege,
–Bestimmungen über die Rechtsverhältnisse an den Grabstätten, insbesondere über die Art der Grabrechte (Wahlgrabstätten, Reihengräber), Regelung der Voraussetzungen für die Gewährung von Sondernutzungsrechten und über die Dauer der Nutzungsrechte, Festsetzung der Ruhezeiten,
–Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof (Bestatter, Steinmetze und Friedhofsgärtner),
–Ordnungsvorschriften, insbesondere über die Öffnungszeiten und das allgemeine Verhalten auf dem Friedhof.
Darüber hinaus kann die Friedhofssatzung noch weitere Vorschriften vorsehen, die zwar nicht notwendig sind, aber den Friedhofszweck fördern. Die Satzung kann etwa Zuwiderhandlungen gegen einzelne Vorschriften als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße bedrohen. Häufig werden Mustersatzungen (vgl. Mustertext des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, abgedruckt bei Horn, Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Kommentar, 1. Aufl., Abschnitt C 4, S. 153–167; Leitfassung des Deutschen Städtetages vom 1.1.1999, abgedruckt in der 1. Auflage dieses Werkes, dort Anhang 3 sowie Mustertext für eine Friedhofssatzung, abgedruckt in Anhang 6) verwendet; diese entfalten allerdings keine Verbindlichkeit (vgl. Sperling, a. a. O.), bieten indes aber eine (gewisse) Gewähr dafür, einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung standzuhalten. Zur nachträglichen Änderung von Friedhofssatzungen im Hinblick auf die Zulässigkeit der Rückwirkung s. Erl. 7.7 zu § 13.
5.2Friedhofsbenutzungsanspruch
Literatur:Gaedke/Diefenbach, Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts, 10. Aufl., 2010, S. 168–172; Klingshirn, Bestattungsrecht in Bayern, München 1971, Stand: September 2008, Kap. XII Rdnrn. 11–15 a.
Mit gewisser Regelmäßigkeit steht der Friedhofsträger vor der Frage, ob es einen rechtlichen Anspruch bestimmter Personen auf die Benutzung seines Friedhofs gibt, namentlich ob auch auswärtige oder andersgläubige Verstorbene auf seinem – kommunalen oder kirchlichen – Friedhof bestattet werden müssen. Anders als z. B. in § 21 Satz 1 BestattG LSA, wonach auf Gemeindefriedhöfen die Bestattung der verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner sowie derjenigen Personen zu ermöglichen ist, die innerhalb des Gemeindegebiets verstorben sind, fehlt eine ausdrückliche Normierung des Zulassungs- und Benutzungsanspruchs des Friedhofs im Nds. BestattG. Sie wurde unter dem Gesichtspunkt der Deregulierung für nicht erforderlich gehalten. Die kommunalen Friedhofsträger haben aber in ihren Friedhofssatzungen vielfach geregelt, dass (nur) die Einwohner einen gebundenen Anspruch auf Bestattung auf dem Friedhof der jeweiligen Gemeinde haben.
5.2.1Bedeutung des Zulassungsanspruchs
Der Bestattungsanspruch, d. h. die Zulassungspflicht der Gemeindeeinwohner auf Gemeindefriedhöfen beinhaltet ein subjektives öffentliches Recht (so Gaedke/Diefenbach, a. a. O., S. 168). Er gründet sich auf den allgemeinen Zulassungsanspruch aus § 30 Abs. 1 Halbsatz 1 NKomVG, wonach die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Rahmen der bestehenden Vorschriften berechtigt sind, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen, nach dem Wohnortprinzip. Der Anspruch ist auf dem Verwaltungsrechtsweg (§ 40 Abs. 1 VwGO) zu verfolgen (s. auch Einführung, Erl. 5.1).
Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Nds. BestattG ist u. a. für die Bestimmung des Ortes der Bestattung der Wille der verstorbenen Person bzw. der Bestattungspflichtigen maßgebend (vgl. dazu Erl. 3.6 zu § 8 Nds. BestattG und Erl. 6.4; 6.5 zu § 10 Nds. BestattG). Daraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, der verstorbenen Person oder den bestattungspflichtigen Angehörigen stehe ein uneingeschränktes Recht auf freie Wahl des Friedhofs zu. Das Bestattungswesen würde in Unordnung geraten, würde jedermann das Recht haben, den Friedhof bestimmen zu können, auf dem er bestattet sein möchte (vgl. Klingshirn, a. a. O., Kap. XII Rdnr. 11). Dieses Bestimmungsrecht wird in zweierlei Hinsicht eingeschränkt: Es steht unter dem gesetzlichen Vorbehalt, dass dabei nicht gegen die Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verstoßen wird.
5.2.2Anspruchsberechtigte
Zunächst besteht ein Anspruch gegen die Gemeinde, die Beisetzung der verstorbenen Gemeindeeinwohnerinnen und -einwohner zu ermöglichen. Dieser Anspruch, der in der Person der verstorbenen Person entsteht und von demjenigen geltend gemacht wird, der für die Bestattung zu sorgen hat, ist öffentlich-rechtlicher Natur, und zwar auch dann, wenn die Benutzung des Friedhofes privatrechtlich geregelt ist (vgl. Klingshirn, a. a. O., Kap. XII Rdnr. 12). Die Gemeindeeinwohnerinnen und -einwohner sind auf Grund des § 30 Abs. 1 Halbsatz 1 NKomVG berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen zu benutzen. Keine Einwohner sind z. B. Insassen einer Justizvollzugsanstalt oder Personen, die sich zum Zeitpunkt ihres Todes lediglich vorübergehend in der Gemeinde aufgehalten haben. Der Bestattungsanspruch besteht auch dann, wenn der verstorbene Einwohner nicht in der Gemeinde verschieden ist, deren Einwohner er war (Klingshirn, a. a. O., Kap. XII Rdnr. 12).
Darüber hinaus ist die Gemeinde u. U. gehalten, auch die Bestattung gemeindefremder Verstorbener auf dem gemeindlichen Friedhof zuzulassen, etwa Personen, die innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind (oder tot aufgefunden wurden). Damit soll den Angehörigen unter Umständen ein kostspieliger Leichentransport (z. B. ins Ausland) erspart bleiben. Leichen Unbekannter sollen ordnungsgemäß und zügig bestattet und letztlich der Gesundheitsschutz gewährleistet werden (vgl. Gaedke/Diefenbach, a. a. O., S. 170). Dies hat Bedeutung für Gemeinden mit großen Krankenhäusern oder Senioren-(Pflege-)Heimen. Denn durch den Umstand, dass heute die meisten Menschen nicht mehr zu Hause versterben, wird die Gemeinde, auf deren Gebiet sich eine derartige Einrichtung befindet, belastet.
Der Bestattungsanspruch besteht auch dann, wenn der verstorbene Einwohner nicht in der Gemeinde verschieden ist, deren Einwohner er war (vgl. Klingshirn, a. a. O., Kap. XII Rdnr. 12).
Zur Geltendmachung des Bestattungsanspruchs eines allein stehenden verstorbenen Altenheimbewohners s. VG Karlsruhe, Beschl. vom 22.2.1983 – 1 K 47/83 –, VBlBW 1983 S. 280 f. mit Anmerkung von Ruf, VBlBW 1984 S. 91:
Die Leiterin eines Altenheims und Pflegeheims gehört nicht zu den bestattungspflichtigen Angehörigen und ist daher ist nicht befugt, den Anspruch auf Bestattung eines auswärts verstorbenen Heimbewohners geltend zu machen (nichtamtlicher Leitsatz).
Der gegen die Gemeinde gerichtete Benutzungsanspruch ist davon unabhängig, ob neben dem





























