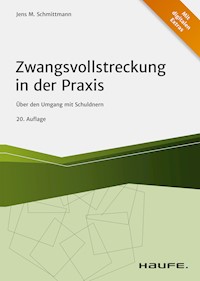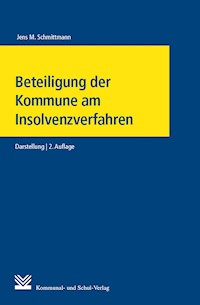
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kommunal- und Schul-Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Gemeinden und Kreise können Insolvenzgläubiger, Massegläubiger aber auch Schuldner in einem Insolvenzverfahren sein. Die Kommunen müssen sich oft als Anfechtungsgegner mit den verschiedensten Problemen der Insolvenzanfechtung und deren rechtlichen Folgen befassen. Zuweilen sind sie sogar veranlasst, selbst einen Insolvenzantrag gegen einen Schuldner der Gemeinde zu stellen, wobei nicht auszuschließen ist, dass dieser Schuldner ein ausländisches Unternehmen oder die Niederlassung eines ausländischen Schuldners ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Kommune müssen sich mit den Bestimmungen der deutschen Insolvenzordnung, gegebenenfalls auch mit den Vorschriften des Europäischen Insolvenzrechtes zu Insolvenztypischen Sachverhalten und Verfahrensabläufen vertraut machen. Die Darstellung Beteiligung der Kommune am Insolvenzverfahren ist eine Handreichung für den kommunalen Praktiker und vermittelt Kommunen einen Überblick über die Grundzüge des Insolvenzrechts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beteiligungder Kommune amInsolvenzverfahren
Darstellung
von
Prof. Dr. Jens M. SchmittmannRechtsanwalt und Steuerberater in Essen
2. Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© Copyright 2014 Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG · Wiesbaden
2. Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
Satz: C.H.Beck.Media.Solutions · Nördlingen
ISBN 978-3-8293-1359-9
eISBN 978-3-8293-1399-5
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Einleitung
1.Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens
1.1Die insolvenzunfähige Gemeinde
1.1.1Landesrechtliche Regelungen
1.1.2Kommunale Eigengesellschaften und Eigenbetriebe
1.2Insolvenzschutz kommunaler Arbeitnehmer
2.Das Insolvenzverfahren
2.1Das Insolvenzeröffnungsverfahren
2.2Die Gemeinde als Antragstellerin
2.3Das zuständige Insolvenzgericht
2.4Antragsvoraussetzungen
2.4.1Grundlagen
2.4.2Besonderheiten bei der Antragstellung durch öffentlich-rechtliche Gläubiger
2.4.3Insolvenzgründe
2.4.3.1Prüfung der Insolvenzgründe
2.4.3.1.1Zahlungsunfähigkeit
2.4.3.1.2Drohende Zahlungsunfähigkeit
2.4.3.1.3Überschuldung
2.4.3.2Haftung der antragstellenden Gemeinde
2.4.4Angaben zur Person der Antragstellerin und des Schuldners
2.4.5Nachweis der den Antrag begründenden Forderung
2.4.6Rechtliches Interesse
2.4.7Verfahrenskosten
2.4.8Kostentragung bei Antragsrücknahme
3.Eröffnung des Insolvenzverfahrens
3.1Die Gemeinde als Insolvenzgläubigerin
3.2Die Rechte der Gemeinde als Insolvenzgläubigerin
3.3Der Gläubigereinfluss bei der Insolvenzverwalterauswahl
3.4Der Gläubigerausschuss
3.5Das Recht auf Akteneinsicht
3.6Sonstige Rechte der Gläubiger
4.Anmeldung, Prüfung und Befriedigung der Forderungen
4.1Forderungsanmeldung
4.2Forderungsprüfung
4.3Verwertung der Insolvenzmasse
4.4Befriedigung der Gläubiger durch Erlösverteilung
4.5Restschuldbefreiung
5.Teilnahme am Insolvenzverfahren
5.1Die aussonderungsberechtigte Gemeinde
5.2Die absonderungsberechtigte Gemeinde
5.3Die Gemeinde als Massegläubigerin
5.3.1Die Insolvenzmasse
5.3.2Die unzulängliche Insolvenzmasse
6.Altlasten: Insolvenzforderungoder Masseverbindlichkeit
6.1Grundlagen
6.2Bodenschutzrechtliche Inanspruchnahme des Insolvenzverwalters
7.Die Gemeinde als Vertragspartnerin
7.1Das Wahlrecht des Insolvenzverwalters
7.2Miete und Pacht
7.2.1Grundlagen
7.2.2Kündigung von Miet- und Pachtverhältnissen
7.3Beispiel: Bauvertrag
8.Gemeinde und Insolvenzanfechtung
8.1Reform des Insolvenzanfechtungsrechts
8.1.1Deckungsanfechtung, § 131 InsO
8.1.2Vorsatzanfechtung, § 133 InsO
8.1.3Bargeschäft, § 142 InsO
8.1.4Verzinsung, § 143 Abs. 1 InsO
8.1.5Inkrafttreten
8.2Grundlagen des Anfechtungsrechts
8.2.1Grundlagen
8.2.2Anfechtungsbefugnis
8.2.3Rechtshandlung
8.2.4Gläubigerbenachteiligung
8.2.5Anfechtungsfrist
8.2.6Wirksamwerden der Rechtshandlung
8.3Die einzelnen Anfechtungstatbestände
8.3.1§ 130 InsO
8.3.1.1Grundlagen
8.3.1.2Kenntnis der Gläubiger
8.3.2§ 131 InsO – Inkongruente Deckung
8.3.2.1Grundlagen
8.3.2.2Inkongrunenz
8.3.2.3§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO
8.3.2.4§ 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO
8.3.2.5§ 131 Abs. 1 Nr. 3 InsO
8.3.2.6Erleichterungen für den Insolvenzverwalter
8.3.3§ 132 InsO
8.3.3.1Unmittelbare Benachteiligung
8.3.3.2Dreimonatsfrist
8.3.3.3Anfechtungssachverhalte
8.3.3.4§ 133 InsO – Vorsatzanfechtung
8.3.3.4.1Einführung
8.3.3.4.2Rechtslage bis 2017
8.3.3.4.2.1 Grundlagen
8.3.3.4.2.2 Benachteiligungsvorsatz
8.3.3.4.3Rechtslage ab 2017
8.3.4§ 134 InsO – Unentgeltliche Leistungen
8.3.5Anfechtungsausschluss durch Bargeschäft
8.3.5.1Rechtslage bis 2017
8.3.5.2Rechtslage ab 2017
8.4Rechtsfolgen der Anfechtung
8.5Kommunale Eigengesellschaften
8.6Zuständigkeit der Gerichte
9.Vollstreckungsverbot
10.Prozessunterbrechung gem. § 240 ZPO
Anhang
1.Insolvenzordnung (InsO)
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a. A.
=anderer Ansicht
a. a. O.
=am angegebenen Ort
Abs.
=Absatz
AGGVG
=Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
AGZPO-ZVG
=Ausführungsgesetz zur Zivilprozessordnung – Konkursordnung – Zwangsversteigerungsgesetz
Alt.
=Alternative
a. M.
=anderer Meinung
ÄndVO
=Änderungsverordnung
Anf
=Anfechtung
AnfG
=Anfechtungsgesetz
Anh.
=Anhang
Anm.
=Anmerkung
AO
=Abgabenordnung
ArbG
=Arbeitsgericht
Art.
=Artikel
Aufl.
=Auflage
ausf.
=ausführlich
BAG
BAGE
BauGB
=Baugesetzbuch
BauR
BayObLG
=Bayerisches Oberstes Landesgericht
BayObLGZ
BB
=Der Betriebsberater (Zeitschrift)
Bd.
Beschl.
=Beschluss
bestr.
=bestritten
betr.
=betreffend
BetrAVG
=Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
BFH
=Bundesfinanzhof
BFHE
BGBl.
=Bundesgesetzblatt
BGH
=Bundesgerichtshof
BGHZ
=Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
Bln-Bbg
=Berlin-Brandenburg
BStBl.
=Bundessteuerblatt
BVerfG
BVerfGE
=Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwG
BVerwGE
=Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
DB
=Der Betrieb (Zeitschrift)
ders.
DStR
=Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
DZWiR
EFG
=Entscheidungen der Finanzgerichte
EGInsO
=Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung
EGKO
=Gesetz, betreffend die Einführung der Konkursordnung
ESUG
=Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen
EuGH
=Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
EuGHE
=Sammlungen der Entscheidungen des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften
EuInsVO
=Verordnung (EG) über Insolvenzverfahren
EV
=Eigentumsvorbehalt
EWiR
=Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
Festschr.
=Festschrift (FS)
ff.
f.
=für
FG
=Finanzgericht
FK-InsO
=Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung (7. Aufl.)
Fn.
=Fußnote
FS
=Festschrift
GbR
gem.
=Gemäß
GG
=Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GKG
GmbH
GO
=Gemeindeordnung
GrStG
=Grundsteuergesetz
GVG
=Gerichtsverfassungsgesetz
hA
=herrschende Ansicht
Hdb.
HK-InsO
h. M.
=herrschende Meinung
Hrsg.
=Herausgeber
HS
i. d. F.
=in der Fassung
i. d. R.
=in der Regel
InsAnf.
=Insolvenzanfechtung
InsGer.
InsMasse
=Insolvenzmasse
InsO
InsVerw.
=Insolvenzverwalter
InVo
=Insolvenz und Vollstreckung (Zeitschrift)
i. V. m.
=in Verbindung mit
i. w. S.
=im weiteren Sinne
JZ
=Jursitenzeitung
KG
=Kommanditgesellschaft
KKZ
=Kommunal-Kassen-Zeitschrift
KO
=Konkursordnung
Komm.
=Kommentar
KomO
=Kommunalordnung
KomVerf
=Kommunalverfassung
KrO
KSI
=Krisen-, Sanierungs- und Insolvenzberatung (Zeitschrift)
KSVG
=Kommunalselbstverwaltungsgesetz
KSzW
=Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht
KTS
=Zeitschrift für Insolvenzrecht – Konkurs, Treuhand – Sanierung
LG
=Landgericht
LKO
LS
LVerf.
MDR
=Monatsschrift des Deutschen Rechts (Zeitschrift)
Münch.Komm.-(Verf.)
=Münchener Kommentar, 3 Bände, 3. Auflage, 2013
m. w. N.
=mit weiteren Nachweisen
NJW
NJW-RR
=NJW-Rechtsprechungs-Report, Zivilrecht
NVwZ
NWB Kommentar
=Pape/Uhländer, NWB Kommentar zum Insolvenzrecht, 2013
NZI
o. a.
OFH
OHG
=Offene Handelsgesellschaft
OLG
=Oberlandesgericht
OLGZ
=Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen
OVG
=Oberverwaltungsgericht
PSVaG
Rdnr(n).
=Randnummer(n)
Rpfleger
=„Der Deutsche Rechtspfleger“ (Zeitschrift)
Rspr.
=Rechtsprechung
Rz.
=Randziffer
S.
=Satz; Seite
s.
=siehe
SGB
s. o.
=siehe oben
sog.
=so genannte
str.
stRspr.
=ständige Rechtsprechung
StuB
=Unternehmensteuern und Bilanzen (Zeitschrift)
u.
=unten
u. a.
=unter anderem/n
unstr.
=unstreitig
Urt.
=Urteil
usw.
=und so weiter
Verf.
=Verfassung
VersR
=Versicherungsrecht (Zeitschrift)
Verw.
=Verwaltung
VG
=Verwaltungsgericht
VGH
=Verwaltungsgerichtshof
vgl.
=vergleiche
VO
=Verordnung
VOB
=Verdingungsordnung für Bauleistungen
Vorb.
vorl.
=vorläufig
VR
VuR
=Verbraucher und Recht (Zeitschrift)
WEG
=Wohnungseigentumsgesetz
WM
=Wertpapiermitteilungen
WRV
z. B.
=zum Beispiel
ZEuP
=Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
Ziff.
=Ziffer(n)
ZInsO
=Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht
ZIP
=Zeitschrift für Wirtschaft und Insolvenzpraxis
ZPO
=Zivilprozessordnung
ZVG
=Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung
ZVI
=Zeitschrift für Verbraucher-Insolvenzrecht
Literaturverzeichnis
AppDie Beteiligung kommunaler Behörden an Insolvenzverfahren und die Rechte der übrigen Verfahrensbeteiligten, InVo 1999 S. 65 f.
AppDie Einschränkung der Vollstreckungsbefugnisse der Gemeinden und die Unwirksamkeit von Vollstreckungsmaßnahmen nach der Insolvenzordnung, KKZ 1998 S. 69
AppDer Insolvenzantrag der Gemeinde, KKZ 1998 S. 113 f.
BorkEinführung in das Insolvenzrecht, 8. Aufl. 2017
Braun/UhlenbruckUnternehmensinsolvenz. Grundlagen, Gestaltungsmöglichkeiten, Sanierung mit der Insolvenzordnung, 1997
FoersteInsolvenzrecht, 6. Aufl. 2014
GanterDie Verwertung von Gegenständen mit Absonderungsrechten im Lichte der Rechtsprechung des IX. Zivilsenats des BGH, ZInsO 2007 S. 841 f.
Haarmeyer/Huber/SchmittmannPraxis der Insolvenzanfechtung, 3. Aufl., Köln, 2017
Haarmeyer/Wutzke/FörsterInsolvenzordnung – Kommentar, 2. Aufl., Köln, 2012
HaasFlankierende Maßnahmen für eine Reform des Gläubigerschutzes in der GmbH, GmbHR 2006 S. 505 ff.
Hantke/SchmittmannInsolvenzantragstellung durch öffentlich-rechtliche Gläubiger, VR 2002 S. 335 ff.
Hagemann19 Thesen zum Schicksal der kommunalen Geldforderungen im neuen Insolvenzrecht, KKZ 1998 S. 225 f.
HahnDie Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Jahre 1996 bis 2000 zur Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung, ZIP 2001 S. 399 f.
HäsemeyerInsolvenzrecht, 4. Aufl. 2007
HorstMietforderungen in der Insolvenz des Mieters, ZMR 2007 S. 167 f.
Hübschmann/Hepp/SpitalerAbgabenordnung, Loseblatt, 243. EL, 2017
Hunkemöller/TymannStolperfalle Überschuldung: Warum § 19 InsO den Sanierungsgedanken konterkariert, ZInsO 2011 S. 712 ff.
JaegerKommentar zur Insolvenzordnung, 1. Aufl. 2004 ff.
Jaufer/MayrhuberGemeindesanierung durch Insolvenzverfahren – ein österreichischer Ansatz, ZInsO 2017 S. 1926 ff.
KahlertZur Dogmatik der Umsatzsteuer im Insolvenzverfahren, DStR 2011 S. 1973 ff.
KebekusAltlasten in der Insolvenz – aus Verwaltersicht, NZI 2001 S. 63 f.
Kirchhof/Lwowski/StürnerMünchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Aufl., München, 2013 ff.
KropfInsolvenzunfähigkeit der Gemeinden und Kommunalkreditgeschäft im Lichte von Basel III, ZInsO 2012 S. 1667 ff.
Kübler/Prütting/BorkInsO – Kommentar, 73. Ergänzungslieferung, Köln, 2017
Kuhn/UhlenbruckKonkursordnung, Kommentar, 11. Aufl. 1994
Mankowski/Müller/SchmidtEuInsVO 2015 – Kommentar, München, 2016
MeyerDie Haftung des vorläufigen Insolvenzverwalters, 2003
MeyerDas Erbbaurecht in der Insolvenz, NZI 2007 S. 487 f.
NiessertDas Recht der Aus- und Absonderung nach der neuen Insolvenzordnung, InVO 1998 S. 85 f., 141 f.
OnusseitDas Urteil des BFH vom 9. Dezember 2010 – V R 22/10, DZWIR 2011, 353 ff.
PapeAkteneinsicht für Insolvenzgläubiger – Ein ständiges Ärgernis, ZIP 2004 S. 598 ff.
PapeBevorzugte Befriedigung bei Masseinsuffizienz, NJW 1992 S. 1348 ff.
PapeUnzulässigkeit der Vollstreckung des Finanzamtes bei Masseinsuffizienz, KTS 1997 S. 49 ff.
PapeZur entsprechenden Anwendung des § 166 KO auf eine Verteilung nach Einstellung mangels Masse, ZIP 1992 S. 747 ff.
PapeDie Geltendmachung und Durchsetzung von Forderungen aus vorsätzlichen unerlaubten Handlungen im Insolvenzrecht, InVO 2007 S. 352 f.
PapeZum Freigaberecht des Konkursverwalters bei Grundstücken mit Altlasten, ZIP 1991 S. 1544 f.
Pape/UhländerNWB Kommentar zum Insolvenzrecht, 1. Aufl., Herne, 2013
Paulus/SchröderÜber die Verschärfung des Rechts der Insolvenzanfechtung, WM 1999 S. 253
ReinDie Akteneinsicht Dritter im Insolvenzverfahren, NJW-Spezial 2012 S. 213 ff.
Schmidt/UhlenbruckDie GmbH in Krise, Sanierung und Insolvenz, 3. Aufl. 2003
SchmidtInsolvenzordnung – Kommentar, 19. Aufl., München, 2016
SchmittmannDie zwölf wichtigsten Anfechtungsentscheidungen des BGH aus dem ersten Halbjahr 2010 und die Folgen für die Praxis, ZInsO 2010 S. 1256 ff.
Schmittmann/Theurich/BruneDas insolvenzrechtliche Mandat, 5. Aufl. 2017
SchmittmannUmsatzsteuer aus Einzug von Altforderungen nach Insolvenzeröffnung, ZIP 2011 S. 1125 ff.
SiegmundInsolvenz(un)fähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts und ihrer nicht selbständigen Einrichtungen (Sondervermögen), ZInsO 2012 S. 2324 ff.
Tipke/KruseAbgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Kommentar, Loseblattsammlung, 149. EL, 2017
UhlenbruckInsolvenzordnung, Kommentar, 14. Aufl. 2015
UhlenbruckDie Massekostendeckung als Problem der Konkursverwalterhaftung, KTS 1976 S. 212 ff.
UhlenbruckZur falschen Handhabung des § 60 KO im Rahmen der Verfahrenseinstellung mangels Masse, KTS 1993 S. 373 ff.
Waza/Uhländer/SchmittmannInsolvenzen und Steuern, 11. Aufl., 2015
WeberVerschärfung der Rahmenbedingungen für Insolvenzantragspflichten, ZInsO 2002 S. 701 f.
Einleitung
Am 1.1.1999 ist das „neue“ Insolvenzrecht in Kraft getreten (§ 335 InsO i. V. m. Art. 110 EGInsO). Die bisherige Dreiteilung in Konkurs-, Vergleichs- und Gesamtvollstreckungsordnung ist damit weggefallen. In den alten und neuen Bundesländern gilt seit dem 1.1.1999 ein einheitliches Verfahren, in das – anders als nach früherem Recht – auch die gesicherten Gläubiger einbezogen werden. Dem Insolvenzverwalter steht die Verwertung von beweglichem Sicherungsgut zu, wenn er es in Besitz hat, § 166 Abs. 1 InsO.
Die Insolvenzordnung hat insbesondere durch den Massekostenbeitrag der gesicherten Gläubiger gemäß § 171 InsO sowie die Möglichkeiten der Insolvenzanfechtung gemäß §§ 129 ff. InsO Maßnahmen gegen die zur Zeit der Konkursordnung beklagten Masseunzulänglichkeit getroffen. Dazu gehört auch die Einbeziehung des Neuerwerbs des Schuldners in das Insolvenzverfahren. Gemäß § 35 Abs. 1 InsO erfasst das Insolvenzverfahren das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt. Damit fallen – anders als zur Zeit der Konkursordnung – auch Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen ebenso wie fortlaufendes Arbeitseinkommen des Schuldners in die Insolvenzmasse. Laufendes Arbeitseinkommen des Schuldners steht in der pfändbaren Höhe für die Gläubiger zur Verfügung. Die früheren Regelungen der Insolvenzordnung zu Gehaltsabtretungen und Gehaltspfändungen gelten ab 1.7.2014 nicht mehr. Der Schuldner hat es hinsichtlich von Erbschaften, Vermächtnissen und Schenkungen regelmäßig in der Hand, diese anzunehmen. Daher sind Massezuflüsse aus diesen Gründen unwahrscheinlich. Da der Schuldner allerdings gemäß § 287b InsO ab Beginn der Abtretungsfrist eine Erwerbsobliegenheit hat und dem Antrag des Schuldners auf Restschuldbefreiung die Abtretungserklärung gemäß § 287 Abs. 2 InsO beizufügen ist, sind bei berufstätigen Schuldnern Massezuflüsse durch laufendes Arbeitseinkommen regelmäßig.
Die Masseanreicherung fordert auch den Wegfall des Vorrechtes gem. § 59 Abs. 1 Nr. 3 KO. Die Arbeitnehmer erhalten stattdessen für die letzten drei Monate vor Verfahrenseröffnung Insolvenzgeld.
Das Insolvenzanfechtungsrecht, §§ 129 ff. InsO, ist reformiert worden, nachdem im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode „Deutschlands Zukunft gestalten“ vom 27.11.2013 ausdrücklich vorgesehen worden war, „das Insolvenzanfechtungsrecht im Interesse der Planungssicherheit des Geschäftsverkehrs sowie des Vertrauens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ausgezahlte Löhne auf den Prüfstand“ zu stellen (so Koalitionsvertrag, S. 25). Tatsächlich ist dann durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und nach dem Anfechtungsgesetz vom 29.3.2017 (BGBl. I 2017 S. 654 f.) in die Regeln zur Vorsatzanfechtung (§ 133 InsO), das Bargeschäft (§ 142 InsO) und die Verzinsungsregelung (§ 143 InsO) eingegriffen worden. Die befürchtete Umgliederung der Deckungen in der Zwangsvollstreckung von der inkongruenten in die kongruente Deckung ist indes ausgeblieben.
Die Insolvenzordnung hat zudem vordergründig Gläubigervorteile beseitigt, z. B. das Fiskusprivileg (Wegfall des Steuervorrechtes gem. § 61 Abs. 1 Nr. 2 KO; § 17 Abs. 3 Nr. 3 GesO). Die Finanzverwaltung hat sich stets schwer mit dieser Neuregelung abgefunden. So wurden zunächst sukzessive einzelne Regelungen eingeführt, die im Ergebnis zu einer Besserstellung der Finanzverwaltung geführt haben, z. B. die Bauabzugsteuer gemäß §§ 48 ff. EStG sowie die Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei § 13b UStG. Die Bundesregierung hatte durch den Entwurf des Jahressteuergesetzes 2007 vom 23. August 2006 versucht, zumindest ein Fiskusvorrecht für die Zeit des vorläufigen Insolvenzverfahrens zu schaffen, indem § 251 Abs. 4 AO Steuerverbindlichkeiten aus dem vorläufigen Verfahren zu Masseverbindlichkeiten machen sollte, was seinerzeit noch am Widerstand des Bundestages gescheitert ist. Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2011 (BGBl. I 2010 S. 1885) wurde für Insolvenzverfahren, die nach dem 31.12.2010 beantragt worden sind, geregelt, dass Verbindlichkeiten des Steuerschuldners aus dem Steuerschuldverhältnis, die von einem vorläufigen Insolvenzverwalter oder vom Schuldner mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters begründet worden sind, nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens als Masseverbindlichkeit gelten. Im Jahre 2010 passierte die Regelung nahezu unbeanstandet Bundestag und Bundesrat.
In Anbetracht der umfassenden Neugestaltung dieses Rechtsgebietes wurden nach einer gewissen Erfahrungszeit Anpassungen erforderlich. Durch das Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung vom 26.10.2001 (BGBl. I S. 2701) wurde auch völlig mittellosen Personen der Zugang zum Insolvenzverfahren und damit zu einer Restschuldbefreiung eröffnet. Durch eine Änderung des § 9 InsO wurde erreicht, dass öffentliche Bekanntmachungen auch über das Internet erfolgen können. Ausgenommen hiervon wurden lediglich die Eröffnungen, die nach der InsO zwingend im Bundesanzeiger bekannt zu machen sind. Überdies hat nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InsO ein vorläufiger Insolvenzverwalter, auf den die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das schuldnerische Vermögen übergegangen ist (sog. starker vorläufiger Verwalter) das Unternehmen des Schuldners fortzuführen. Wenn auch das Gesetz solche Verwertungshandlungen nicht abdeckt, kann mit Zustimmung des Insolvenzgerichtes das Unternehmen stillgelegt werden, um erhebliche Wertminderungen zu vermeiden. Damit wird dem starken vorläufigen Insolvenzverwalter jedoch nicht jede Veräußerung von Bestandteilen des schuldnerischen Unternehmens verwehrt. Er ist vielmehr befugt, im Rahmen seiner Verwaltungsbefugnis Notverwertungen vorzunehmen, um eine erhebliche Wertminderung von Massegegenständen zu verhindern.
Durch das Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpaketes zur Stabilisierung des Finanzmarktes (FMStG) vom 17.10.2008 (BGBl. I 2008 S. 1982) wurde der Überschuldungsbegriff des § 19 Abs. 2 InsO dahin geändert, dass Überschuldung vorliegt, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich (vgl. Waza/Uhländer/Schmittmann, Insolvenzen und Steuern, Rdnr. 116 ff.).
Weitreichende Änderungen der Insolvenzordnung erfolgten auch durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) vom 23.10.2008 (BGBl. I 2008 S. 2026). Die Änderungen betreffen insbesondere die Erweiterung der Insolvenzantragspflicht auf Scheinauslandsgesellschaften, das Recht der Gesellschafterdarlehen sowie die führungslose Gesellschaft (vgl. im Einzelnen: Waza/Uhländer/Schmittmann, Insolvenzen und Steuern, Rdnr. 91 ff.).
Durch das Gesetz zur Reform des Kontopfändungsschutzes vom 7.7.2009 (BGBl. I 2009 S. 1707) wurde das sogenannte „Pfändungsschutzkonto“ eingeführt sowie das Recht der Pfändung von Bankguthaben modifiziert (vgl. Waza/Uhländer/Schmittmann, Insolvenzen und Steuern, Rdnr. 154).
Durch das Gesetz zur Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung vom 29.7.2009 (BGBl. I 2009 S. 2258) wurde das Zwangsvollstreckungsrecht vom Grundsatz her in erheblichem Umfang reformiert. In der Insolvenzordnung wurden durch das Gesetz § 26 Abs. 2 InsO und § 98 Abs. 3 InsO angepasst.
Durch das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht vom 29.7.2009 (BGBl. I 2009 S. 2355) wurden neben umfangreichen Änderungen im BGB in der Insolvenzordnung die Regelungen der §§ 21 Abs. 2 Satz 2, 96 Abs. 2 Satz 3 und 147 Satz 2 InsO geändert (vgl. Waza/Uhländer/Schmittmann, Insolvenzen und Steuern, Rdnr. 156).
Durch das Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie vom 19.11.2010 (BGBl. I 2010 S. 1592) wurden Vorschriften der Insolvenzordnung geändert, die sich auf Wertpapiergeschäfte und Finanzsicherheiten beziehen.
Die seit dem MoMiG bedeutendste Änderung der Insolvenzordnung erfolgte durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen vom 7.12.2011 (BGBl. I 2011 S. 2582; vgl. Waza/Uhländer/Schmittmann, Insolvenzen und Steuern, Rdnr. 159 ff.; Brinkmann, Der strategische Eigenantrag – Missbrauch oder kunstgerechte Handhabung des Insolvenzverfahrens?, ZIP 2014 S. 197 ff.; Brinkmann/Herbertz, ESUG-Zwischenbilanz: Weniger Schutzschirme, mehr Eigenverwaltung, KSI 2014 S. 119 ff.; Brünkmans, Die Unternehmensakquisition über einen Kapitalschnitt im Insolvenzplanverfahren, ZIP 2014 S. 1857 ff.; Dahl, Die Neuerungen des ESUG – Ein Überblick, NJW-Spezial 2012 S. 21 f.; Ebbinghaus/Neu/Hinz, Forderungsverzicht oder Debt-Equity-Swap bei der Eigensanierung im Insolvenzplanverfahren, NZI 2014 S. 729 ff.; Ehlers, Teilnahme und Nutzen einer Mitgliedschaft im Gläubigerausschuss, BB 2013 S. 259 ff.; Ehlers, Die 2. Stufe der Insolvenzrechtsreform – Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte, DStR 2013 S. 1338 ff.; Fölsing, Eingriff Gesellschafterrechte durch Insolvenzplan, KSI 2014 S. 123 ff.; Foerste, Gläubigerautonomie und Sanierung im Lichte des ESUG, ZZP 2012 S. 265 ff.; Frind, Aktuelle Anwendungsprobleme beim „ESUG“ – Teil 1, ZInsO 2013 S. 59 ff.; Teil 2, ZInsO 2013 S. 279 ff.; Frind, Probleme bei Bildung und Kompetenz des vorläufigen Gläubigerausschusses, BB 2013 S. 265 ff.; Frind, Der Fragebogen zur Erleichterung der Ermittlungen zur Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters – nie war er so wertvoll wie heute, ZInsO 2014 S. 1315 ff.; Frind, Bewertung des neuen IDW S 9 (Bescheinigung gem. § 270b InsO) aus gerichtlicher Sicht, ZInsO 2014 S. 2264 f.; Fuhst, Das neue Insolvenzrecht – Ein Überblick, DStR 2012 S. 418 ff.; Graf Brockdorff/Heintze/Rolle, „Chance of Control“ im Planinsolvenzverfahren – verbesserte Chancen für Gesellschafter und Investoren durch das ESUG, BB 2014 S. 1859 ff.; Gruber, Die neue Korrumpierungsgefahr bei der Insolvenzverwalterbestellung, NJW 2013 S. 584 ff.; Günther, Auswirkungen des ESUG auf das Insolvenzplanverfahren, ZInsO 2012 S. 2037 ff.; Gutmann, ESUG – erleichterte Unternehmenssanierung, erleichterter Berufsstand?, AnwBl. 2013 S. 615 ff.; Graf-Schlicker, Der Einfluss des ESUG auf die Tätigkeit der Insolvenzgerichte, WPg-Sonderheft 2011 S. 55 ff.; Heinrich, Insolvenzplan „reloaded“ – Zu den Änderungen im Insolvenzplanverfahren durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung zur Sanierung von Unternehmen, NZI 2012 S. 235 ff.; Hölzle, Eigenverwaltung in Insolvenzverfahren nach ESUG – Herausforderungen für die Praxis, ZIP 2012 S. 158 ff.; Horstkotte/Martini, Die Einbeziehung der Anteilseigner in den Insolvenzplan nach ESUG, ZInsO 2012 S. 557 ff.; Hunsalzer, Haftung für Sozialversicherungsbeiträge und deren Insolvenzanfechtung im Schutzschirmverfahren gem. § 270b InsO, ZInsO 2014 S. 1748 ff.; Jenal, Der Debt to Equity Swap als Mittel zur Bewältigung der Krise, KSI 2014 S. 112 ff.; Kolmann, Schutzschirmverfahren, Köln, 2014; Kolmann, Schutzschirmverfahren – ein Fahrplan aus Unternehmenssicht, DB 2014 S. 1363 ff.; Landfermann, Das neue Unternehmenssanierungsgesetz (ESUG), WM 2012 S. 869 ff.; Längsfeld, (Un-)Wirksamkeit von Change-of-Control-Klauseln, NZI 2014 S. 734 ff.; Laroche/Pruskowski/Schöttler/Siebert/Vallender, 30 Monate ESUG – eine Zwischenbilanz aus insolvenzrechtlicher Sicht, ZIP 2014 S. 2153 ff.; Lau, Das Eröffnungsverfahren (§ 270a InsO) mit anschließender Eigenverwaltung aus der Sicht eines (vorläufigen) Sachwalters, DB 2014 S. 1417 ff.; Lemken, Das Schutzschirmverfahren – ein Überblick nach 2½ Jahren ESUG, InsbürO 2014 S. 423 ff.; Madaus, Die Bewältigung von Massenschäden über ein Planverfahren – Möglichkeiten und Grenzen des neuen Insolvenzrechts, ZIP 2014 S. 160 ff.; Mock, Gläubigerautonomie und Vergütung des Insolvenzverwalters, KTS 2012 S. 59 ff.; Mönning, Neues Sanierungsrecht – ESUG: Der große Wurf?, RAW 2013 S. 27 ff.; Müller, Der Debt-Equity-Swap als Sanierungsinstrument, KSzW 2013 S. 65 ff.; Pape, Gesetz zur weiteren Erleichterung zur Sanierung von Unternehmen, ZAP Fach 14 S. 629 ff.; Rattunde, Das neue Insolvenzplanverfahren nach dem ESUG, GmbHR 2012 S. 455 ff.; Rugullis, Neue Gesetze schaffen neue Probleme, Zur Auslegung der besonderen Verjährungsfrist des § 259b InsO, NZI 2012 S. 825 ff.; Sämisch, Das Beschwerderecht und das Recht auf rechtliches Gehör im Verfahren über die Einsetzung eines Sachwalters nach § 270b InsO, ZInsO 2014 S. 1312 ff.; Schmittmann, Die verpasste Chance zur Kodifizierung eines Insolvenzsteuerrechts, StuB 2012 S. 109 ff.; Schmittmann, Erweiterung des Gläubigereinflusses auf die Wahl des Insolvenzverwalters, StuB 2012 S. 355 ff.; Schmittmann/Dannemann, Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, VR 2012 S. 73 ff.; Schmittmann, Stärkung der Eigenverwaltung durch das ESUG, StuB 2012 S. 150 ff.; Schneider/Höpfner, Die Sanierung von Konzernen durch Eigenverwaltung und Insolvenzplan, BB 2012 S. 87 ff.; Schumm, Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG), StuB 2012 S. 25 ff.; Thiessen, Ein Insolvenzplan für den Kapitalismus?, KTS 2014 S. 155 ff.; Trams, Verwalterwahl nach ESUG – Revolution oder Sturm im Wasserglas?, NJW-Spezial 2012 S. 149 f.; Undritz, Ermächtigung und Kompetenz zur Begründung von Masseverbindlichkeiten beim Antrag des Schuldners auf Eigenverwaltung, BB 2012 S. 1551 ff.; Vallender, Der Insolvenzrichter als Schaltstelle des gerichtlichen Sanierungsverfahrens?, Teil 1, DB 2012 S. 1609 ff.; Teil 2, DB 2012 S. 1669 ff.; Vallender, Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) – Das reformierte Plan- und Eigenverwaltungsverfahren, MDR 2012 S. 125 ff.; Vallender, Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) – Änderungen des Insolvenzeröffnungsverfahrens, MDR 2012 S. 61 ff.; Voß, Neue Sanierungschancen durch Reform des Insolvenzverfahrens nach ESUG, InsbürO 2013 S. 256 ff.; Weber/Knapp, Praxis „meets“ Meinungsstreit: Umgang mit Rechtsprechung und Literatur in der Praxis des Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahrens, ZInsO 2014 S. 2245 ff.). Das ESUG ändert eine Vielzahl von Vorschriften der Insolvenzordnung und regelt insbesondere die Auswahl des Insolvenzverwalters, die Eigenverwaltung sowie das Insolvenzplanverfahren neu. Darüber hinaus wurde ein Schutzschirmverfahren eingeführt. Von diesen Maßnahmen verspricht sich der Gesetzgeber eine Stärkung des Standortes Deutschland. Die relevanten Änderungen werden an den jeweiligen Stellen der Ausführungen erörtert.
Durch das Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte vom 15.7.2013 (BGBl. I 2013 S. 2379; vgl. Ahrens, Reform des Insolvenzverfahrens natürlicher Personen verabschiedet, NJW-Spezial 2013 S. 341 f.; Ahrens, Feststellungsinteresse für einen qualifizierten Forderungsgrund, NJW-Spezial 2013 S. 725 f.; Ahrens, Abpfiff – Eine Stellungnahme zu den geplanten Änderungen in § 302 Nr. 1 InsO-RefE 2012, ZVI 2012 S. 122 ff.; Ahrens, Die Reform des Privatinsolvenzrechts 2014, NJW 2014 S. 1841 ff.; Blankenburg/Godzierz, Die vorzeitige Restschuldbefreiung gem. § 300 Abs. 1 Satz 2 InsO im laufenden Insolvenzverfahren, ZInsO 2014 S. 1360 ff.; Beyer, Insolvenzplanverfahren bei natürlichen Personen, ZVI 2013 S. 334 ff.; Ahrens, Lohnabtretungen in der Insolvenz nach der Aufhebung von § 114 InsO, NZI 2014 S. 529 ff.; Ahrens, Systematisches und Unsystematisches bei den RSB-Versagungsverfahren, ZVI 2014 S. 227 ff.; Allemand/Dobiey/Henning, Nicht planlos beim Plan für Verbraucher, INDat-Report 04/2014 S. 28 f.; Buchholz, Der Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte, NZI 2012 S. 655 ff.; Dornbluth/Pape, Ausweitung der ausgenommenen Forderungen des § 302 Nr. 1 InsO ab 1.7.2014, ZInsO 2014 S. 1625 ff.; Frind, Ein „schlankes“ neues Privatinsolvenzverfahren?, ZInsO 2012 S. 1455 ff.; Frind, PraxisPrüfstand: Die Vorschläge zur Neuordnung des Insolvenzverfahrens natürlicher Personen – Teil 1, ZInsO 2012 S. 475 ff. – Teil 2, ZInsO 2012 S. 668 ff.; Frind, Praxisprobleme des reformierten Privatinsolvenzverfahrens: Zur praktischen Umsetzung von „Eingangsentscheidung“ und Verkürzung der Restschuldbefreiungserteilungszeit, ZInsO 2013 S. 1448 ff.; Frind, Der „auf Halde“ gelegte Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung – Anmerkungen zum praxisgerechten Umgang mit einem gesetzgeberischen „Schildbürgerstreich“, NZI 2013 S. 729 ff.; Frind, Störeinflüsse im Privatinsolvenz-Planverfahren, ZInsO 2014 S. 280 ff.; Frind, Das hindernisreiche Insolvenz-Planverfahren für natürliche Personen, BB 2014 S. 2179 ff.; Graeber, Reform der Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren, Teil 4, InsbürO 2013 S. 339 ff.; Grote, Reform der Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren, Teil 2, InsbürO 2013 S. 295 f.; Teil 3, InsbürO 2013 S. 296 f.; Teil 9, InsbürO 2014 S. 47 ff.; Grote/Pape, Der Referentenentwurf zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und Stärkung der Gläubigerrechte, ZInsO 2012 S. 409 ff.; Grunicke, Der neue § 302 Nr. 1 InsO – Fiskusprivileg durch die Hintertür?, ZVI 2014 S. 361 ff.; Harder, Die geplante Reform des Verbraucherinsolvenzrechts, NZI 2012 S. 113 ff.; Harder, Der schnelle Weg zur Restschuldbefreiung, NJW-Spezial 2014 S. 277 f.; Harder, Die Verkürzung des Insolvenzverfahrens nach § 300 InsO, NJW-Spezial 2014 S. 469 f.; Heinke, Die Modifikation des § 290 InsO durch die Schuldrechtsreform, VIA 2014 S. 49 ff.; Henning, Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens gemäß § 300 InsO n. F. – aus Schuldnersicht, ZVI 2014 S. 219 ff.; Heyn, Reform der Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren – ein alphabetisch sortierter Überblick über die Änderungen, InsbüRo 2014 S. 329 ff.; Hirte, Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrecht (BT-Drs. 17/11268) für den Deutschen Bundestag, ZInsO 2013 S. 171 ff.; Graf-Schlicker, Insolvenzrechtsreform 2014 – aus dem Blickwinkel des Gesetzgebungsverfahrens, ZVI 2014 S. 202 ff.; Grote, Reform des Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahrens – Teil 11: Insolvenzplanverfahren für Verbraucher? Teil 1, InsbürO 2014 S. 203 ff.; Grote, Reform des Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahrens – Teil 12: Insolvenzplanverfahren für Verbraucher?, Teil 2, InsbürO 2014 S. 252 ff.; Grote/Pape, Das Ende der Diskussion? Die wichtigsten Neuregelungen zur Restschuldbefreiung, ZInsO 2013 S. 1433 ff.; Grote/Pape, Endlich: Die Reform der Verbraucherinsolvenz – lohnte das den Aufwand?, AnwBl. 2013 S. 601 ff.; Grote/Pape, 1. Juli 2014: Reform der Entschuldung natürlicher Personen tritt in Kraft, AnwBl. 2014 S. 614 ff.; Henning, Die Änderungen in den Verfahren der natürlichen Personen durch die Reform 2014, ZVI 2014 S. 77 f.; Homann, Die Reform des Rechts der Verbraucherentschuldung zum 1. Juli 2014: Evolution statt Revolution, DGVZ 2014 S. 160 ff.; Heyer, Eintragungen in das Schuldnerverzeichnis nach § 303a InsO n. F., ZVI 2014 S. 244 ff.; Hofmeister, Insolvenzrechtsreform 2014: Kein Hinkelstein, aber jede Menge Schotter im Detail, ZVI 2014 S. 247 ff.; Jäger, Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens gemäß § 300 InsO n. F. – aus Gläubigersicht, ZVI 2014 S. 223 ff.; Klomfaß, Die zweite Stufe der Insolvenzrechtsreform ist beschlossen: Zu den künftigen Änderungen insbesondere des Restschuldbefreiungsverfahrens, Gemeindehaushalt 2013 S. 159 ff.; Kluth, Die Verkürzung der Wohlverhaltensphase auf drei Jahre nach § 300 I 2 Nr. 2 InsO nF – Eine kritische Betrachtung, NZI 2014 S. 801 ff.; Lackmann, Reform des Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahrens – Teil 14: Neue Herausforderungen für die anerkannten Beratungsstellen?, InsbürO 2014 S. 303 ff.; Laroche/Siebert, Neuerungen bei Versagung und Erteilung der Restschuldbefreiung, NZI 2014 S. 541 ff.; Leipold, Anmerkungen eines Rechtspflegers in Insolvenzsachen zum Gesetz zur „Verkürzung der Wohlverhaltensphase“, ZInsO 2013 S. 2052 f.; Lissner, Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und der neue Insolvenzplan im Verbraucherverfahren – ein Wettstreit der Systeme?, ZInsO 2014 S. 1835 ff.; Pape, Verbraucherinsolvenz 2012 – Gefühlter und tatsächlicher Reformbedarf, ZVI 2012 S. 150 ff.; Pape, Neues Insolvenzverfahren über das Vermögen natürlicher Personen ab 1. Juli 2014 – Hinweise für die Beratungspraxis, NWB 2014 S. 610 ff.; Pape, Fortfall der Zweistufigkeit bei den RSB-Versagungsgründen, § 297a InsO n. F.; ZVI 2014 S. 234 ff.; Pape, Reform des Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahrens – Teil 13: Neuregelung des asymmetrischen Verfahrens im Gesetz zur Verkürzung des Insolvenzverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte, InsbürO 2014 S. 299 ff.; Pape/Grote, Das neue Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren, AnwBl. 2012 S. 507 ff.; Reck/Köster, Neuregelung der Sperrfristen durch das „Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte“, ZVI 2014 S. 325 ff.; Regulis, Schuldenbereinigungsplan und Insolvenzplan – ein Rechtsfolgenvergleich, NZI 2013 S. 869 ff.; Rein, Wer bezahlt die neuen Aufgaben der Schuldnerberatungsstellen?, INDat-Report 04/2014 S. 30 f.; Rein, Der Insolvenzplan im Verbraucherinsolvenzverfahren, ZVI 2014 S. 239 f.; Rothenburg/Echternkamp, Das Restschuldbefreiungsverfahren auf dem Prüfstand – Ein Instrument zur nachhaltigen Überwindung der Überschuldung?, ZVI 2011 S. 148 ff.; Schmerbach, Der Regierungsentwurf vom 18. Juli 2012 – Änderungen in Insolvenzverfahren natürlicher Personen, NZI 2012 S. 689 ff.; Schmerbach, RefE 2012: Geplante Änderungen im Restschuldbefreiungsverfahren und Vollübertragung auf den Rechtspfleger, NZI 2012 S. 161 ff.; Schmerbach, Vereinfachung des Restschuldbefreiungsverfahrens, ZInsO 2012 S. 91 ff.; Schmerbach, Überblick über die Änderungen in Insolvenzverfahren natürlicher Personen, Verbraucherinsolvenz aktuell 2013 S. 41 ff.; Schmerbach, Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte verabschiedet – Ende gut, alles gut?, NZI 2013 S. 566 ff.; Schmerbach, Reform der Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren, Teil 1 – Deutliche Worte des Gesetzgebers zur Berücksichtigung von Aus- und Absonderungsrechten bei der Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters, InsbürO 2013 S. 255 f.; Schmerbach, Reform der Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren, Teil 7 – Das neue Recht der Versagung, InsbürO 2013 S. 471 ff.; Schmerbach, Übersicht über den Verfahrensablauf in den ab dem 1.7.2014 beantragten Insolvenzverfahren natürlicher Personen, NZI 2014 S. 553 ff.; Schmerbach, Kosten bei vorzeitiger Erteilung der RSB nach drei Jahren gem. § 300 InsO n. F. und beim Insolvenzplan, NZI 2014 S. 554 f.; Schmerbach/Semmelbeck, Zwölf offene Fragen zur Reform der Privatinsolvenz, NZI 2014 S. 547 ff.; Schmidt, Was wird aus der Sperrfrist-Rechtsprechung des BGH?, ZVI 2014 S. 211 ff.; Schmittmann/Dannemann, Die zweite Stufe der Insolvenzrechtsreform aus Sicht der öffentlich-rechtlichen Gläubiger, VR 2012 S. 253 ff.; Schmittmann, Kann ein Steuerhinterzieher ein redlicher Schuldner sein? – Standpunkt zur geplanten Stärkung der Gläubigerrechte, Verbraucherinsolvenz aktuell 2012 S. 41 ff.; Schmittmann, Restschuldbefreiung für hinterzogene Steuern, Verbraucherinsolvenz aktuell 2013 S. 1 ff.; Schmittmann, Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte, StuB 2013 S. 621 ff.; Schmittmann, Reform des Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahrens – Teil 10: Die Neufassung der Deliktforderungen in § 302 InsO, InsbürO 2014 S. 159 ff.; Schöttler/Siebert, Änderungsbedarf der Versicherung zum Restschuldbefreiungsantrag in den neuen Verbraucherinsolvenzantragsformularen, NZI 2014 S. 681 ff.; Scholz-Schulze/Graeber, Checkliste der durch die Insolvenzgerichte zu beachtenden Änderungen ab dem 1.7.2014, ZInsO 2014 S. 587 ff.; Semmelbeck, Mindestvergütung ab 1.7.2014, NZI 2014 S. 554 f.; Semmelbeck, Auskunftsanspruch des Schuldners im Rahmen des § 300 I 2 InsO, Verbraucherinsolvenz aktuell 2014 S. 57 ff.; Siebert, Geplante Änderungen im Verbraucherinsolvenzverfahren, Verbraucherinsolvenz aktuell 2012 S. 17 ff.; Stapper/Schädlich, Zweite Stufe der Insolvenzrechtsreform verabschiedet, NWB 2013 S. 2005 ff.; Stephan, Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens, zur Stärkung der Gläubigerrechte und zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen, ZVI 2012 S. 85 ff.; Stephan, Die „vergessenen Gläubiger“ im Verbraucherinsolvenzplan, NZI 2014 S. 539 ff.; Stephan, Die Erwerbsobliegenheit des Schuldners ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens, ZVI 2014 S. 214 ff.; Streck, Die Eingangsentscheidung gemäß § 287a InsO – Mehrarbeit für Gerichte und Verwalter?, ZVI 2014 S. 205 ff.; Strüder, Die Eingangsentscheidung nach § 287a InsO, Verbraucherinsolvenz aktuell 2014 S. 73 ff.; Vallender, Die anstehende Reform des Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahrens, KSzW 2012 S. 260 ff.; Vallender, Die originäre Anfechtungsbefugnis des Insolvenzverwalters im reformierten Verbraucherinsolvenzverfahren, NZI 2014 S. 535 ff.; Waltenberger, Die neue Zulässigkeitsentscheidung des Restschuldbefreiungsantrags und die von der Restschuldbefreiung ausgenommenen Forderungen, ZInsO 2013 S. 1458 ff.; Wedekind, Nur die Quote zählt!? – Zuckerbrot und Peitsche bei den Änderungen zur Verbraucherinsolvenz, VuR 2011 S. 241 f.; Wedekind, Zweite Chance und Kohle, INDat-Report 4/2013 S. 44 ff.; Wipperfürth, Reform der Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren, Teil 5, InsbürO 2013 S. 383 ff.; Wipperfürth, Reform der Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren, Teil 6, InsbürO 2013 S. 426 ff.) wurde das Verbraucherinsolvenzverfahren in erheblichem Umfang reformiert. Dabei ist insbesondere die Möglichkeit der Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und eine gesetzliche Regelung der „asymmetrischen“ Verfahren geschaffen worden, aber auch eine Umqualifikation von Verbindlichkeiten des Schuldners aus einem Steuerschuldverhältnis, sofern der Schuldner im Zusammenhang damit wegen einer Steuerstraftat rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Regelungen werden im Einzelnen in den nachfolgenden Ausführungen vorgestellt.
Die dritte und letzte Stufe der Insolvenzrechtsreform stellt das Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen vom 13.4.2017 (BGBl. I 2017 S. 866 ff.; vgl. Andres/Möhlenkamp, Konzerne in der Insolvenz – Chance auf Sanierung?, BB 2013 S. 579 ff.; Beck, Perspektiven eines Konzerninsolvenzrechts, DZWIR 2014 S. 381 ff.; Beck, Das Konzernverständnis im Gesetzesentwurf zum Konzerninsolvenzrecht, DStR 2013 S. 2468 ff.; Bilgery, Die Eigenverwaltung in der Konzerninsolvenz, ZInsO 2014 S. 1694 ff.; Brinkmann, Grenzüberschreitende Sanierung und europäisches Insolvenzrecht, KTS 2014 S. 381 ff.; Brünkmans, Regierungsentwurf zum Konzerninsolvenzrecht, DB 39/2013, M 1; Brünkmans, Auf dem Weg zum europäischen Konzerninsolvenzrecht, ZInsO 2013 S. 797 ff.; Brünkmans, Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen: Kritische Analyse und Anregungen aus der Praxis, ZIP 2013 S. 193 ff.; Eble, Auf dem Weg zu einem europäischen Konzerninsolvenzrecht – Die „Unternehmensgruppe“ in der EuInsVO 2017 S. NZI 2016 S. 115 ff.; Eidenmüller, Die Restrukturierungsempfehlung der EU-Kommission und das deutsche Restrukturierungsrecht, KTS 2014 S. 401 ff.; Flöther/Hoffmann, Die Eigenverwaltung in der Konzerninsolvenz in Festschrift Kübler, München, 2015, S. 147 ff.; Frind, Gefahren und Probleme bei der insolvenzgesetzlichen Regelung der Insolvenz der „Unternehmensgruppe“, ZInsO 2014 S. 927 ff.; Frind/Pannen, Einschränkung der Manipulation der insolvenzrechtlichen Zuständigkeiten durch Sperrfristen – ein Ende des Forum Shopping in Sicht?, ZIP 2016 S. 398 ff.; Harder, Das neue deutsche Konzerninsolvenzrecht im Überblick, NJW-Spezial 2017 S. 469 ff:; Harder/Lojowsky, Der Diskussionsentwurf für ein Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen – Verfahrensoptimierung zur Sanierung von Unternehmensverbänden?, NZI 2013 S. 327 ff.; Humbeck, Plädoyer für ein materielles Konzerninsolvenzrecht, NZI 2013 S. 957 ff.; Leutheusser-Schnarrenberger, 3. Stufe der Insolvenzrechtsreform – Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen, ZIP 2013 S. 97 ff.; Mückl/Götte, Arbeitsrechtliche Aspekte des neuen Konzerninsolvenzrechts, ZInsO 2017 S. 623 ff.; Pannen, Aspekte der europäischen Konzerninsolvenz, ZInsO 2014 S. 222 ff.; Pleister, Das besondere Koordinationsverfahren nach dem Diskussionsentwurf für ein Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen, ZIP 2013 S. 1013 ff.; Prager/Keller, Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Reform der EuInsVO, NZI 2013 S. 57 ff.; Reuter, Grünes Licht für gesetzliches Relikt, INDat Report 2/2017 S. 14; Schlegel, Harmonisierung des Rechtsrahmens für effiziente (vorinsolvenzliche) Unternehmenssanierung – EU-Kommission arbeitet an Richtlinienvorschlag, DB 2016 SW. 819 f.; Schmidt, Flexibilität und Praktikabilität im Konzerninsolvenzrecht – Die Zuständigkeitsfrage als Beispiel, ZIP 2012 S. 1053 ff.; J. Schmidt, Das Prinzip „eine Person, ein Vermögen, eine Insolvenz“ und seine Durchbrechungen vor dem Hintergrund der aktuellen Reformen im europäischen und deutschen Recht, KTS 2015 S. 19 ff.; K. Schmidt, Das „Gruppenbild“ im Konzerninsolvenzrecht – Ein Ausblick auf den geplanten § 3e InsO in Festschrift Kübler, München, 2015, S. 633 ff.; Schmittmann, Standpunkt: Regierungsentwurf Konzerninsolvenzrecht – Kompetenz durch Konzentration, INDat-Report 06/2013 S. 18 f.; Schmittmann, Aktuelle insolvenzrechtliche Entwicklungen in der Gesetzgebung, RAW 2015 S. 125 ff.; Schmittmann/Schröer, Stand der Reformvorhaben der Bundesregierung und der Europäischen Kommission auf dem Gebiet des Insolvenzrechts, FOM Newsbox Wirtschafts- und Steuerrecht Nr. 45 vom 19. Juli 2013 (https://www.fom.de/uploads/forschungsprojekte/downloads/FOM_Forschung_Newsbox_045_13_07_19.pdf); Schneider/Höpfner, Die Sanierung von Konzernen durch Eigenverwaltung und Insolvenzplan, BB 2012 S. 87 ff.; Siemon/Frind, Der Konzern in der Insolvenz, NZI 2013 S. 1 ff.; Siemon, Konzerninsolvenzverfahren – wird jetzt alles besser?, NZI 2014 S. 55 ff.; Siemon, Plädoyer zur Gründung einer überparteilichen und verbandsunabhängigen Expertenkommission zur Fortentwicklung des deutschen Insolvenz- und Konzerninsolvenzrechts, ZInsO 2014 S. 1318 ff.; Thole, Das neue Konzerninsolvenzrecht in Deutschland und Europa, KTS 2014 S. 351 ff.; Vallender, Der deutsche Motor stockt, aber Europa drückt aufs Gas, ZInsO 2015 S. 57 ff.; Verhoeven, Konzerne in der Insolvenz nach dem Regierungsentwurf zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen (RegE) – Ende gut, alles gut … und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende!, ZInsO 2014 S. 217 ff.; Wimmer, Konzerninsolvenzen im Rahmen der EuInsVO – Ausblick auf die Schaffung eines deutschen Konzerninsolvenzrechts, DB 2013 S. 1343 ff.; Wolf, Die Konzerninsolvenz, StuB 2013 S. 736 f.) dar. Dieses Gesetz sieht zunächst die Schaffung eines Gruppen-Gerichtstands vor. Das zunächst angerufene Insolvenzgericht soll auch für die Insolvenzverfahren über die anderen gruppenangehörigen Schuldner zuständig sein, wenn in Bezug auf den Schuldner ein zulässiger Eröffnungsgrund vorliegt und der Schuldner nicht offensichtlich von untergeordneter Bedeutung für die gesamte Unternehmensgruppe ist. Bei Licht betrachtet handelt es sich indes allerdings nicht um ein echtes „Konzerninsolvenzverfahren“, sondern lediglich um die Koordination von Insolvenzverfahren über das Vermögen der einzelnen konzernangehörigen schuldnerischen Unternehmen. Für die Koordination der verschiedenen Verfahren bestellt das Koordinationsgericht gemäß § 269e Abs. 1 Satz 1 InsO eine von den gruppenangehörigen Schuldnern und deren Gläubigern unabhängige Person zum Verfahrenskoordinator, der für eine abgestimmte Abwicklung der Verfahren über die gruppengehörigen Schuldner zu sorgen hat, soweit dies im Interesse der Gläubiger liegt. Zu diesem Zweck kann er insbesondere einen Koordinationsplan im Sinne von § 269h InsO vorlegen.
Auf dem Gebiet des Europäischen Insolvenzrechts ist an die Stelle der EuInsVO 2000 die Verordnung (EU) 2915/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.5.2015 über Insolvenzverfahren (EuInsVO 2015) getreten. Sie ist in wesentlichen Teilen seit dem 26.6.2017 in Kraft.
Darüber hinaus ist auf der Ebene der Europäischen Union der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie 2012/30/EU vom 22.11.2016, Europäische Kommission COM (2016) 723 final, zu berücksichtigen.
Die Zahl der Unternehmensinsolvenzverfahren geht nachhaltig zurück. Während in den Jahren 2003 und 2004 noch 39.320 bzw. 39.213 Unternehmensinsolvenzverfahren eröffnet worden sind, ist die Zahl in den Jahren 2015 und 2016 auf 23.101 und 21.518 Unternehmensinsolvenzverfahren zurückgegangen. Während im Jahre 2010 mit 168.458 Insolvenzverfahren insgesamt ein Höchststand erreicht war, beträgt die Zahl nunmehr (2016) lediglich noch 122.514 Insolvenzverfahren insgesamt.
Es ist nicht auszuschließen, dass ausländische Gesellschaften mehr und mehr ihren wirtschaftlichen Mittelpunkt in Deutschland haben werden und daher Gemeinden ihre Forderungen gegen diese ausländischen Gesellschaften in einem Haupt- oder Sekundärinsolvenzverfahren anmelden müssen.
Dies macht es erforderlich, dass vornehmlich gemeindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich „Finanzwesen“ sich nicht nur mit den Bestimmungen der deutschen Insolvenzordnung, sondern auch mit den Vorschriften des Europäischen Insolvenzrechtes zu insolvenztypischen Sachverhalten und Verfahrensabläufen vertraut machen müssen.
Gemeinden und Kreise können Insolvenzgläubiger, Massegläubiger aber auch Schuldner in einem Insolvenzverfahren sein. Nicht selten müssen sie sich als Anfechtungsgegner mit den verschiedensten Problemen der Insolvenzanfechtung und deren rechtlichen Folgen befassen. Zuweilen sind sie sogar veranlasst, selbst einen Insolvenzantrag gegen einen Schuldner der Gemeinde zu stellen, wobei nicht auszuschließen ist, dass dieser Schuldner ein ausländisches Unternehmen oder die Niederlassung eines ausländischen Schuldners ist.
Die Vorschriften der Insolvenzordnung und der Europäischen Insolvenzverordnung gelten gleichermaßen für Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise). Daher wird in den Erläuterungen der Gemeindeverband „Kreis“ nicht gesondert erwähnt.
1.Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens
1.1Die insolvenzunfähige Gemeinde
Die Insolvenzordnung bestimmt in § 12 Abs. 1 Nr. 2, dass ein Insolvenzverfahren „unzulässig ist … über das Vermögen einer juristischen Person des öffentlichen Rechtes, die der Aufsicht eines Landes untersteht, wenn das Landesrecht dies bestimmt“.
Grundsätzlich sind alle juristischen Personen, auch solche des öffentlichen Rechtes, insolvenzfähig in dem Sinne, dass über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet werden kann (§ 11 Abs. 1 InsO). Denn die juristischen Personen des öffentlichen Rechtes verfügen über ein rechtlich verselbständigtes, haftungsrechtlich abgesondertes Vermögen. Auch schließen ihre öffentlich-rechtlichen Aufgaben die Durchführung eines Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen nicht zwingend aus. Zwar ergeben sich im Vollstreckungsrecht Einschränkungen aus dem Fiskusprivileg (§ 882a ZPO). In Sachen, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben einer Gemeinde unentbehrlich sind, oder deren Veräußerung ein öffentliches Interesse entgegensteht, ist nach § 882a Abs. 2 ZPO eine Zwangsvollstreckung unzulässig. Bei extensiver Auslegung kommt diese Bestimmung faktisch einer Insolvenzsperre nahe.
Die grundsätzliche Insolvenzfähigkeit juristischer Personen durchbricht § 12 Abs. 1 Nr. 2 InsO durch die Ermächtigung der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände von der Zulässigkeit eines Insolvenzverfahrens auszuschließen. Mit dieser Regelung will der Gesetzgeber die Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Organe und ihrer Handlungskompetenzen auch in finanziellen Krisen sicherstellen, zumal ein Insolvenzverfahren kaum geeignet sein dürfte, in einer finanziellen Krisenzeit die Amtspflichten einer Gemeinde zu erfüllen (vgl. zur Rechtslage in Österreich: Jaufer/Mayrhuber, ZInsO 2017 S. 1926 ff.). Dies schließt allerdings keineswegs aus, dass Bund, Länder und Gemeinden insolvenzreif sein können, so dass lange Zeit der sogenannte „Staatsbankrott“ als selbstverständlicher Weg für den Staat galt, sich seiner Schuldenlast zu entledigen (so Hirte in Uhlenbruck, InsO, § 12 Rdnr. 2 unter Hinweis auf Adam Smith, Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations [1775], 5. Buch, 3. Kapitel; Kratzmann, Der Staatsbankrott, JZ 1982 S. 319 ff.; Heinz, Der Zugriff auf privates Eigentum bei staatlicher Insolvenz, VR 2011 S. 293 ff.; Bruch, Staatsbankrott als Rechtsfrage, DZWiR 2011 S. 233 ff.; Herdegen, Der Staatsbankrott: Probleme eines Insolvenzverfahrens und der Umschuldung bei Staatsanleihen, WM 2011 S. 913 ff.; Bews, Staatsbankrott als Rechtsfragen, NVwZ 2011 S. 987 ff.; Hornfischer/Skauradszun, Von der Staateninsolvenz zur Insolvenzfähigkeit von Staaten, KTS 2012 S. 1 ff.; Bischoff, Völkerrechtlicher Rechtsschutz bei Staatsbankrott?, WM 2012 S. 1371 ff.; Paulus, Jüngste Entwicklungen im Resolvenzrecht, WM 2013 S. 489 ff.).
Eine der Rechtsnorm des § 12 Abs. 1 Nr. 2 InsO entsprechende Vorschrift fehlte in der Konkursordnung (KO). Aber auch vor Inkrafttreten der Insolvenzordnung ergab sich die Konkursunfähigkeit von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus landesrechtlichen Regelungen. Auf der Grundlage des Art. IV EGÄndGKO, der auf § 15 Nr. 3 EGZPO verweist, ist in der Rechtsprechung und Lehre überwiegend die Auffassung vertreten worden, das Landesrecht könne die Konkursfähigkeit von Gemeinden und Gemeindeverbänden als öffentlich-rechtliche Körperschaften ausschließen. Bereits vor dem 1.1.1999 konnte mithin durch Landesrecht für Gemeinden die Unzulässigkeit eines Konkursverfahrens bestimmt werden. § 12 Abs. 1 Nr. 2 InsO hat die bisherige Rechtsauffassung nunmehr inhaltlich in die Insolvenzordnung aufgenommen.
1.1.1Landesrechtliche Regelungen
Die Gemeinden und Kreise betreffenden landesrechtlichen Regelungen gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 InsO enthalten die folgenden Landesgesetze:
Baden-Württemberg § 45 AGGVG; Bayern Art. 77 Abs. 3 GO, Art. 71 Abs. 3 LKO; Brandenburg § 129 Abs. 2 GO, § 67 Abs. 2 LKO; Hessen § 146 Abs. 2 HGO, § 54 Abs. 1 HKO; Mecklenburg-Vorpommern § 62 Abs. 2 KomVerf, § 120 Abs. 1 KomVerf; Niedersachsen § 136 Abs. 2 NGO, § 68 Abs. 2 NLO, Nordrhein-Westfalen § 125 Abs. 2 GO, § 57 Abs. 3 KrO; Rheinland-Pfalz § 8a AGZPO-KO-ZVG; Saarland § 138 Abs. 2 KSVG, § 192 KSVG; Sachsen § 122 Abs. 4 GO, § 65 Abs. 2 LkrO; Sachsen-Anhalt § 1 G über die Gesamtvollstreckungsunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechtes, die der Aufsicht des Landes unterstehen; Schleswig-Holstein § 131 Abs. 2 GO, § 17 Abs. 2 KrO; Thüringen § 69 Abs. 3 ThürKO, § 114 ThürKO.
Für die Bundesländer Berlin, Bremen und Hamburg gilt § 12 Abs. 1 Nr. 1 InsO unmittelbar.
Nach dem Willen des Gesetzgebers soll der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes alleine mit staats- und verwaltungsrechtlichen Mitteln begegnet werden (vgl. BVerfGE 60, 135, 155 f.; 65, 359, 375 f.; Kuhn/Uhlenbruck, KO, § 213 Rdnr. 2c). Im Übrigen sind die landesrechtlichen Vorschriften zu berücksichtigen:
–Baden-Württembergisches Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 16.7.1998 GBl. 1998 S. 436, zuletzt geändert durch Art. 61 der Verordnung vom 25.1.2012 (GBl. S. 65, 72)
–Bayerisches Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze vom 8.12.2006, GVBl. 2006 S. 942, zuletzt geändert durch Art. 17a Abs. 13 des Gesetzes vom 13.12.2016 (GVBl. S. 335)
–Berliner Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 6.7.1998, GVBl. 1998 S. 196, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2009, GVBl. 2009 S. 674, 679
–Brandenburgisches Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 26.11.1998, GVBl. I 1998 S. 218
–Bremisches Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 24.11.1998, GVBl. 1998 S. 305, zuletzt geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 2.8.2016 (Brem.GBl. S. 434)
–Hamburgisches Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung vom 8.7.1998, GVBl. 1998 S. 105, zuletzt geändert durch Gesetz vom 1.9.2005, GVBl. 2005 S. 377, 380
–Hessisches Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung vom 18.5.1998, GVBl. I 1998 S. 278, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 5.10.2017 (GVBl. S. 294)
–Mecklenburg-Vorpommerisches Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 17.11.1999, GVOBl. 1999 S. 611, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.3.2002, GVOBl. 2002 S. 154, 168
–Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 17.12.1998, GBl. 1998 S. 710, zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 436)
–Nordrhein-Westfälisches Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 23.6.1998, GVBl. 1998 S. 435, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009, GVBl. 2009 S. 863, 868
–Rheinland-Pfälzisches Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 22.12.2008, GVBl. 2008 S. 314
–Saarländisches Gesetz über die Anerkennung von geeigneten Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren vom 24.6.1998, ABl. 1998 S. 518, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.2.2006, ABl. 2006 S. 474, 530
–Sächsisches Ausführungsgesetz zu § 305 Insolvenzordnung vom 10.12.1998, GVBl. 1998 S. 662, zuletzt geändert durch Art. 47 des Gesetzes vom 27.1.2012 (SächsGVBl. S. 130)
–Sachsen-Anhaltinisches Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung vom 17.11.1998, GVBl. 1998 S. 461, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 13.8.2014 (GVBl. LSA S. 396, 397)
–Schleswig-Holsteinisches Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 11.12.1998, GVBl. 1998 S. 370, zuletzt geändert durch Gesetz vom 9.2.2005, GVBl. 2005 S. 134; letzte berücksichtigte Änderung: Ressortbezeichnungen ersetzt (Art. 9 LVO vom 16.3.2015, GVOBl. S. 96)
–Thüringer Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.2.2006, GVBl. 2006 S. 44
Auf die sonstigen Besonderheiten kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Dies betrifft z. B. Universitäten (vgl. Marz, (Kein) Geld vom Staat? – Zur Frage der Zahlungsunfähigkeit staatlicher Universitäten, NWVBL 2011 S. 201 ff.), Kammern, Zweckverbände, Handwerksinnungen und Kreishandwerkerschaften (vgl. dazu Zimmer in NWB Kommentar zum Insolvenzrecht, § 12 Rdnr. 7; Schmittmann/Theurich/Brune, § 2 Rdnr. 19 ff.).
1.1.2Kommunale Eigengesellschaften und Eigenbetriebe
Für das Vermögen kommunaler Eigengesellschaften, die in der Form von juristischen Personen des Privatrechtes (z. B. GmbH) geführt werden, ist, selbst wenn sie im Alleinanteilsbesitz einer kommunalen Gebietskörperschaft stehen, ein Insolvenzverfahren nicht ausgeschlossen. Auch der Gesetzgeber geht von der Insolvenzfähigkeit solcher Eigengesellschaften aus (vgl. Kropf, Insolvenzunfähigkeit der Gemeinden und Kommunalkreditgeschäft im Lichte von Basel III, ZInsO 2012 S. 1667, 1668). Dieses Thema hat in der jüngsten Zeit erhebliche Relevanz erlangt (vgl. Katz, Zukunft der Stadtwerke – Insolvenz als Alternative für kommunale Unternehmen?, Der Gemeindehaushalt 2014 S. 245 ff.), nachdem z. B. das Amtsgericht Gera (Beschl. vom 1.10.2014 – 8 IN 340/14 –) über das Vermögen der Stadtwerke Gera AG das Insolvenzverfahren eröffnet und einen Insolvenzverwalter bestellt hat. Weiterhin hat das Amtsgericht Gera (Beschl. vom 1.10.2014 – 8 IN 359/14 –) über das Vermögen der Geraer Verkehrsbetrieb GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Hinblick auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen muss mit weiteren Insolvenzen von kommunalen