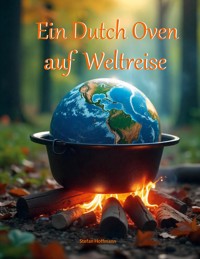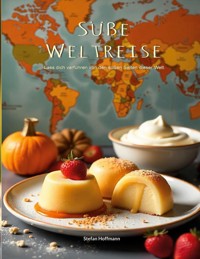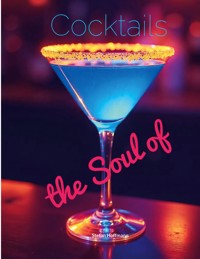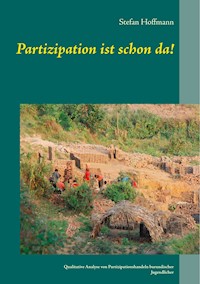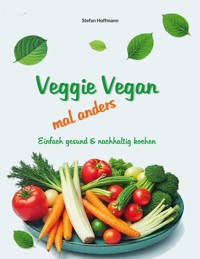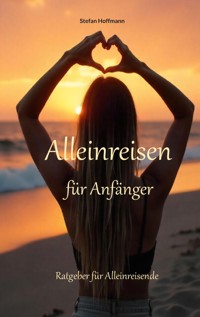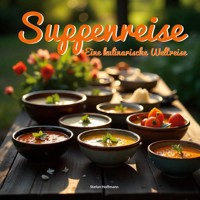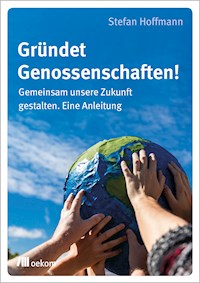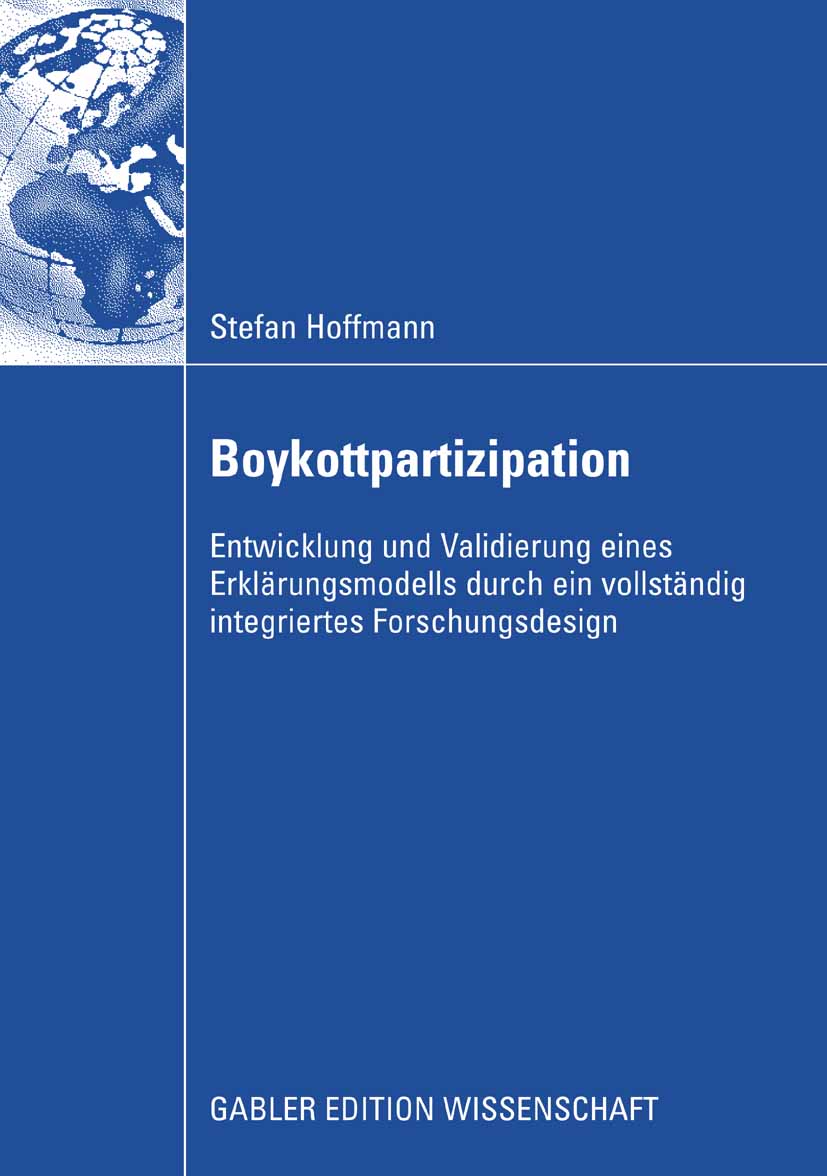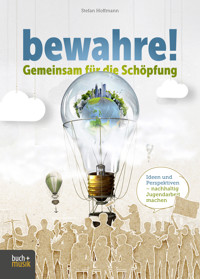
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Praxisverlag buch+musik bm gGmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch macht Mut, nachhaltiges Handeln in der Jugendarbeit als gemeinsames Ziel zu entdecken. Schöpfung, Gemeinschaft, Demokratie, Gerechtigkeit und Zukunft gehen alle an! Dabei sind Autor Stefan Hoffmann zwei Dinge besonders wichtig: # Nicht nur Einzelperson, sondern auch Gruppen innerhalb der christlichen Jugendarbeit sollten gemeinsam nachhaltig handeln. # Es lohnt sich, anzufangen, kleine Schritte zu gehen und zu schauen, was sich verändert. Teil A räumt mit typischen Ausreden auf, die vom Anfangen abhalten. Beispiele aus der ganzen Welt liefern Ideen, wie sich Einzelpersonen und Gruppen für ihre Umwelt und Mitmenschen einsetzen. Das bietet Perspektiven, anzufangen und etwas auszuprobieren! Teil B fordert heraus, die eigene Positionierung zum Thema zu reflektieren und von ihr aus ins Handeln zu kommen: Was bedeutet es, nachhaltig zu leben? Was hilft persönlich und was als Gruppe, nachhaltig zu handeln? Jetzt gilt es, ganz konkret aktiv zu werden! Teil C liefert vertiefende Hintergründe und hilfreiche Einblicke rund um das Thema Nachhaltigkeit. Ein Mut machendes und aktivierendes Buch für alle, die wissen wollen, wie sie gemeinsam mit anderen ihr Umfeld und ihre Jugendarbeit nachhaltig machen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Hoffmann
bewahre! Gemeinsam für die Schöpfung
Ideen und Perspektiven – nachhaltig Jugendarbeit machen
Praxisverlag buch+musik bm gGmbH
In unseren Veröffentlichungen bemühen wir uns, die Inhalte so zu formulieren, dass sie allen Menschen gerecht werden, dass sich alle Geschlechter angesprochen fühlen, wo alle gemeint sind, oder dass ein Geschlecht spezifisch genannt wird. Nicht immer gelingt dies auf eine Weise, dass der Text gut lesbar und leicht verständlich bleibt. In diesen Fällen geben wir der Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes den Vorrang. Dies ist ausdrücklich keine Benachteiligung einzelner Geschlechter.
Für in diesem Titel enthaltene Links auf Websites/Webangebote Dritter übernehmen wir keine Haftung, da wir uns deren Inhalt nicht zu eigen machen, sondern sie lediglich Verweise auf den Inhalt darstellen. Die Verweise beziehen sich auf den Inhalt zum Zeitpunkt des letzten Zugriffs: 18.02.2025.
Dieser Titel erscheint in Zusammenarbeit mit dem EJW-Weltdienst. Weitere Infos unter www.ejw-weltdienst.de
Die Herstellung dieser Arbeitshilfe wurde gefördert aus Mitteln des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS).
Impressum
© 1. Auflage 2025 Praxisverlag buch+musik bm gGmbH 2025 Haeberlinstraße 1–3, 70563 Stuttgart, [email protected] All rights reserved.
ISBN Buch 978-3-86687-403-9 ISBN E-Book 978-3-86687-404-6
Lektorat: buch+musik – Dorothea Zarbock, Gießen Umschlaggestaltung: buch+musik – Toby Wolf, Stuttgart Satz: buch+musik, Stuttgart – unter Verwendung von parsX, pagina GmbH, Tübingen Bildrechte Umschlag und Inhalt: stock.adobe.com: Sergey Nivens, Kwangmoozaa, Pixel Perfect, Eky Epsa, Md Hasan, Budypiasa, Andreas, Ascreator, Pixel Pine, Pro Silhouettes, adidesigner23, 32 pixels Bildrechte Autorenfoto: Julian Meinhardt, Stuttgart
www.praxisverlag-bm.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Navigator durch bewahre!
Einstieg – Von Gurus und schlechten Gewissen
Teil A: Nachhaltigkeit einfach mal machen
Es wird viel diskutiert
Jetzt wird gemacht
Teil B: Nachhaltigkeit konkret überlegt
Jetzt wird reflektiert
Jetzt aber los
Teil C: Nachhaltigkeit durchgedacht
Jetzt wird es klarer
Anhang
Literatur
Der Autor
Vorwort
Ich bin Stefan sehr dankbar für dieses Buch. Das Thema Nachhaltigkeit scheint politisch gerade kaum noch Aufmerksamkeit zu bekommen – und doch ist es eine der entscheidenden Fragen unserer Zeit. Gerade in der Jugendarbeit, in unseren Gruppen und Verbänden stellt sich immer wieder die Frage: Wie gestalten wir unsere Zukunft, wie leben wir unseren Glauben so, dass er Haltung bestärkt und auch zum Handeln befähigt.
Dieses Buch gibt darauf viele Antworten. Es zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Konzept ist, sondern eine Haltung, die im Kleinen beginnt und im Miteinander lebendig wird. Die zahlreichen Beispiele aus der Jugendarbeit und von Initiativen weltweit machen Mut und laden ein, sich selbst auf den Weg zu machen.
Was dieses Buch besonders macht: Es ist kein klassischer Nachhaltigkeitsratgeber, der nur praktische Tipps liefert oder Problemanalysen wiederholt. Vielmehr stellt es uns als Akteurinnen und Akteure in den Mittelpunkt – mit all unseren Herausforderungen. Denn die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit ist selten geradlinig: Wir sind mal motiviert, mal frustriert, gelegentlich überfordert und oft in Dilemmata gefangen. Stefan spricht das sehr ehrlich und offen an. Er zeigt, wie man mit diesen Spannungen umgehen kann – nicht perfekt, aber in der Gewissheit, dass auch kleine Schritte wichtige Lernfortschritte sein können.
Das Buch macht deutlich, dass Nachhaltigkeit neben der politischen und großen Strategien auch uns persönlich betrifft – wie wir leben, wie wir als Gemeinschaft handeln und wie wir mit der Schöpfung umgehen. Dieses Buch hilft, den Blick zu weiten und setzt uns in eine veränderte Beziehung mit der Schöpfung und dem Schöpfer.
Besonders wertvoll ist, dass Stefan auch internationale Perspektiven ergänzt – etwas, das in Praxisbüchern oft zu kurz kommt. Die weltweiten Einblicke zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance ist, voneinander zu lernen und gemeinsam zu handeln.
In all der Komplexität erinnert uns dieses Buch daran, dass unser Handeln einen Unterschied macht – im Vertrauen darauf, dass Gott mit uns an einer gerechteren und bewahrten Welt arbeitet.
Viel Freude beim Lesen – und viel Mut für alle kleinen und großen Schritte der Veränderung!
Gerhard Wiebe, Referent CVJM weltweit, CVJM Deutschland
Navigator durch bewahre!
Bücher über Nachhaltigkeit gibt es schon viele. Dieses hier füllt trotzdem eine wichtige Lücke. Es hilft dir und euch, nicht nur als Einzelperson, sondern auch als Gruppe (zum Beispiel eurer Jugendgruppe) gemeinsam nachhaltig unterwegs zu sein.
Es wird deutlich: Nachhaltigkeit geht auch ohne Druck, schlechtes Gewissen oder Überforderung. Nachhaltigkeit kann sogar auch Spaß machen. Gleichzeitig weitet dieses Buch die Perspektive. Denn Nachhaltigkeit ist so viel mehr als Umweltschutz, und sie beschäftigt auch nicht nur Leute hier im deutschsprachigen Raum, sondern weltweit.
Dieses Buch ist in drei Teile aufgeteilt. In Teil A beschäftigen wir uns kurz mit ein paar Ausreden, die uns davon abhalten könnten, aktiv zu werden, und dann wird es ziemlich schnell praktisch. Denn es folgt eine ganze Reihe an Beispielen, wie sich Einzelpersonen und vor allem auch Gruppen für ihre Umwelt und ihre Mitmenschen einsetzen. Hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Die Beispiele zeigen: das wichtigste ist, einfach mal anzufangen.
In Teil B treten wir mitten aus der Aktion nochmal einen Schritt zurück und verschaffen uns einen Überblick: Was heißt es eigentlich für uns als Christinnen und Christen, nachhaltig zu leben? Und was hilft uns, um angesichts der vielen Baustellen nicht bald wieder frustriert aufzugeben? Warum eignen sich vor allem Gruppen, um eine nachhaltige Aktion zu starten?
In Teil C wird noch mehr vertieft. Hier gibt es Hintergründe und weitere hilfreiche Einblicke in die Thematik.
Diese drei Teile können am Stück und in dieser Reihenfolge gelesen werden, aber sie können je nach Bedarf auch getauscht werden. Wer sich also zuerst mit der Theorie beschäftigen möchte, die/der kann problemlos mit Teil C anfangen.
Überall im Buch verteilt finden sich Absätze in grauer Schrift:
einfach informieren:Hier findet ihr einen Link zu einer Website mit weiteren Informationen.
einfach mitmachen:Das heißt, es gibt eine kleine Übung, die euch hilft, ein bestimmtes Thema direkt anzuwenden.
einfach weiterdenken:Hier gibt es ein paar Fragen, über die ihr allein nachdenken oder in der Gruppe diskutieren könnt.
Einstieg – Von Gurus und schlechten Gewissen
Warum braucht es ein weiteres Buch zur Nachhaltigkeit? Warum noch mal Papier bedrucken, noch mal meine Zeit investieren und Freunde und Aktive bitten, Impulse beizutragen? Dieses Buch will mehr als ökologische Nachhaltigkeit transportieren. Ich will auch nicht die Spaßbremse sein, die ständig zu weniger Konsum aufruft. Und am allerwenigsten will ich noch mehr Personen ein schlechtes Gewissen machen, das sie lähmt.
Durch ehrliches Nachdenken will ich denen, die ohnehin schon aktiv sind, neue Impulse aus einem (internationalen) Hintergrund geben und diejenigen begeistern, die sich nach verschiedenen Erfahrungen sagen: „Es bringt nix.“ Oder „Ich bin müde.“ Und vor allem möchte ich deutlich machen, dass wir nur im Zusammenspiel mit anderen ein gutes Zusammenleben gestalten können.
Der Aufbau des Buches ist so gehalten, dass jeder Teil einzeln gelesen werden kann. Aber wie in der Nachhaltigkeitsdiskussion entsteht das ganze inspirierende Bild erst, wenn alles zusammenkommt und sich einzelne Elemente ineinanderfügen. Der Grundimpuls in jedem Teil ist, dass Engagement nicht nur Sinn macht, sondern in Gruppen wesentlich leichter und motivierender ist, und dass es vor allem um eins geht: legt los! Jetzt! Fangt mit einem kleinen Schritt an, aber geht ihn.
Warum tue ich mir das an, in einem unüberschaubaren Thema noch einen weiteren Aspekt aufzugreifen und was Internationales dazusetzen? Mehr als 15 Jahre habe ich mich in der internationalen Jugend- und Entwicklungszusammenarbeit einbringen dürfen. Mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern habe ich dabei vieles lernen und dann auch bewegen dürfen – für und mit jungen Menschen, Gemeinden und Communities. Die Erfahrungen dieser Zeit fließen an verschiedenen Stellen in dieses Buch ein. Die internationalen Perspektiven weiten den (Nachhaltigkeits-)Horizont und unterstreichen Einflüsse und Auswirkungen eines (Nicht-)Engagements. Es wird deutlich, dass wir uns gegenseitig inspirieren können und alle an ihrer Stelle etwas bewegen können!
Zu guter Letzt: Ich persönlich leide und freue ich mich an eigenen Nachhaltigkeitserfahrungen, die in diesem Buch immer wieder durchscheinen. Ich bin kein Nachaltigkeitsheiliger, Öko-Guru oder vegane Bio Wurst-Missionar. Sondern ich merke, dass mein reflektiertes Verhalten in meiner Familie, meinem CVJM, meinem Arbeitsplatz und meinem Leben Veränderungen bewirken. Kleine Veränderungen. Und ich freue mich, dass mir Radfahren, Obst-Sammeln oder Energiesparthemen dazu noch Spaß machen – also packen wir es an!
Euer Stefan Hoffmann
Es wird viel diskutiert
In diesem ersten Kapitel werdet ihr gleich merken, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiger Lebensstil und die Frage, wie wir zusammenleben wollen, an Menschen hängt. An ihren Haltungen, Einstellungen und Fragen. Und somit hängt das Thema auch an dir und mir. Es hängt an euren und meinen Fragen, unserem Suchen und unseren Überzeugungen. Und das ist gut so. Denn nur, wenn ihr überzeugt seid, seid ihr auch am Start. Dass ihr aber nun manchmal zweifelt und mit anderen Überzeugungen nicht zurechtkommt, ist völlig normal. Ich wundere mich manchmal auch, wie andere denken und sich von Argumenten anderer leiten lassen. Daher will ich mit euch im ersten Kapitel zum einen bei ein paar Argumenten genauer hinschauen und dann eure und meine Überzeugung für eine andere Welt anschauen. Neugierig geworden?
Wenn nur die anderen besser wären!
Ich sitze in einem Seminar und wir diskutieren über Nachhaltigkeit, ihre Auswirkungen, wie wir nachhaltig sein können und dabei Dilemmata (vgl. „Ich will eine andere Welt! Dilemmata und Utopie“) aushalten können. Am Ende steht eine rund 40-jährige Teilnehmerin auf und sagt genervt: „Wir mussten uns als Kinder das Badewasser teilen. Wir hatten kalte Zimmer, es gab oft nur das, was wir auf dem Feld anbauen konnten. Meine Kinder sagen mir, dass wir viel mehr Geld hätten, wenn wir in Bitcoin investieren würden. Und in all dem soll es auf meine Einstellungen und Entscheidungen ankommen? Bei den vielen Entscheidungen zur Nachhaltigkeit kann ich mir gefühlt alles schönreden und begründen. Das ist alles echt relativ. Und dann frag ich mich ehrlich, was das hier überhaupt bringen soll. Wenn andere in China oder sonst wo in der Welt sich gar nicht dranhalten und das, was ich verbessere, von anderen kaputt gemacht wird oder genutzt wird, um noch mehr produzieren zu können. Die ganze Diskussion hier ist scheinheilig und bringt nichts.“ Dann nahm sie frustriert ihre Sachen und ging.
Im Grund konnte ich zu allem, was sie gesagt hat, Ja sagen und dass ich sie und ihre Situation verstehe – denn in vielen Fragen fühl ich mich genauso hilflos und suche nach Orientierung. Dennoch muss ich ein: „Ja genau, ABER“ einfügen. Denn zu vielen Aussagen und Kritiken an einem nachhaltigen Lebensstil gibt es eben auch andere Aspekte. Vier dieser Aussagen möchte ich näher anschauen:
„Es bringt nichts, nachhaltig zu leben!“
Jean Philippe Kindler schreibt in seinem bemerkenswerten Buch zu Selbstliebe einen fatalen Satz zur Wirksamkeit individuellen Handelns, der mich lange beschäftigt hat: „Es ist aber viel eher so, dass wir als Privatpersonen uns noch so tugendhaft und klimafreundlich verhalten können, der Planet geht an anderen zugrunde.“[1] Zu der Zahl, dass „die hundert größten Konzerne für 70% des ausgestoßenen CO2 verantwortlich sind“[2] kann man nur sagen: er hat Recht. Aber wenn 50% aller in Deutschland lebenden Menschen ihr (Konsum- und Freiheits-) Verhalten ändern, wird das auch Auswirkungen auf die zehn größten Konzerne haben – wenn dazu noch 50% aller anderen Europäer sich anschließen, werden Konzerne gar nicht mehr umhinkommen, etwas zu tun. Also ist einer der wichtigen Schritte zur nachhaltigen Veränderung der, dass viele sich individuell ändern.
Die Folgen so eines kollektiven Wandels waren während der Corona-Zeit zu spüren. Insgesamt ist laut verschiedener Studien während des Corona-Jahres 2020 durch die wenigen Reisen und Produktionsrückgänge die CO2-Emission global um rund 7% zurück gegangen. Leider hat dieser Rückgang langfristig keine Auswirkungen, weil die Nachfolgejahre den Effekt verpuffen lassen haben. Aber immerhin: der Effekt individueller Handlung (v.a. wenn sie von vielen geleistet wird) ist belegbar – es kommt sehr wohl auf die individuelle Ebene an! Und in Bündelung mit kollektiven Maßnahmen wird sie deutlich sehr spürbar. Dabei ist nicht zu vergessen, Einfluss auf das System zu nehmen. Und zu prüfen, was im Einzelfall wichtiger ist: Überspitzt gesagt gilt es abzuwägen, ob ich einen individuellen Umweg von 68 Minuten mache, um eine Gurke zu retten oder diese 68 Minuten in die Organisation einer Demonstration für gelungenere Fahrradwege in meiner Stadt investiere.[3]
„Die anderen machen das kaputt, was ich an CO2 spare“
In einem ländlichen Teil Burundis hatten wir die Möglichkeit, eine Ausbildungsstelle zu bauen. Die Kirche hatte ein Gelände bekommen, wir konnten Finanzen aus verschiedenen Töpfen zusammenführen und gingen nach einer kurzen Bauzeit mit einem Curriculum an den Start. Auf Grund der Stromversorgung und der damals sehr teuren IT-Ausstattung bildeten wir dort Menschen in Sekretariatsarbeiten aus – inklusive Schreibmaschinenkurs. In den Dörfern hatten Menschen, die mit einer Schreibmaschine Briefe oder Dokumente schreiben konnten, immer wieder Aufträge – in sogenannten Schreibstuben.
Nach drei Jahren mussten wir die Ausbildung mit rund dreißig ausgebildeten jungen Menschen aufhören. Unsere Pläne, dass sie in verschiedenen Ämtern, Schreibstuben oder Büros anschließend eine Beschäftigung bekamen, konnten aus verschiedensten Gründen nicht umgesetzt werden. Viele Faktoren lagen außerhalb unseres Einflusses: fehlende Parteizugehörigkeit, nicht vorankommende Elektrifizierung oder zu wenig finanzielle Kooperation mit anderen Institutionen. Eine Reaktion, die mir als Projektverantwortlichem oft begegnete, waren die Fragen: „Hat sich das alles denn gelohnt? So viel Geld und Zeit zu investieren?“ Sicher gab es Punkte im Projektdesign usw. zu verbessern – aber der Punkt, um den es hier geht, ist, dass wir über drei Jahre hinweg, dreißig junge Menschen prägen konnten und ihnen Zugang zu Bildung, dem Arbeitsmarkt und sinnhafter Gemeinschaft geben konnten. Lohnt sich das?
Mir fällt dieses Beispiel ein, wenn es darum geht, ob sich ein Engagement auch schon für einen kurzen Effekt lohnt. Und v.a. auch wenn es Gefahr läuft, zu stoppen oder „kaputt gemacht zu werden“ wie es die oben erwähnte Frau in Bezug auf ihre nachhaltigen Veränderungen fühlte.
Eine Erfahrung, die wir immer wieder machen – beim Sandburgenbauen am Meer, beim Aufstellen von Steinmännchen, Abstellen von Fahrrädern an Bahnhöfen, Suchmeldungen für eine vermisste Katze – ist: das bewusste oder unbewusste Tun von anderen – sei es Natur, Mensch oder einfach Schicksal – zerstört unsere Hoffnung und unser Tun. Gutes, das wir tun, kommt nicht an, findet ein Ende oder wird von anderen kaputt gemacht. So what? Die Alternative, nichts zu tun, nichts zu ändern und sich nicht auf den Weg zu machen und ggf. aus Fehlern zu lernen, bringt, egal in welchem Bereich, nichts anderes als Stillstand und Verharren und nimmt die Chance zur Veränderung. Daher ist Martin Luthers dickköpfige Haltung („Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“) mir in diesen Fragen ein Vorbild.
Neben dieser Tatsache, deren Akzeptanz ein wichtiger Bestandteil von unserem Leben ist, gilt es hier einen anderen Blickwinkel einzunehmen:
WIR machen es kaputt!
Vielen anderen wird weltweit durch unser Wirtschaften, unsere Mobilität oder kurz gesagt unserem Lebensstil das Leben kaputt gemacht. Es geht also gar nicht darum, dass die individuellen Effekte meines nachhaltigeren Lebensstiles durch Wirtschaften in anderen Ländern relativiert oder überholt wird. Sondern im Gegenteil: durch unser unachtsames Tun, zerstören wir die Lebensgrundlage von anderen. Dies wird in vielen Statistiken sehr deutlich.
„Die anderen machen ja auch nichts“
Wir sitzen mit Freunden beim Frühstück und unterhalten uns über alles Mögliche. Weil ich nicht anders kann, lenke ich das Gespräch auf das Thema Nachhaltigkeit. Ein Jugendlicher sagt dann Folgendes: „In meinem Umfeld wird das alles kritisch gesehen. Nicht mal, dass bei dem Thema ne‘ Ideologie dahinter steht, sondern, dass man es auch nicht vorgelebt bekommt. Zum Beispiel, wenn Baerbock Kurzflüge zu einem Fußballspiel macht[4] – wieso soll ich mich dann einschränken und vor allem durch die steigenden CO2-Abgaben noch mehr für den Diesel bezahlen? Wir wohnen im ländlichen Raum und sind hier nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln mobil.“ Letzteres stimmt – ich habe es einmal nachgeschaut, zu diesen Freunden mit Bus und Bahn zu kommen, das war selbst mir als widerstands- und leidensfähigem Bahn-Masochisten zu viel. Aber das Argument „so lange Baerbock solche Flüge macht“ kann ich dann doch nicht stehen lassen. Mir ist es zwar völlig unverständlich, dass eine grüne Außenministerin sich so einem Diktat unterwirft und ihr Amt so gestaltet. Und es ist richtig, dieses anzuprangern.
Aber Jammern und auf andere zu zeigen, hilft nichts. Vielleicht finden wir in Frau Baerbock kein Vorbild, vielleicht finden wir bei vielen anderen Menschen kein nachhaltiges Verhalten. Aber muss ich mich daran ausrichten? Ich richte mein Handeln und Denken an denen aus, die etwas tun – und davon gibt es einige (vgl. „Mach mal – Gruppenbeispiele aus Deutschland“ ff.). Die Menschen, die für ihre Überzeugungen leiden und sich einsetzen, sind meine Vorbilder. Sie inspirieren mich für mein Tun und Lassen und helfen mir, meine Ziele im Blick zu behalten. Also schlicht die Frage an euch: Wer darf euch beeinflussen? Sind es tatsächlich die Nichts-Tuer und Viel-Schwätzer? Oder Menschen wie Gina oder Kemo, die du bald noch kennenlernen wirst (vgl. Kap. 1.5.)?
„Ich kann mir alles schönreden“
Auch dieses Argument stimmt erst mal auf den ersten Blick. In Fragen der Abwägung und Entscheidung mit so vielen unterschiedlichen Komponenten kann ich mir alles schönreden. Sei es der Kauf der Ananas, der Flug oder anderes nicht-nachhaltiges Verhalten. In diesem Buch unterstütze ich nicht den Ansatz des großen und radikalen Wurfes, dass wir alles sofort radikal ändern müssen (der in vielen Aspekten viel klarer und einsichtiger ist), sondern verfolge eine Strategie und Umsetzung der vielen kleinen Schritte an vielen kleinen Orten. Und diese Schritte sind nicht nur angreifbar („Was bringt‘s?“), sondern auch relativ („Du isst jetzt schon ein Jahr vegetarisch und fliegst jetzt zum Junggesellenabschied nach Irland! Das ist doch inkonsequent!“).
Das ist nichts Neues: Wie viele Neujahrsvorsätze, Vorhaben zum Abnehmen, feste Pläne regelmäßig Sport zu machen oder Zocken und Handynutzung zu reduzieren werden jedes Jahr nicht eingehalten. Und dann kann der Vorwurf kommen, dass man sich alles schönreden kann oder willkürlich ist. Genau das ist es und deshalb betone ich auch in diesem Buch, dass es besser in eine relationale Ebene kommt, also in einer Beziehungsebene gestaltet wird. Wenn ich mit anderen zusammen unterwegs bin und nachhaltig leben will, dann geht es nicht nur um ein kollektives Gewissen und Rechtfertigung, sondern eben auch um ehrliches Feedback und Nachfragen: „Könnt ihr nicht noch ein paar Tage dran hängen und eine Strecke mit dem Zug machen?“ „Kannst du mir nochmal erklären, wie du das mit der CO2-Kompensation meinst und machst?“
Damit steht das eigene Handeln nicht in der Kritik, sondern in einem Aushandlungs- und Lernprozess, der durch Freunde oder Mitstreiterinnen begleitet wird. Und der ist allemal besser, als nichts zu ändern oder als eine Position, die einfach ein „weiter so“ lebt und vor den Widersprüchen kapituliert. Denn Widersprüche gehören zu Nachhaltigkeit wie der Winter zum Sommer.
Tipp zum Weiterlesen:Wer vertieft wissenschaftliche Aussagen und Datenbewertungen zur Widerlegung von Argumenten gegen ein nachhaltiges Leben sucht, dem empfehle ich das Buch: Klima Bullshit Bingo[5]
Ich will eine andere Welt! Dilemmata und Utopie
Ein zentrales Thema im Umgang mit Herausforderungen der Nachhaltigkeit ist der Umgang mit Widersprüchen, also Dilemmata. Wir werden immer wieder vor Entscheidungen stehen, deren Tragweite wir nicht verstehen und deren Tiefe wir nicht erfassen können. Dazu kommen dann noch Aspekte, die sich widersprechen oder die wir nicht abschließend klären können – und schon gar nicht schnell und einfach. Wir treffen auf Fragen, die wir nicht beeinflussen können, die aber trotzdem eine Rolle spielen.
Ich möchte so ein Nachhaltigkeitsdilemma an zwei Beispielen deutlich machen, die uns im Alltag begegen können.
Es ist vielen klar: im Winter Erdbeeren aus Marokko im deutschen Supermarkt zu kaufen, entspricht keinem Schema einer nachhaltigen Ernährung. Also klar, dass es klimaschädlich ist, diese Erdbeeren zu kaufen. Das Dilemma fängt dann an, wenn Tomaten, die im Sommer in meinem Bundesland angebaut sind, teurer sind als solche, die aus Holland angekarrt werden und dabei noch roter aussehen.
Das zweite Dilemma-Beispiel: Ein Kleid hängt bei C&A und besitzt kein Label in puncto Baumwolle, Herstellung oder weiteren Nachhaltigkeitsaspekten. Ein anderes Kleid aus dem Secondhand-Markt passt zwar, aber ist in der Farbgebung so kreativ, dass ich es als Käuferin zwar aushalte, aber so richtig gefällt es mir nicht. Das sind Dilemmata, in denen ich mich befinde, wenn ich beginne nachhaltig zu leben und zu handeln.
„Als Dilemma, auch Zwickmühle, wird die Zwangslage einer Person bezeichnet, die sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden muss, die gleichermaßen schwierig sowie unangenehm sind. Demnach ist das Dilemma stets eine Situation, die zwar mehrere Auswege bietet, von denen allerdings keiner zum gewünschten Resultat führt. Weiterhin kann die Wahl zwischen zwei positiven Dingen als Dilemma bezeichnet werden.“[6]
Letztlich stehen nachhaltige Kaufentscheidungen immer in einer Spannung (vgl. Abschnitt „Triangulation von Nachhaltigkeit“), die abgewogen werden müssen und die dadurch in ein Dilemma führen können. Aber die gute Nachricht ist: unklare Entscheidungslagen (und Dilemmata) sind nicht nur ein Phänomen der Nachhaltigkeit, sondern sind ein Zeichen unserer Welt.
Deshalb können wir viel darüber lernen und Nachlesen (beispielsweise in Managementforen) und sind nicht allein. Das Wichtigste dabei aber ist, sich nicht vom dem Dilemma lähmen zu lassen, sondern sich irgendwann zu entscheiden. Dabei können folgende Punkte und Aspekte hilfreich sein:
Gültigkeit der Entscheidung einschränkenDie Entscheidung muss keine Allgemeingültigkeit besitzen, sondern kann auch temporär oder einmalig sein. (Dieses Mal die Lieblingsschokolade kaufen, die von Nestle kommt, im Wissen, dass die nächsten vier Tafeln dann im Weltladen gekauft werden.)
Komplexität reduzierenEs müssen nicht immer alle denkbaren Werte oder Aspekte in Betracht gezogen werden. Vielleicht ist es bei dieser Entscheidung der soziale Aspekt und bei der nächsten der ökologische. (Der soziale Aspekt überwiegt die Autofahrt zur Party an einem abgelegenen Ort, der keine Busanbindung hat.) – Es können auch verschiedene Werte nach Wichtigkeit geordnet werden (Achtung: Werte sind relativ!) und dann der höchste Wert bevorzugt werden.
Nutzen abwägenÜberlegen, welche Entscheidung den größeren Nutzen bringt oder den geringeren Schaden anrichtet.
Das Gesamtbild in den Blick nehmenEs hilft auch, Entscheidung in einen größeren Zusammenhang zu stellen bzw. die eigene Utopie einer besseren/anderen Welt anzulegen, oder eben Gott zu fragen, was seine Sicht auf die Dinge ist.
Gerade der letzte Punkt der Utopie ist dabei für mich persönlich elementar. Ich stelle mir immer wieder ein gutes Leben vor, das für mich und alle anderen möglich ist, und kann dann mein Handeln danach ausrichten. Trägt eine Entscheidung zu diesem besseren Leben bei oder nicht?
Was ist denn eine Utopie?
Eine Utopie ist erst mal nicht so utopisch, wie es sich anhört. Denn Utopie bedeutet erst einmal, ein Bild eines besseren Heute oder gar einer idealen Welt zu erträumen – und zwar aus meiner Perspektive. In den meisten Fällen (wenn du nicht die berühmte einsame Insel wählst, die ohnehin nach ein paar Tagen langweilig wird), kommen da auch andere Menschen vor und daher drücken Utopien immer auch das Zusammenleben mit anderen aus.
In Übungen, die ich mit verschiedenen Kursen und Altersstufen gemacht habe, zeichnen die meisten eine ideale Welt als „eine friedliche Welt“. Wer nun eine friedliche Welt als sein Traum einer besseren Zukunft sieht, richtet auch sein Handeln danach aus und wird nicht gleich seinem Nachbarn eins auf die Mütze geben. Denn Utopien sind Ideale, die ich erreichen will und für die ich mich einsetze. Und das bestenfalls nicht allein sondern mit anderen.