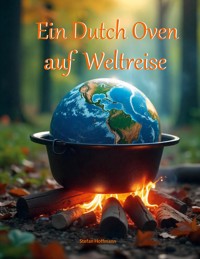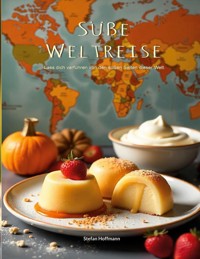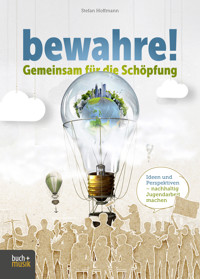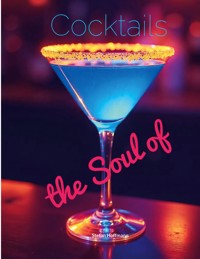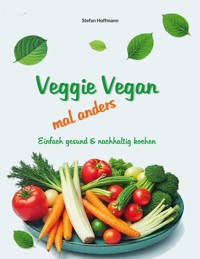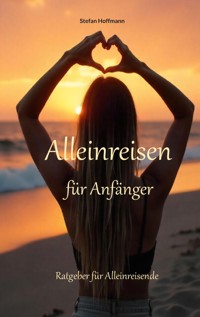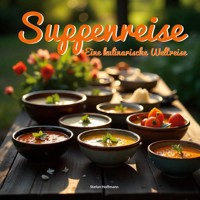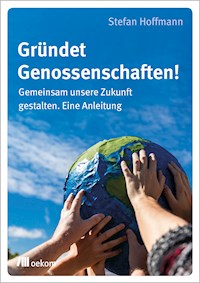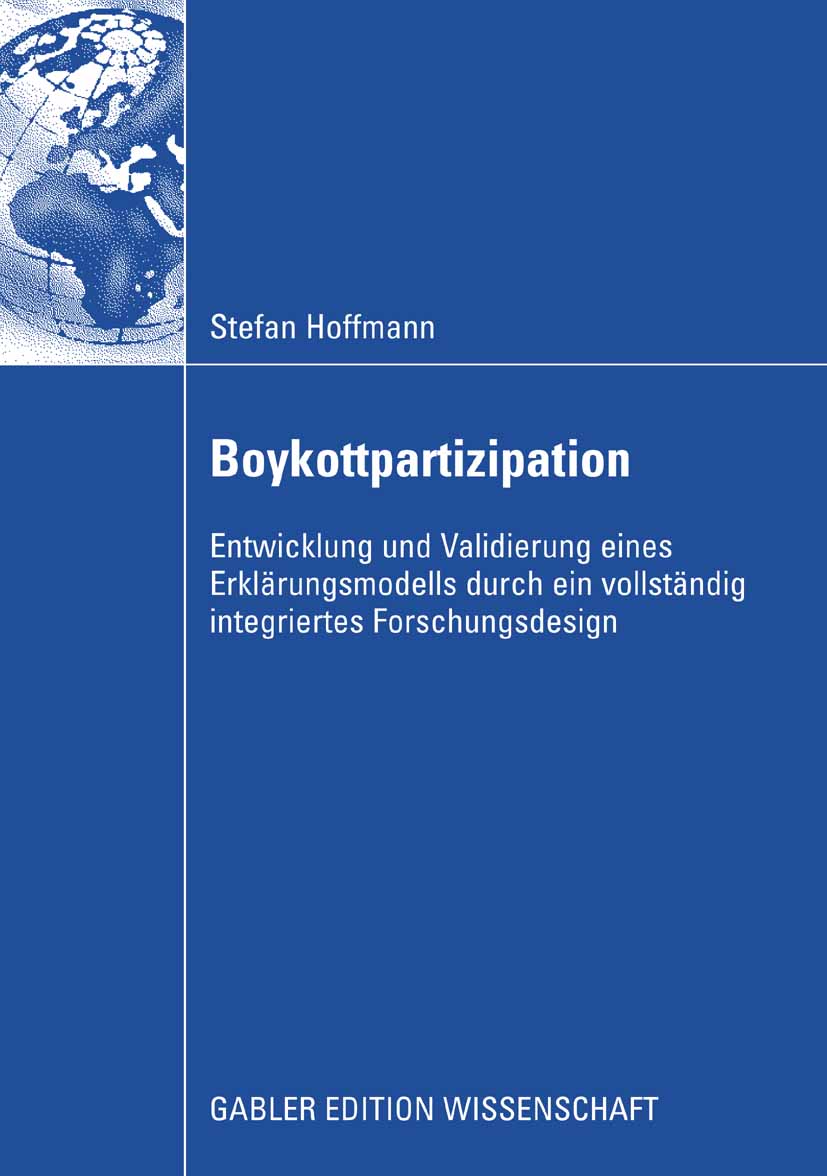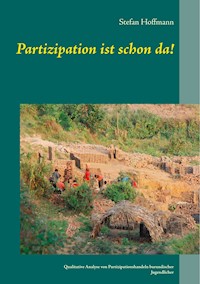
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch ist die Dissertationsschrift von Stefan Hoffmann zur Partizipation Jugendlicher in Burundi. In dieser Abhandlung wird die Frage verfolgt, wie Jugendliche in dem ostafrikanischen Land sich unter Bedingungen der politischen Instabilität und unter kulturellen und hierarchischen Rahmensetzungen beteiligen. Hoffmann rekonstuiert ein sehr strategisches Partizipationsverhalten und bietet dadurch Impulse für eine sozialarbeiterische Praxis und weitere Forschungsarbeit in diesem Bereich. Ein Buch das für PraktikerInnen genauso gewinnbringend ist wie für StudentInnen und Lehrende, die sich mit der Grounded Theory und Jugendarbeitsforschung auseinandersetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Mein Dank gilt denen, die mich während des Prozesses begleitet, ermutigt und gestärkt haben: Neben Michael May, der mit Hingabe diese Arbeit auch über längere Distanzen begleitet hat, natürlich meiner Familie, der Liebenzeller Mission und der Anglikanischen Kirche, Diözese Bujumbura.
Dank auch an all diejenigen, die mir Ihre Häuser, Wohnungen und Studienzimmer zur Verfügung gestellt haben, so dass während des normalen Familienalltags ein Promotionsalltag möglich wurde!
Und natürlich ein großes „Urakoze Cane!“ an die Mitarbeitenden und Jugendlichen von BAHO und der AR, die sich bereit erklärt haben aus ihrem burundischen Alltag offen und ehrlich zu erzählen!
Dissertationsschrift
zur Erlangung des akademischen Grades
Doktor phil.
Eingereicht am gemeinsamen Promotionszentrum Sozialer Arbeit der Hochschule RheinMain, Hochschule Fulda und der Frankfurt University of Applied Sciences
Betreuung der Arbeit:
Prof. Dr. habil. Michael May
Erstgutachten:
Prof. Dr. habil. Monika Alisch
Zweitgutachten:
Prof. Dr. habil. Martina Ritter
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einleitung
Burundi – der Kontext der Arbeit
2.1. Sozio-geographischer Hintergrund
2.1.1. Das Land – ein datenbasiertes Portrait
2.1.2. Hutu, Tutsi und Twa
2.2. Situation der Jugend in Burundi
2.2.1. Jugend auf dem Land und in der Stadt
2.2.2. Jugend und Bildung
2.2.3. Jugend und kulturelle Identität
2.2.4. Jugend und Gewalt
2.2.5. Jugend und Politik
2.3. Wirtschaftliche Situation Burundis
2.4. Geschichte Burundis
2.4.1. Monarchie und Kolonialzeit
2.4.2. Die junge Republik
2.4.3. Burundis jüngste Geschichte und ihre Herausforderungen
2.5. Politik und Demokratie
2.5.1. Parteipolitik
2.5.2. Demokratie- und Staatsverständnis in Burundi
2.5.3. Situation der Menschenrechte
Forschen in fremdem kulturellem Kontext
3.1. Postkoloniale Fragen
3.1.1. Zum Verständnis des Postkolonialismus
3.1.2. Postkolonialismus und Kosmopolismus
3.1.3. Postkolonialismus und die vorliegende Arbeit
3.2. Rollenfragen
3.2.1. Der Forscher aus dem Globalen Norden
3.2.2. Der Projektberater aus dem Globalen Norden
3.2.3. Rollenkonflikte im Rahmen der Forschung
Partizipation
4.1. Partizipationsbegriff und Partizipationsmodelle
4.2. Kinder- und Jugendpartizipation im deutschen Kontext
4.2.1. Modelle von Kinder- und Jugendpartizipation
4.2.2. Kinder- und Jugendpartizipation aus Sicht der Partizipierenden
4.2.3. Begründung von Kinder- und Jugendpartizipation
4.3. Kinder- und Jugendpartizipation im afrikanischen Kontext
4.3.1. Rahmenbedingungen in Afrika für Kinder- und Jugendpartizipation
4.3.1.1. Demokratietheoretische Rahmenbedingungen
4.3.1.2. Dienstleistungstheoretische Rahmenbedingungen Sozialstaat in Afrika
Rolle der Zivilgesellschaft in Bezug auf den afrikanischen Kontext
Der Zivilgesellschaftsbegriff von Habermas in Burundi
4.3.1.3. Pädagogische Rahmenbedingungen
4.3.2. Wirtschaftliche Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Afrika
4.3.3. Kinder- und Jugendpartizipation in Burundi
Die etymologische Herleitung und Verwendung des Begriffs „Partizipation“ auf Kirundi
Bestandsaufnahme organisational motivierter Kinder- und Jugendpartizipation
4.4. Pädagogisch-theoretische Verortung von Partizipation.
4.4.1. Macht und Partizipation
Zugänge zum Begriff „Macht“
Macht und Partizipation – eine dynamische Annäherung
4.4.2. Empowerment, Partizipation und Armut
4.4.2.1. Friedmanns Empowerment Ansatz
4.4.2.2. Freires Pädagogik der Befreiung
4.4.3. Sozialpädagogisch-konzeptionelle Verortung
Forschungsarbeit
5.1. Das Forschungsinteresse
5.2. Forschungsdesign
5.2.1. Forschung als responsive Evaluation
5.2.2. Die Auswahl der Samplings
5.2.3. Die Diskussionsteilnehmenden im Detail
5.2.4. Kontrastierung der beiden beforschten Projekte
5.2.5. Datenerhebung
5.2.5.1. Der zeitliche Rahmen - Begrenzungen der Forschung
5.2.5.2. Der chronologische Ablauf
5.2.5.3. Gruppendiskussion als Mittel der Datengewinnung
5.2.6. Dokumentation der Gruppeninterviews
5.3. Auswerten mit Grounded Theory – theoretische Verortung
5.3.1. Grundelement 1: Theoretisches Vorwissen/ theoretische Sensibilität
5.3.2. Grundelement 2: Theoretisches Sampling und Zirkularität
5.3.3. Grundelement 3: Theoretische Sättigung
5.3.4. Grundelement 4: Kodieren
Die Erkenntnisetappen
6.1. Erste Auswertungsphase – Bujumbura
6.1.1. Die Feedback Runden
6.2. Zweite Auswertungsphase – Deutschland
6.2.1. Das offene Kodieren
6.2.1.1. Erste Kategorie: Angst vor Partizipation
6.2.1.2. Zweite Kategorie: Partizipation in burundischer Demokratie
6.2.1.3. Dritte Kategorie: Macht und Partizipation
6.2.1.4. Vierte Kategorie: Zukunft durch Partizipation
6.2.1.5. Fünfte Kategorie: Mut zur Partizipation
6.2.1.6. Sechste Kategorie: Bildung
6.2.2. Das axiale Kodieren
6.2.2.1. Siebte Kategorie: Strategien der Jugendlichen, um zu partizipieren
6.2.2.2. Das axiale Kodieren – theoretische Bezüge
6.2.2.3. Das axiale Kodieren – die Typenbildung
Strategietyp: Offizielle Auftritte
Strategietyp: Gefahr vermeiden
Strategietyp: Berg nicht alleine heben
Strategietyp: Zukunft gestalten
6.2.3. Sozialtypische Analyse des Datenmaterials
6.2.3.1. Typik Alter und Herkunft
6.2.3.2. Positionstypik
6.2.3.3. Geschlechtstypik
6.3. Strategische Jugendpartizipation in Burundi – erste Bündelung der Ergebnisse
6.4. Strategische Hypothesen
Erkenntnisse
7.1. Güte der vorgelegten wissenschaftlichen Arbeit
7.2. Eigene Lernreise
7.2.1. Praktiken der Selbstreflexion
7.2.2. Partizipationsverständnis
7.3. Weiterführendes Arbeiten mit den Ergebnissen
7.3.1. Anregungen für die sozialarbeiterische Praxis
7.3.2. Anregungen für Forschungsvorhaben
7.4. Abschlußbemerkung
Literaturangaben
Abbildungsverzeichnis1
Abbildung 1: Partizipationsmodell von Rajani nach Adams 2008: 72
Abbildung 2: Lebensraum eines Haushalts und die vier Bereiche sozialer Praxis,
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Methoden im Forschungsprozess
Abbildung 4: Chronologischer Ablauf der Forschung und Auswertung
Abbildung 5: „Iterativer“ Forschungsprozess in Abwandlung von
Abbildung 6: Darstellung der Kategorien und Konzepte von Jugendpartizipation in Burundi
Abbildung 7: Kodierparadigma nach Strauss 1991, entnommen aus Mey/ Mruck: 2011: 40
Abbildung 8: Dimensionen der Kategorie „Strategien Jugendlicher, um zu partizipieren“
Abbildung 9: Gruppenbildung als eine mögliche Reaktion auf Probleme
Abbildung 10: Vier Ebenen des Gruppenhandelns
Abbildung 11: Interessensebenen der verschiedenen Gruppenhandlungen
Abbildung 12: Schematische Darstellung der Problemreaktion Jugendlicher nach Lefebvreschen Gesichtspunkten
Abbildung 13: Abgewandeltes Kodierparadigma nach Strauss/ Corbin 1996
1 Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Abbildungen vom Autor selbst geschaffen (eigene Darstellung)
Tabellenverzeichnis2
Tabelle 1: Auszug aus dem Bevölkerungsbericht von 2008 (République du Burundi 2008: 44)
Tabelle 2: Gegenüberstellung von Interessen bei Partizipationsprozessen nach White 1996: 7
Tabelle 3: Übersicht über die Teilnehmenden der Diskussionen nach Anzahl, Alter und Geschlecht
Tabelle 4: Zeitplan der Datenerhebungen
Tabelle 5: Beispielhafter Ausschnitt aus der Themen- und Bezugsmatrix der Auswertung der ersten vier Gruppendiskussionen
Tabelle 6: Aufstellung der Themen für die ortsbezogenen Feedback Runden
Tabelle 7: Interessensrekonstruktion der Handlung Sand schaufeln
Tabelle 8: Interessensrekonstruktion Travaux communautaire
Tabelle 9: Interessensrekonstruktion Trommelauftritte
Tabelle 10: Interessensrekonstruktion Gottesdienstgestaltung
Tabelle 11: Interessensrekonstruktion Sitzungsteilnahme
Tabelle 12: Interessensrekonstruktion Nicht-Teilnahme an Sitzungen
Tabelle 13: Handlungsbezogene Interessens- und Problemübersicht Strategietyp „offizielle Auftritte“
Tabelle 14: Interessensrekonstruktion Einsatz des Clubpräsidenten
Tabelle 15: Interessensrekonstruktion der Handlung Aufklärung
Tabelle 16: Handlungsbezogene Interessens- und Problemübersicht Strategietyp „Gefahr vermeiden"
Tabelle 17: Interessensrekonstruktion Unterstützergewinnung...
Tabelle 18: Interessensrekonstruktion Gegenseitig helfen
Tabelle 19: Handlungsbezogene Interessens- und Problemübersicht Strategietyp „Berge nicht allein heben"
Tabelle 20: Interessensrekonstruktion Zivilgesellschaft nutzen
Tabelle 21: Interessensrekonstruktion Arbeit durch Kooperativen
Tabelle 22: Handlungsbezogene Interessens- und Problemübersicht Strategietyp „Zukunft gestalten"
Tabelle 23: Darstellung der Diskussionsgruppen nach Lebenssituation, Bildung, Alter
Tabelle 24: Auswertung der Redeanteile nach der Herkunft der DiskussionsteilnehmerInnen
Tabelle 25: Auswertung der Redeanteile nach Inhalt bezogen auf die Herkunft
Tabelle 26: Auswertung der Redeanteile nach Alter und Inhalt
Tabelle 27: Aufstellung der Positionen der DiskussionsteilnehmerInnen in den Vereinen
Tabelle 28: Darstellung der Redebeiträge bezüglich der Positionen der TeilnehmerInnen
Tabelle 29: Darstellung der Inhalte bezüglich der Positionen der TeilnehmerInnen
Tabelle 30: Darstellung der Geschlechterverteilung in den Diskussionsgruppen (F= Frau, M= Mann)
Tabelle 31: Darstellung der Redezeiten der Frauen in den Diskussionen
Tabelle 32: Darstellung der Redebeiträge der Frauen in den Diskussionen nach gesprächsanalytischen Gesichtspunkten
2 Sofern nicht anders vermerkt, wurden alle Tabellen vom Autor selbst geschaffen (eigene Darstellung)
1. Einleitung
Burundi wirbt für sich selbst mit dem Titel „The beating heart of Africa“ (NTOB 2011: 1). Der dort angesprochene „beat“ hat zum einen mit einem schlagenden Herzen als Zeichen von Lebendigkeit zu tun, bezieht sich zum anderen aber auf die heiligen Trommeln, die eine lange Tradition haben und auch heute bei Festen im Land nicht wegzudenken sind. Burundi ist ein beeindruckendes, grünes Land, das durch seine Fruchtbarkeit und die Fröhlichkeit seiner Menschen besticht. Ich3 habe mit meiner Familie selbst in diesem „schlagenden Herzen Afrikas“ für fünf Jahre gelebt. Die vorliegende Arbeit ist ein Element meiner Forschungsarbeit in Ostafrika. In ihr werden viele Aspekte genannt, die zu einem problemzentrierten Blick führen könnten. Dies ist nicht die Absicht dieser Arbeit – im Gegenteil. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen und können Jugendlichen und jungen Menschen helfen, ihr Beteiligungshandeln kreativer zu gestalten, um ihnen somit mehr Möglichkeiten zu eröffnen.
Während des fünfjährigen Arbeitsaufenthaltes im ostafrikanischen Burundi führte ein Handlungsforschungsprojekt zu einer Masterarbeit und nun zu vorliegender Dissertation. Die Grundfrage, wie Jugendliche zu beteiligen sind, war eine Frage aus meiner Arbeitspraxis, die in der Theorie Orientierung suchte und forschend erweitert wurde. Ich arbeitete als Sozialarbeiter fünf Jahre in einem Kinder- und Jugendprojekt der kirchlichen Entwicklungszuammenarbeit in einer Kooperation zwischen der Diözese Bujumbura und der Liebenzeller Mission. Das Projekt wird detailliert in Kapitel 5.2.2. vorgestellt, es hat die Unterstützung der Lebensgestaltung von Waisen und Halbwaisen im Fokus.
Eines der Ergebnisse meiner Handlungsforschung in diesem Projekt war, dass burundische Jugendliche sich Beteiligungs- und Austauschplattformen wünschen. Dieser erste forschende Schritt wurde im Jahr 2008 mit 149 Kindern im Rahmen einer Zukunftswerkstatt zu den Lebensbereichen Schule, Freizeit und Familie durchgeführt. Im Rahmen der nachfolgenden Masterarbeit wurden 2010 praktisch forschend Handlungsoptionen mit Jugendlichen und BetreuerInnen4 erarbeitet, die zur Gründung von Jugendclubs führten. Hierbei spielte ein aneignungsorientierter partizipativer Ansatz eine Rolle. In der Umsetzung dieser Maßnahme und zum Ende meines Arbeitsaufenthaltes in Burundi stellte ich mir immer mehr die Frage, wie Partizipation von den Jugendlichen wahrgenommen wird, und ob es Unterschiede in einem fremdinitiierten Partizipationsprojekt (also dem Projekt, in dem mein burundisches Team und ich zusammengearbeitet haben) und einem eigeninitiierten Partizipationsprojekt (wo Jugendliche selbst aktiv wurden) gab. Auch die Sicht der Erwachsenen auf die umgesetzten Beteiligungsprozesse weckte mein Interesse und formte sich zu einer evaluierenden, komparativen Sozialforschung. Somit wurde zu Beginn der Ansatz der responsiven Evaluation gewählt, in welchem Gruppendiskussionen mit Jugendlichen und Erwachsenen im Fokus standen, deren Ergebnisse den Diskutanten nach einer ersten Auswertung wieder zur Diskussion gestellt wurden, um sie zu validieren, wissenssoziologisch zu verorten und die Ergebnisse fruchtbar zu machen. Erst nach der Rückkehr nach Deutschland wurde das Material dann einer weiteren Analyse mit der Methode der Grounded Theory unterzogen, um tiefere Erkenntnisse zu gewinnen. Hierbei wurde neben einer methodologischen Frage, nämlich der Frage nach einem an den Untersuchungsgegenstand angepassten Kodierparadigma, das Partizipationshandeln an sich wichtig und formte sich im Prozess zu einer Typisierung von Partizipationsprozessen. Diese Typisierung bildete sich zum einen am Grad der Formalität des Handelns heraus und zum anderen an den Interessen der Gruppen, mit denen sie auf Probleme reagierten. Somit konnten vier Strategietypen aus dem Material rekonstruiert und abgebildet werden und in Bezug zu Sozialtypiken gesetzt werden.
Das Forschungsinteresse, das mich leitete, bestand darin, Erfahrungen und Wirkungen von Partizipationsprozessen vergleichend zu evaluieren und daraus neue Erkenntnisse für die Beteiligung von Jugendlichen in Burundi zu gewinnen. Diese Erkenntnisse sollen wieder zurück in die Praxis der Sozialarbeit und der Lebenswelt der Jugendlichen selbst führen. Die daraus abgeleitete Forschungsfrage war: wie beurteilen Jugendliche in Burundi Partizipationsprozesse? Und wie werden diese Prozesse von an ihnen beteiligten Erwachsenen beurteilt?
Ich entschied mich für ein qualitativ ausgerichtetes Forschungsdesign, in dem mit Gruppendiskussionen eine responsive Evaluation in Anlehnung an die dokumentarische Evaluationsforschung mit Jugendlichen und Erwachsenen in zwei verschiedenen Partizipationsprojekten durchgeführt wurde. Eines war Teil meiner Arbeit, das andere war mir bekannt. Nach der Rückkehr aus Burundi wurde der so gewonnene Datenkorpus einer vertieften Analyse in Anlehnung an die Grounded Theory unterzogen, um das sich abzeichnende „implizite Erfahrungswissen“ (May 2010a: 310) der Jugendlichen in Bezug zu partizipationsbedingenden Faktoren zu setzen. Die Grounded Theory wurde auf Grund ihrer prozesshaften Anlage und durch das Aufbrechen des Materials durch Kodieren als rekonstruktive Methode gewählt.
Um die Gedankengänge, Entscheidungen und Prozesse während des Forschungsprozesses transparent zu machen, ist die Arbeit wie folgt aufgebaut:
Nach der Einleitung im ersten Kapitel der Dissertation wird im zweiten Kapitel die Geschichte sowie die wirtschaftliche und politische Situation in Burundi skizziert. In den Ausführungen wird die Situation der burundischen Jugend besonders beleuchtet, um dem LeserIn den Kontext der Forschungsarbeit näher zu bringen.
Da ich in diesen Kontext – das Land Burundi – eingetaucht bin, setzte ich mich im dritten Kapitel vor dem Hintergrund der Diskurse um Postkolonialismus und Kosmopolismus mit meiner Rolle als Forschender in fremdem kulturellem Kontext auseinander. Die in diesem Zusammenhang aufkommenden erkenntnistheoretischen Fragen werden in diesem Kapitel mit einer wissenssoziologischen Positionierung in Anlehnung an Mannheim beantwortet.
Nach dieser Positionsbestimmung und -reflektion als Forscher setzt sich das vierte Kapitel mit dem zentralen Begriff dieser Arbeit auseinander – mit dem Begriff der Partizipation. Hier wird zum einen der Forschungsstand zu Jugendpartizipation im Allgemeinen und zum anderen von Jugendpartizipation in Afrika und in Burundi dargestellt und erörtert. Darüber hinaus werden die in Europa entwickelten demokratie- und dienstleistungstheoretischen Begründungen und Konzepte von Zivilgesellschaft und Partizipation in ein Spannungsverhältnis mit der afrikanischen Situation gesetzt. Daran schließt sich eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Begriffen von Macht an, die in der Ausarbeitung von fünf Kristallisationspunkten von Partizipation endet. Abschließend werden armuts- und unterdrückungsumfassende Theorien von Freire und Friedmann ins Verhältnis zur Frage der Partizipation und des Empowerment gesetzt, um sie dann in ihrer Bedeutung für die Soziale Arbeit zu diskutieren.
Nach diesen Grundlegungen folgt ab dem fünften Kapitel der empirische Teil der Arbeit. Hierin werden zuerst das Forschungsdesign und meine Rolle in Bezug zu den beforschten Projekten dargestellt und reflektiert. Des Weiteren wird die Methode der Grounded Theory in ihrer auf den vorliegenden Fall angepassten und übertragenen Form erläutert.
Im sechsten Kapitel wird detailliert der Umgang mit dem gewonnenen Datenmaterial beschrieben. Im Schritt des offenen Kodierens werden sieben unterschiedliche Kategorien rekonstruiert. Es wird dargestellt, wie die siebte Kategorie „Strategien der Jugendlichen, um zu partizipieren“ im Prozess des axialen Kodierens auf komparatistische Weise in vier unterschiedliche Strategietypen ausdifferenziert wird. Hierbei wird in Anlehnung an die Arbeiten von Henri Lefebvre und dessen relationalen Kategorien von Problem und Interesse ein eigenes Kodierparadigma entwickelt. Die Interessen werden hierbei in formelle und informelle unterschieden. In weiterer Umsetzung der Arbeit Lefebvres werden abschließend strategische Hypothesen formuliert, die die gewonnenen Erkenntnisse zurück in die Praxis führen können.
Zuvor wird jedoch eine Reflektion der rekonstruierten Strategietypen in Bezug zu folgenden sozialtypischen Aspekten geleistet: Alter und Herkunft, Position und Geschlecht. Hierbei werden die Redebeiträge der TeilnehmerInnen anhand von Dauer und Inhalt analysiert.
Im abschließenden siebten Kapitel werden die gewonnen Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Anwendung in der Forschungs- und Sozialarbeitspraxis gegeben.
3 Da es in dieser Arbeit oft um meine Rollen als Forscher und Projektmitarbeiter geht, wird in der Arbeit vom forschenden Subjekt als „ich“ gesprochen, statt einer distanziert neutralen Formulierung wie „Autor“.
4 Es wird im Sinne einer lesbaren gendersensiblen Formulierung das Binnen-I verwandt. Im Text wird der Artikel ungesetzmäßig alterniert, also der LeserIn oder die LeserIn verwandt anstatt der/ die LeserIn. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, werden geschlechtsneutrale Formulierungen bevorzugt.
2. Burundi – der Kontext der Arbeit
Um den Kontext dieser Arbeit zugänglich zu machen, wird in diesem Kapitel die Situation des Landes Burundi dargestellt, da es ein eher unbekanntes afrikanisches Land ist. Die Beschreibungen sind als Situationsbeschreibungen zu verstehen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, aber im Sinne einer Kontextbeschreibung das Thema Jugendpartizipation vor einen sozio-geographischen, historischen, wirtschaftlichen und politischen Hintergrund stellen. Da das Thema „Situation der Jugend“ ein zentrales ist, wird es nicht unter soziogeographischen Aspekten subsumiert, sondern bekommt ein eigenes Kapitel.
2.1. Sozio-geographischer Hintergrund
In diesem Kapitel werden Burundi und seine Menschen unter soziogeographischen Schwerpunkten eingeführt. Zuerst wird das Land knapp anhand von einigen Daten skizziert und danach die ethnische Bevölkerungssituation vorgestellt.
2.1.1. Das Land – ein datenbasiertes Portrait
Burundi liegt am Tanganjika See, der einer der größten und tiefsten Seen der Erde ist. Es ist ein grünes, hügeliges Land, in dessen Hauptstadt Bujumbura rund 10% der Bevölkerung leben. Burundi ist ein Teil der Ostafrikanischen Union bestehend aus Uganda, Tansania, Ruanda und Kenia, wobei es innerhalb dieser Union das einzige Land ist, das noch frankophon ist. Das Land besitzt eine Bevölkerung von 9,8 Millionen Einwohner mit einem Bevölkerungswachstum von 3,2% (Bertelsmann Stiftung 2014: 2)5. Die Lebenserwartung liegt im Jahr 2014 bei 53,1 Jahren und es zählt zu den ärmsten Ländern dieser Welt (Bertelsmann Stiftung 2014: 19).
Burundi hat eine Größe von rund 27.800 km2und gehört zu den am dichtesten bevölkerten Ländern Afrikas (Omara/ Ackson 2010: 6). Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern besitzt Burundi den Vorteil (vgl. Watt 2008: 15), dass nur eine Sprache gesprochen wird – Kirundi. Daneben wird Französisch als Behördensprache gesprochen. Englisch und Suaheli sind weitere Sprachen, die in dem Land angewandt und auch schon früh in der Schule unterrichtet werden.
Die meisten Burundier gehören einer christlichen Religion an, laut Omara/ Ackson rund 67% (Omara/ Ackson 2010: 6). Es gibt keine verlässlichen Mitgliedsdaten von den Kirchen selbst, Statistiken besagen, dass die katholische Kirche mit rund 65% dominiert, die protestantische Kirche rund 30% Anhänger besitzt und die Muslime die nächstgrößere Religionsgemeinschaft stellen (vgl. ISTEEBU 2012: 31). Unter den protestantischen Kirchen hat die Anglikanische Kirche die größte Anhängerschaft, sie ist mit neun Diözesen im ganzen Land vertreten.
Bekannt wurde Burundi unter anderem durch einen Konflikt, der im Nachbarland Ruanda zu trauriger Berühmtheit führte, aber auch in Burundi ein Wesensmerkmal des Zusammenlebens darstellt: nämlich die Auseinandersetzung der beiden vorherrschenden Volksgruppen Hutu und Tutsi.
2.1.2. Hutu, Tutsi und Twa
Sowohl historisch als auch wissenschaftlich ist es höchst umstritten, wie es zu einer Einteilung des burundischen Volkes in die drei Ethnien kam. Ob der Begriff „Ethnien“6 richtig ist, wird vielerorts diskutiert. Der Politikwissenschaftler und Historiker Strizek führt als mögliche Begriffe neben „Rasse“ die Begriffe „Kaste“ und „Klasse“ an, die verschiedentlich gewählt wurden, um das Phänomen der Trennung der Volksgruppen zu beschreiben (vgl. Strizek 1996: 40f). Der Theologe Ndabiseruye, der mir persönlich bekannt ist und selbst bei ethnischen Auseinandersetzungen schwer verletzt wurde, weist unter Problematisierung des Ethnienbegriffs in seiner Dissertationsschrift darauf hin, dass es schwierig ist, „von „Ethnien“ nach der traditionellen7 Definition zu sprechen“ (Ndabiseruye 2009: 69, Hervorhebung im Original). Vielmehr könne es sich auch um soziale Identitäten oder soziale Kategorien handeln, die vor der Kolonialzeit eine Einheit gebildet hätten (ebd.). Aber, so Ndabiseruye weiter, all „diese Aussagen betonen die „Einheit“ der drei Volksgruppen und schieben die Schuld der Spaltung einzig auf die Kolonialverwaltung, als wäre in der Vorkolonialzeit alles heil gewesen“ (ebd., Hervorhebung im Original). Es zeichnen sich zwei Argumentationslinien ab – eine ethnische und eine soziale. Nach der sozialen Argumentation sind die drei Gruppen – vereinfacht dargestellt – ein Volk, in dem es zu Abgrenzungen und Ausprägung von Herrschaftsverhältnissen kam und dies die Trennung mit sich brachte (Strizek 1996: 56f). Die ethnische Argumentation beruht auf der Annahme, dass es Migrationen verschiedener Ausgangsbevölkerungsgruppen gibt, die in der Region aufeinandertreffen. Laut Omara/ Ackson, die im Auftrag des ostafrikanischen Zentrums8 für Verfassungsentwicklung einen Bericht über Burundi verfasst haben, scheint es eine größere Anhängerschaft für die Theorie der sukzessiven Einwanderung zu geben. Zuerst seien die Batwa gekommen, dann im 1. Jahrhundert die Bahutu und am Schluss hätten die Batutsi9 das Land im 15. Jahrhundert besiedelt. Traditionell seien die Twa Töpfer, die Hutu Landwirte und die Tutsi Kuhhirten. Heute gehörten 85% der Burundier den Hutu, 14% den Tutsi und 1% den Twa10 an (vgl. Omara/ Ackson 2010: 16). Egal welcher Entstehungstheorie man anhängt, Fakt ist, dass diese Einteilung des ruandischen und burundischen Volkes in Kombination mit politischen und kolonialistischen Visionen, Manipulationen und Machtinteressen eine blutige Geschichte begründete, die hunderttausenden Menschen das Leben kostete und in den 1990er Jahren die Welt wegen ihrer Brutalität in Atem hielt. Strizek nutzt den Begriff der „politisierten Ethnizität“, um diese Verquickungen auszudrücken (Strizek 1996: 77).11 Deutlich wird, dass diese politisierte Ehnizität Auswirkungen auf Menschenleben hat – sei es durch Verluste in Familien, Flucht oder Trauma und vor allem junge Menschen trifft. Der auch in Burundi forschende Psychologe und Traumaexperte Crombach drückt es so aus: “The psychological consequences of armed conflicts are particularly devastating for children and adolescents.“ (Crombach 2013: 3)
2.2. Situation der Jugend in Burundi
Jugend ist keine leicht zu definierende soziale Kategorie. Selbst wenn man sie nur über die reine Altersdefinition beschreiben will, gibt es unterschiedliche Altersgrenzen, wie ein Definitionspapier der UN zeigt: UN Habitat definiert das Alter von 15-32, das Generalsekretariat von 15-24 Jahren und UNICEF nennt jeden unter 18 Jahren ein Kind (UNDESA: 2). Die Afrikanische Jugend Charter sieht das Alter eines jungen Menschen von 15-35 Jahren (ebd.).
Bevor dies nun vertieft wird, sei angemerkt, dass Burundi ein „junger“ Staat ist, in dem die 0 bis 24-Jährigen mit 66,4% den größten Bevölkerungsanteil stellen, wie in Tabelle 1 deutlich wird:
Alter
Männlich
Weiblich
Total
0-4
17,9
17,9
17,9
5-9
14,2
14,3
14,2
10-14
12,2
12,7
12,5
15-19
11,8
12,5
12,1
20-24
9,3
10,1
9,7
25-29
7,8
7,5
7,6
Tabelle 1: Auszug aus dem Bevölkerungsbericht von 2008 (République du Burundi 2008: 44)
Dadurch, dass nicht nur in Burundi, sondern in Afrika insgesamt (65 % sind laut African Union jünger als 35 Jahre12) junge Menschen einen wichtigen Teil der Bevölkerung stellen, ist es wichtig, zu definieren, was unter „Jugend“ verstanden wird.
Die gängigste Art einer Definition ist die des Alters wie eingangs schon angeführt. Dass es hierbei Unterschiede gibt wurde schon aufgezeigt. Noch deutlicher wird es, wenn man versucht, Jugendbegriffe nicht nur per Alter, sondern normativ oder kulturell voneinander abzugrenzen: in der Problematisierung der Jugend als Forschungsgegenstand beschreibt die Anthropologin Durham, dass Jugend eine relationale und soziale Kategorie und „even posibly a social effect of power“ (Durham 2000: 114) ist. Dabei führt sie aus, wie für den afrikanischen Kontext traditionell verwurzelte Initiationsriten, die den Übergang von Alters- und Gruppenkohorten markierten, „are supplanted by labor migration, schools, or participation in civil wars“ (ebd.). Dieser Wandel traditioneller Aspekte, was Jugend ist, kommt auch in Burundi zum Tragen. Zur Gruppe der Jugendlichen gehört man dort, stark generalisiert gesagt, so lange man nicht verheiratet ist und/ oder eine Arbeit hat (vgl. Berckmoes 2015: 5). Die zu Afrika forschende Anthropologin Berckmoes erweitert dieses Verständnis, indem sie die Kirundi Wörter untersucht, die für Jugend oder junge Menschen gebraucht werden. Es gibt keine direkte Übersetzung des Wortes „Jugend“ in Kirundi, sondern es werden verschiedene Wörter benutzt, wie zum Beispiel “umosore is associated with energy (able-bodied person) and is generally used to describe young men on the verge of adulthood. Umusore can also be used to comment on a person’s strength and vitality irrespective of his age. Unmarried young women are referred to as inkumi. Urwaruka refers to young people more generally it includes children” (a.a.O.: 4f., Hervorhebungen im Original).
Die Definition, wer jugendlich in Burundi ist, setzt sich also unter anderem zusammen aus sozialen Aspekten (Heirat), ökonomischen Aspekten (Arbeit), physischen Aspekten (Energie/ Vitalität) und Lebensalter. Im Kontext dieser Arbeit ist der Aspekt der Abhängigkeit von (erweiterter) Familie, Ernährenden oder Betreuungspersonen zu benennen, da ein Teil der Jugendlichen als Waisen oder Halbwaisen in solchen Abhängigkeitsverhältnissen steht und lebt. Wenn im Zusammenhang der vorliegenden Forschungsarbeit in den Projekten von Jugendlichen gesprochen wird, so sind solche gemeint, die entweder im Projekt, in dem ich arbeitete, beteiligt waren (und von den lokalen Kirchengemeinden identifiziert wurden) oder vom Vorstand als Mitglied im Jugendverein aufgenommen waren – in beiden Fällen wurde also von den Burundiern selbst bestimmt, wer jugendlich bzw. bedürftig ist und somit zu dieser Gruppe zu zählen ist.
In dieser Arbeit wird Jugend als „social being and social becoming“ gesehen, wie die im Auftrag des Nordic Africa Institute forschenden Christiansen/ Utas/ Vingh es näher beschreiben: „Youth is both a social position which is internally and externally shaped and constructed, as well as part of a larger societal and generational process, a state of becoming.“ (Christiansen/ Utas/ Vigh 2006: 11) Im Verweis auf Mannheim weisen die drei Forschenden darauf hin, dass bei sozialen Kategorien „meanings and manifestations arise in relation to specific social processes, cultural understandings and historical influences” (a.a.O.: 10).
Die nun nachfolgenden Aspekte sollen helfen, einige der sozio-kulturellen Gegebenheiten und Umsände für dieses „becoming and being“ der Jugend in Burundi näher darzustellen.
2.2.1. Jugend auf dem Land und in der Stadt
Es kann natürlich keine generalisierte Aussage über diesen Unterschied getroffen werden, da die familiären, wirtschaftlichen oder bildungsbezogenen Situationen der Jugendlichen geographisch variieren. Prinzipiell kann aber durchaus gesagt werden, dass Kinder und Jugendliche in Burundi schon früh zum Einkommen und Gelingen des Familienalltags beitragen müssen – unabhängig, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben. So passen Mädchen ab einem gewissen Alter auf ihre Geschwister auf und helfen im Haushalt mit oder Jungen und Mädchen holen Wasser an Wasserstellen (sowohl Land als auch Stadt). Weitere Aufgaben sind Feuerholz holen, Ziegen und Kühe hüten oder helfen, das Feld zu bestellen (urbane Situation: meist am Stadtrand wo man hinlaufen muss oder im Vorgarten). Somit ist Kinder- und Jugendzeit stark vom gemeinsamen Arbeiten und Überleben bestimmt. Für privilegiertere Kinder und Jugendliche (sowohl in der Stadt als auch auf dem Land) fällt dies weg – sie müssen nicht zur Schule laufen, sondern werden gefahren (Bus/ Auto), die Familie lebt vom Einkommen und weniger von der Subsistenzwirtschaft, daher werden die Felder nur bedingt selbst bestellt. Diese frei gewordene Zeit wird nach eigenen Beobachtungen, wenn die Stromversorgung es zulässt, oft durch Medienkonsum (Konsolen, TV, Smartphone) und verstärkt auch Drogenkonsum gefüllt13.
Je nach Lebensumständen ist aber auch in Burundi die Schere zwischen den Gegebenheiten, wie die Jugend auf dem Land oder in der Stadt ihre Positionen sucht, enorm. Bujumbura gilt als durchaus ruhige und überschaubare Hauptstadt, in der der Zugang zu internationalen Festivals und Aktivitäten, die Chancen auf kreative und innovative Events oder der Zugang zu Ministerien viel einfacher gestaltet werden kann, wie auf dem Land, wo oft schon infrastrukturelle Bedingungen (Strom/ Wasser/ etc.) schwieriger zu gewährleisten sind. Trotz aller Bemühungen seitens der Regierung oder von NGOs diese Distanz aufzuheben, bleibt dieses Gefälle zwischen Stadt und Land erhalten. Dieses Gefälle zeigt sich nicht nur in den Bereichen der Bildung und Infrastruktur, sondern auch in der Gesundheitsversorgung. Sie sind neben wirtschaftlichen und rechtstaatlichen Rahmenbedingungen auch Fokuspunkte der Strategie zur Armutsbekämpfung in Burundi (vgl. IMF 2012).
2.2.2. Jugend und Bildung
Zwar hat die Regierung mit ihrer Machtübernahme in 2005 freie Schulbildung in der primaire (Klasse 1-6)14 umgesetzt, um das Analphabetentum zu senken und den Bildungsstand zu erhöhen. Aber es fehlen nicht nur Schulgebäude, Klassenräume und Lehrkräfte, sondern auch Lehrmaterial und viele Klassen werden von ein und derselben LehrerIn doppelt unterrichtet15 (République du Burundi 2012: 21f). Schulklassen haben laut einer Statistik von 2010 im Durchschnitt 82 SchülerInnen (CRIDIS 2012: 26). Dennoch zeigt die Maßnahme Auswirkungen, wie die Geographin Biele zeigt: „Die Einschulungsrate ist seither von ca. 57 % auf 92 % in 2010 gestiegen, die Alphabetisierungsrate bei Jugendlichen von 53 % 1990 auf 78 % im Jahr 2007“ (Biele 2015: Bildung). Die allgemeine Alphabetisierungsrate lag in Burundi in den Jahren 2009/2010 bei 42,5%.
Schulbildung ist dennoch nicht kostenlos. Familien müssen für Schulhefte, Kugelschreiber etc. rund 7,5 US Dollar pro Jahr pro Kind bezahlen (CRIDIS 2012: 20). Bei Kindern in der weiterführenden Stufe – der secondaire – sind es dann schon rund 20 US Dollar pro Kind pro Jahr (ebd.). Bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 260 US Dollar16 (Destatis 2016) und durchschnittlich – je nachdem welche Statistik man zugrundelegt – zwischen drei 17 (ISTEEBU 2012: 19) und sechs (IMF 2012: 112) Kindern ist das eine enorme Summe des verfügbaren Einkommens, das für Bildung investiert werden muss.
Kritisch ist zu sehen, dass das Ziel der Entwicklung von Bildung und Erziehung ist, wie es im strategischen Plan der Regierung heißt, die Armut im Land zu bekämpfen, indem Humankapital produziert werde, das zum Wachstum beitrage. Dieses wird dann als Gewinn im formellen Bildungssektor gesehen18 (République du Burundi 2012: 15).
Auch die nächsten Bildungswege wie formale Ausbildungen oder Universitätsplätze sind dünn gesät, somit überlaufen und oft völlig unterversorgt (Ausnahme bilden einige Privatuniversitäten, die aber Studiengebühren verlangen und somit nur priviliegierten Studierenden Zugang bieten). Allein schon die Tatsache, dass es im Jahr 2012 nur 3.000 Ausbildungsplätze für Handwerksberufe im Anschluss an die primaire gibt (die aber bis 2020 auf 16.000 angehoben werden sollen, vgl. a.a.O: 28), zeigt, wie schwierig es für Jugendliche ist, berufliche Perspektiven zu entwickeln. Diese Zahl wird umso brisanter, wenn man sich die Bevölkerungsstatistik vor Augen führt (s.o.) und deutlich wird, wie stark dieses Missverhältnis von Angebot und Nachfrage in absoluten Zahlen ist. Ähnliches gilt für die universitäre Ausbildung. Im Jahr 2012 waren es rund 30.000 Studienplätze (davon 57% in privaten Universitäten), die auf 52.000 im Jahr 2020 angehoben werden sollen, mit einem Anteil an Privatuniversitäten von 53% (a.a.O.: 31f.). Hinzu kommt noch, dass für viele StudentInnen die Auswahl des Studiengangs zwar in Präferenzen angegeben werden kann, aber letztlich eine zentrale Vergabestelle über die kostengünstigen Plätze an staatlichen Universitäten entscheidet. Als weiterer Punkt kommt hinzu, dass auch wenn ein junger Mensch nun eine gute Ausbildung absolviert hat, er dadurch allein noch keine Aussicht auf berufliche Perspektive hat, wie im African Econimc Outlook für ganz Afrika beschrieben wird: „For young people, the lack of jobs is the most pressing challenge. Despite their improved education, young Africans still suffer from both poor health and a lack of employable skills, as well as limited access to financial assets to start their own businesses.” (AfDB/OECD/UNDP 2017: 109) Dieser Aspekt spielt im empirischen Teil im Kapitel 6.2.2. „Zukunft gestalten“ eine Rolle.
Neben diesen bildungstechnischen schwierigen Perspektiven spielen noch kulturelle Aspekte eine Rolle, die burundische Jugendliche bei ihrer gesellschaftlichen Positionierung beeinflussen.
2.2.3. Jugend und kulturelle Identität
Der Anthropologe und Experte für Jugend in Kriegs- und Nachkriegsländern Marc Sommers beschreibt sehr eindrücklich wie Jugendliche in Ruanda, dem Nachbarland und „großen Bruder“ Burundis, in ihrer Jugend „feststecken: „Many are stuck, struggeling to become adults but unable to gain acceptance as one. […] They were unable to construct a house, […]“ (Sommers 2012: 194). Diese Situation hatte zur Folge: “There were strikingly high levels of frustration and anxiety affecting nearly all of the male youth the research team interviewed in rural Ruanda” (ebd.).
In Burundi, dessen Sprache, Geschichte und Kultur ja eng verwandt mit den ruandischen Gegebenheiten ist, habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Auf Grund der oben aufgeführten Wirtschafts- und Bildungssituation können viele Jugendliche nicht heiraten. Denn der zu bezahlende Brautpreis (la dotte) ist für viele unerschwinglich. Hinzu kommt noch, dass der Brautpreis steigt, wenn die Braut eine höhere Bildung besitzt, und viele Paare starten hoch verschuldet in ihr neues Ehe- und Familienleben. Daher werden viele Ehen in Burundi derzeit spät geschlossen. Zur kulturellen Identität eines Mannes oder einer Frau gehört aber, dass er oder sie verheiratet ist und – vor allem die Frau – auch Kinder hat.
Diese Beobachtungen werden vom Politologen und Burundi Kenner Uvin in einer Untersuchung bestätigt und deutlich unterstrichen (vgl. Uvin 2009: 123ff.). Eine Folge dieser Situation der späten Heirat sind Landflucht (a.a.O.: 127) und „illegale oder unoffizielle Heirat“ (ebd.). Trotz dieser belastenden Situation halten viele burundische Jugendliche an diesen traditionellen Rollenvorstellungen fest: „Burundians identify with traditional African constructions of masculinity and feminity – at their core, to be a good young woman is to behave morally, to be a hard worker in the home of first her parents and then her husband, and to bear children. To be a good young man is to be financially viable enough to secure a marriage, support one’s family, and provide for one’s parents. And everyone ought to respect their parents and elders” (a.a.O.:142). Dennoch ist ein gesellschaftlicher Wandel festzustellen – beispielsweise werden manche Bräuche gegenseitiger Besuche vor oder nach der Hochzeit durch die Familien des zukünftigen Ehepaars nicht mehr oder abgeschwächt gemacht. Prozesse, die sowohl von den Eltern ausgehen, als auch von den Jugendlichen selbst gestaltet werden.
Somit hat unter anderem die derzeitige wirtschaftliche Situation ein Umdenken und Neudefinieren dieser Rollen erfordert und wird weiterentwickelt. Bei Sommers wurde dabei deutlich (s.o.) und es wird auch bei Uvin thematisiert, dass dies nicht nur zu solch sozial anerkannten Anspassungen führt, sondern auch Probleme mit sich bringt: Junge Männer und Frauen können nicht mehr dem traditionellen, idealen Bild von Mann und Frau entsprechen, was laut Uvin, der sich auf weitere Studien beruft, zu „psychological problems, violence, alcoholism and drug abuse“ (Uvin 2009: 142) führen kann. „It is a common assumption nowadays that part of the popular appeal of participation in civil wars among young men results from the fact that becoming a soldier can give young men the prestige they fail to get through the regular path of marriage, and access to sex they cannot get conventionally.“ (ebd.) Sich zu positionieren und zu werden in traditionellem Sinn ist demnach eine große Herausforderung für burundische Jugendliche.
2.2.4. Jugend und Gewalt
Der im obigen Zitat eingeführten Kausalität Uvins von Soldatentum und Suche nach Erwachsenwerden wird hier nicht gefolgt, aber sie ist eine mögliche Erklärung für den Umgang mit dieser Identitätskrise und Gewalterfahrungen, die im Leben von burundischen Kindern und Jugendlichen eine große Rolle spielen. Crombach, der von psychologischtraumaaufarbeitender Seite Gewalterfahrungen bei Kindern in einer Nachkriegssituation untersucht, beschreibt unter Berufung auf Human Rights Watch und Sommers sehr deutlich, wie Kinder und Jugendliche alltäglicher Gewalt ausgesetzt sind, sei es durch Strafen ihrer Eltern, sei es durch das Fehlen von Essen oder von seiten ihrer peers: „Constant feelings of insecurity arise from lack of food and politically motivated killings. The latter are often committed on a communal level by ordinary people (Human Rights Watch, 2012). In the Burundian culture violence is widely accepted as a means of punishment for thieves or as a means of authority in educational matters. Children risk being punished by beating every day in school, at home or on the streets (Sommers, 2013)” (Cromach 2013: 45). Dass diese Gewalterfahrungen Ängste bei Kindern und Jugendlichen hervorrufen und handlungsleitend sind, wurde schon in meinem Handlungsforschungsprojekt festgestellt: „Verblüffend für uns als Betreuer war, wie hoch die Zahl der Kinder ist, die sich mit Gewalt auseinandersetzen müssen – egal in welchem Lebensbereich, es wurde immer wieder erwähnt. Über Gewalt in der Familie (sich schlagen) berichteten 33,58% der Kinder. In der Schule berichteten 24% von Gewalt, wobei 9,5% körperliche Gewalt durch Lehrer angaben. (In Burundi ist die Prügelstrafe aber offiziell seit 1993 abgeschafft und seit 2005 wird das Verbot durchgesetzt.) In der Freizeit erwähnten 48,5%, dass sie Gewalt ausgesetzt sind und das an ihrem Leben nicht mögen“ (Hoffmann 2008: 16f, Einfügungen im Original). Ein Teil dieser Gewalt wurde auch als sexuelle Gewalt benannt, wobei es hierbei auch eine Vermischung mit ersten sexuellen Erfahrungen gab. In Burundi ist aber geschlechtsbezogene Gewalt ein großes Problem. Laut UNICEF haben 23% der burundischen Frauen und 6% der burundischen Männer sexuelle Gewalt erfahren (Haro 2018). Dieses Problem hält nicht nur schon länger an, sondern ist auch was die Zahlen anbelangt am Steigen (vgl. Ndayisaba 2011) und erschreckend ist, dass 38% der Opfer jünger als 15 Jahre sind (ebd.). Wobei aber nicht nur von UNICEF, sondern auch von den zuständigen Ministerien oder dem Chaire UNESCO vermutet wird, dass die Dunkelziffer, also die Fälle der betroffenen Frauen, die sich nicht äußern, weil sie sich schämen oder von den Aggressoren eingeschüchtert werden, deutlich höher liegt (vgl. Ndayisaba 2011). Gründe für diese Form der Gewalt sind laut dem Direktor der Chaire UNESCO Ndayisaba, dass zum einen traditionelle Schutzmechanismen immer weniger greifen und zum anderen die Politik nicht hart genug durchgreift (vgl. ebd.) und Strafen wie das Heiraten der durch die Tat schwangeren Frau akzeptiert werden. Neben dieser Tatsache, dass nicht genug getan wird, um die Verbrechen zu verhindern, gibt es nicht genug Spezialisten für die damit verbundenen Krankheitsbilder, um zum einen Präventionsarbeit zu betreiben und zum anderen Diagnosen zu stellen und Menschen zu schützen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass diese Gewalt nicht nur im häuslichen oder schulischen Kontext erfahren und ausgelebt wird, sondern sich auch auf den politischen Bereich ausdehnt. Die Landesanalytikerin der GIZ und Geographin Biele (vgl. Biele 2015: Jugend) beschreibt diese Tatsache, die sich auch in unzähligen Medienberichten über Gewalttaten von politischen Jugendabteilungen der Parteien wiederfindet. Hier nur zwei Beispiele (verkürzte Übersetzung): „Sechs Jugendmitglieder der Partei Frodebu sind von Jugendmitgliedern der Regierungspartei mit Macheten verletzt worden.“ (OMAC: 1er avril 2014)19 „Nach einem Streit zwischen einem Hügelabgeordneten20 mit einem MSD Partiemitglied sind sechs Jugendliche verletzt worden, die den politischen Jugendabteilungen der beiden Streitenden angehören und sich in den Streit eingemischt haben.“ (OMAC: 22 avril 2014)21 Dass die Jugendlichen hier für politische Zwecke missbraucht und zu gewalttätigen Taten regelrecht paramilitärisch von internationalen Trainern ausgebildet werden, belegt ein Bericht von RPA. (OMAC: 15 mai 2014)22
Die hier belegte Verquickung von Politik, Gewalt und Jugend wird in einem Auszug aus einem Bericht des Soziologen Korongo über die Region der großen Seen deutlich dargestellt: „In Burundi the involvement of youth in armed conflict has been high since independence. During the 1993 crisis in particular, the Hutu youths from the FRODEPU party were reported to be the main perpetrators of genocide. As a reprisal, especially in the capital, the young Tutsis organized themselves in armed bands and killed the Hutu and destroyed their houses. During the 2010 elections, youth involvement in violence before and during the elections was noticed. The NGO Human Rights Watch shows that many cases of violence were committed by the youth from CNDD-FDD and FNL in the capital and in many rural areas during and after elections of 2010. During the election campaigns, competition between the parties revived the tension between militants. Many parties recruited young former fighters after the peace agreements between Government, CNDD-FDD and FNL.” (Korongo 2012: 16)
2.2.5. Jugend und Politik
Dass sich politische Aktivität seitens der Jugend in Burundi aber nicht auf Gewalt und Manipulation reduzieren lässt, aber ein elementarer Teil ist, wird in einem Bericht der burundischen Sozialwissenschaftlerin Kazoviyo deutlich. Wie sie schreibt, ist die Beteiligung burundischer junger Menschen23 an politischer Leitung de facto unüblich: „es ist nicht üblich Personen im Alter unter 35 Jahren in offiziellen politischen Leitungsfunktionen zu finden24“ (Kazoviyo 2014: 11). Diese Tatsache läuft aber entgegen den Beobachtungen, dass „die Burundier nicht aufhören zu bestätigen, dass die Jugend die Zukunft des Landes bildet25“ (a.a.O.: 1) und es Jugendlichen erlaubt ist, ab 25 für das nationale Parlament oder alle lokalen politischen Ämter zu kandidieren (vgl. a.a.O.: 10f.). Kazoviyo nennt in ihrer dokumentenbezogenen Analyse dann einige Punkte, an denen angesetzt werden muss, wenn die Situation politischer Partizipation verbessert werden soll (a.a.O.: 31-34):
Das Unwissen der Jugend über legalen Rahmen
Die Manipulation und Instrumentalisierung der Jugend
Die wirtschaftliche Situation des Landes und der Jugend
Die Marginalisierung der Jugend durch Erwachsene
Als Basis für die Bearbeitung und Umsetzung dieser Benachteiligungspunkte gilt das Interesse seitens der burundischen Jugend, die Zukunft anders zu gestalten, der Politik des Landes eine neue Richtung zu geben und sich nicht für politische Zwecke manipulieren zu lassen.
Dieses Interesse wird von vielen Jugendorganisationen beobachtet, gefördert und gefordert wie Summers beschreibt: „Enlarging the policy advocacy work of international agencies is crucial. This would include advocating against policies that disadvantage youth (such as restrictions on informal economies and limited youth access to housing, land and reproductive health) or facilitate predatory practices against youth (such as the actions of police and other security forces), which collectively run the risk of further marginalizing youth.” (Sommers 2012 b: 5) Weiterhin ist dieses Interesse, wie in nachfolgenden Kapiteln (vgl. Kapitel 4.4.1. und 6.2.2.) erarbeitet werden wird, elementar für Partizipationsprozesse.
2.3. Wirtschaftliche Situation Burundis
Wirtschaftlich treibende Faktoren für das ostafrikanische Land sind die Hauptexportprodukte Kaffee und Tee26. Daneben gibt es einige kleinere Goldfunde27 und südafrikanische Minengesellschaften heben kleinere Bodenschätze. 90% der burundischen Bevölkerung lebt hauptsächlich von Subsistenzlandwirtschaft (Omara/ Ackson 2010: 8), die aber zunehmend erschwert wird, denn durch „increasing land scarcity, food insecurity features among the major challenges facing the country. This is worsened by climate change effects, with erratic rains affecting planting and harvesting seasons“ (ebd.). Das Bruttoinlandprodukt ist in den Jahren 2009 bis 2012 zwar gestiegen, wurde aber auch von einer steigenden Inflation begleitet, die 2012 bei 18% lag (Bertelsmann Stiftung 2014: 20). Daneben prägen Korruption und politischer ökonomischer Opportunismus die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (ebd.). All diese Faktoren führen dazu, dass Burundi als eines der ärmsten Länder dieser Welt bezeichnet wird und in allen gängigen Indizes (Hunger, Multipoverty etc.) zu den Schlusslichtern zählt.28 Schätzungen besagen, dass die Burundier mit rund 2 US Dollar am Tag überleben müssen (ebd.).
Die Gründe für die wirtschaftliche Situation und daraus resultierende Verteilungsungerechtigkeit in dem ostafrikanischen Land sind vielfältig: laut Regierung spielen die Auswirkungen des Bürgerkrieges immer noch eine große Rolle (Republic of Burundi/ IMF 2012: 27). Dazu werden noch Faktoren wie eine zu hohe Geburtenrate, zu wenig Kompetenzen im Umgang mit Entwicklungshilfegeldern oder die Effektivität des Umgangs mit öffentlichen Geldern und Energiefragen als weitere Ursachen für die aktuelle Armutssituation genannt (a.a.O.: 27f.). Von anderen Stellen werden Sicherheitsfragen, Regierungsführung, Aids- und Genderangelegenheiten angeführt (Omara/ Ackson 2010: 9) oder eben auf die Korruption im Land hingewiesen (Bertelsmann Stiftung 2014: 20) und die große Abhängigkeit des burundischen Marktes von Importen (a.a.O.: 21) als Gesichtspunkt benannt. So vielfältig die Gründe für diese Verteilungsungleichheit sind, so vielfältig werden sowohl von Regierungsorganisationen als auch von verschiedenen nationalen und internationalen NGOs Lösungsansätze gelebt und vorangetrieben.
Jedoch ist eine der Konsequenzen dieses breiten Kampfes gegen Armut im Land, dass Burundi sich in einer zunehmend großen Abhängigkeit von internationalen Entwicklungsgeldern befindet. Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) geht davon aus, dass mehr als 50% des burundischen Staatshaushalts von internationalen Geldgebern finanziert wird, darunter die EU als größter Beitragszahler (Biele 2015: Entwicklung)29.
Die Bewertung der globalen wirtschaftlichen Prozesse und Haltungen, die zu dieser Abhängigkeitssituation in Burundi führen, kann hier keinen Platz finden, da der Fokus der Arbeit auf Zusammenhängen der lokalen Ebene liegt. Im Kapitel 4.4.2.1. wird jedoch ein Modell vorgestellt, welches Lösungen auf lokaler Ebene sieht, wie diese in den Kontext der Fragestellung dieser Arbeit passen und in Zusammenhang mit dem hier skizzierten wirtschaftlichen Rahmen stehen.
2.4. Geschichte Burundis
Die Geschichte Burundis kann in dieser Arbeit nur kursorisch beschrieben werden. Aber als Hintergrund für das Verständnis von Gewalt, Armut und der jetzigen politischen und demokratischen Lage des Landes ist es unerlässlich, einige Epochen zusammenfassend darzustellen und den LeserInnen einen historischen Einblick zu gewähren.
2.4.1. Monarchie und Kolonialzeit
Ndabiseruye berichtet, wie vor der Kolonialisierung Burundi von einem König regiert wurde: der Mwami war weder Hutu noch Tutsi. Er war von einer adligen Kaste, den Prinzen, umgeben – den Ganwa auf Kirundi. Auf Dorfebene hatten die bashingantahe, also die Ältesten oder Weisen, die juristische Autorität inne, die sie bis heute noch in vielen Teilen des Landes haben. Das Volk, das als „Sand“ (Kirundi: umusenyi) bezeichnet wurde, musste die Herrschaftsbeziehung intensiv pflegen. Dies vor allem durch Besuche, bei denen die Hände nicht leer sein durften30 (vgl. Ndaybiseruye 2009: hier besonders 74-81). Ndabiseruye beschreibt eindrücklich, wie die Herrscher das Volk benutzten und „Beispielsweise wurde das „umusenyi“ bei politischen Entscheidungen natürlich nicht gefragt“ (a.a.O.: 81, Hervorhebung im Original).
Im Weiteren beschreibt Ndabiseruye wie die Tutsi in der vorkolonialen Zeit immer stärker wurden und sich ein Machtverhältnis der Überlegenheit gegenüber den Hutu implementierte. Dass es zu keinem Aufstand seitens der Hutu kam, läge an der ausgleichenden Rolle des Königs und der bashingantahe (a.a.O.: 88f.). Interessant für den Kontext dieser Arbeit ist, dass Ndabiseruye eine politische Resignation historisch begründet sieht, wenn er schreibt: „Dies [die Resignation, d.Verf.] erklärt sich durch den monarchischen Autoritarismus einerseits und die Mentalität des Gehorsams und der Gefügigkeit der kleinen Leute gegenüber Autorität andererseits“ (a.a.O.: 89.). Erst durch Bildung und Schulen sei eine politische Bewusstseinsbildung bei den Hutu eingetreten (vgl. a.a.O.: 90). Diese Situation wurde dann von den Kolonialherren politisch benutzt, indem sie die Tutsi stärkten, ihnen Zugang zu höheren Bildungswegen und Ämtern ermöglichten, sie (die Tutsi und Ganwa) „wurden protegiert und zur Elite gemacht, die anderen – über neunzig Prozent der Bevölkerung – blieben lange Zeit nicht nur von höherer Bildung, sondern auch von politisch entscheidenden Stellen und vom politischen Geschehen ausgeschlossen“ (a.a.O.: 95). Burundi war bis zu seiner Unabhängigkeit im Jahr 1962 von mehreren Kolonialherren besetzt worden: von 1890 beginnend durch die Deutschen im Protektorat Deutsch-Ostafrika (Watt 2008: 23f.), das aber vom burundischen König erst 1904 anerkannt wurde (a.a.O. 28). Die deutsche Kolonialherrschaft, die es MissionarInnen erlaubte, ins Land zu kommen und die in Folge dann Schulen gründeten und die Schriftsprache einführten (Ndabiseruye 2009: 47), endete 1916, als belgische Truppen die deutschen Schutztruppen zurückdrängten bzw. als 1921 die Belgier das Mandat zur Kontrolle des Landes seitens des Völkerbundes bekamen, „which implied a responsibility to lead the country towards independence“ (a.a.O.: 28).
2.4.2. Die junge Republik
Die Unabhängigkeit kam mit der Wahl des ersten burundischen Premierministers Prinz Louis Rwagasore im September 1961 und beendete die belgische Kolonialherrschaft. Er gehörte der UPRONA Partei an, war Ganwa (also Prinz) und mit einer Hutu verheiratet (Ndabiseruye 2009:49). Seine Regierungszeit war nur kurz – er wurde im Auftrag der rivalisierenden und von der belgischen Kolonialmacht unterstützten Partei PDC nach drei Wochen Amtszeit ermordet (Watt 2008: 30f.). Sein Vater, König Mwambutsa, regierte als König bis 1966 weiter, dennoch wurde Burundi am 01.07.1962 unabhängig. Diese Zeit war geprägt von Tutsiflüchtlingen aus Ruanda, die dort verfolgt waren und „filled with hatred for Hutus, fuelling the fear of Burundi’s Tutsi minority“ (a.a.O.: 31) weiter zu einer Ethnisierung des Konflikts beitrugen. 1965 wurde dann der erste Hutu Premierminister, der mit einer Tutsi verheiratet war, ermordet (ebd.). Es folgte eine lange Regierungszeit von Tutsi Präsidenten (19661993), die in der blutigen Niederschlagung eines Hutu Aufstandes 1972 einen traurigen Höhepunkt fand. Bis zu 200.000 Hutu wurden umgebracht, über 300.000 flohen (a.a.O.: 33f.).
Während dieser Tutsi Regierungszeit wurden christliche Kirchen geschlossen (besonders unter Präsident Bagaza), MissionarInnen mussten das Land verlassen und Hutu wurden unterdrückt und systematisch von Bildung und Macht ferngehalten: „under Bagaza Hutus were often prevented from going to school and from succeeding in exams“ (a.a.O.: 39). Mit Buyoyas Machtübernahme 1987 änderte sich die Situation leicht, wobei auch im Jahr 1988 20.000 Hutu als Racheaktion eines Überfalls auf Tutsi umgebracht wurden. Im Zusammenhang mit dem Fall der Mauer und der Demokratisierung der Welt setzte Buyoya dann von 1991-1993 Reformen um: „Hutus were seen on television, where they had never been seen before! They started getting jobs in town. They were free to get some education“ (a.a.O.: 42).
Im Juni 1993 waren die ersten freien Wahlen in Burundi angesetzt, die vom Hutu Ndadaye gewonnen wurden, der aber schon im Oktober 1993 ermordet wurde. Es folgte ein langer, blutiger Bürgerkrieg, der über 350.000 Menschen das Leben kostete und erst im Jahr 2006 beendet wurde (Nadbiseruye 2009: 61).
2.4.3. Burundis jüngste Geschichte und ihre Herausforderungen
Politik
1998 starten in Arusha, Tansania, lange mühsame Verhandlungen, wie Frieden in Burundi herbeigebracht werden könnte. Buyoya wurde Übergangspräsident und im Jahr 2005 ging die CNDD-FDD als stärkste Partei aus den ersten Wahlen nach dem Bürgerkrieg (in Burundi spricht man von „la crise“ – die Krise) hervor. Der Hutu Pierre Nkurunziza wurde Präsident. Nkurunziza war Rebellenführer und leitete die CNDD-FDD als solcher seit 2001, brachte ihr aber einen stärkeren systemkritischen Ansatz und weniger eine ethnienbasierte Ideologie (vgl. Watt 2008: 89). Nkurunziza selbst hatte zu den Waffen gegriffen und wurde 1996 zum Tod verurteilt, weil er Panzerminen legte und dabei Dutzende von Menschen umkamen (Laroque 2013: 467). 2006 willigte die letzte Rebellengruppe, die FNL, in den Vertrag von Arusha ein und legte die Waffen nieder, womit der Bürgerkrieg offiziell beendet war. 2010 waren erneut Wahlen, die wiederum von der CNDD-FDD gewonnen wurden und Nkurunziza im Amt bestätigten. Trotz Unruhen und Unmut31 wurde Nkurunziza zu einer dritten Amtszeit im Juli 2015 wiedergewählt.
Nur fragmentarisch kann nachfolgend angerissen werden, vor welchen Herausforderungen Burundi in der neuesten Geschichte steht.
Demobilisierung
Mit den Wahlen von 2005 begann eine Zeit der Demobilisation. Es wurden finanziell aufwändige Programme der Waffenabgabe umgesetzt, die auch dazu führten, dass ein großer Teil der ehemaligen Kämpfer sich in Militär und Polizei wieder fanden und nun in Sicherheitsorganen des neuen Staates dienten (vgl. BTI 2012: 9). Diese Eingliederung von ehemaligen Kämpfenden ist somit eine Herausforderung bei der Gestaltung des Übergangs zu einer politisch stabilen Gesellschaft. Als Ansätze werden neben geographischer Integration, eine sozio-ökonomische Integration und eine soziale Integration gesehen und in einem Regierungsplan dargestellt (vgl. MSNRRRS 2006, hier: 27-51). Doch nicht nur die Weise der Erfassung der zu demobilisierenden Personen – unter ihnen 3600 Kinder (Seymour 2015: 251) – stellt ein Problem dar, sondern auch die finanzielle Ausstattung des Programms, die zu Frustration und neuer Aggression führt, da sich viele als Tagelöhner, Träger oder Lastenschlepper ihren Lebensunterhalt verdienen müssen (ebd.). Dies führt dann unter anderem zu neuem Banditismus (a.a.O.: 250).
Flüchtlinge