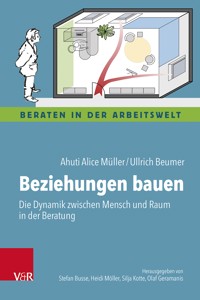
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Schon immer haben sich Organisationsdynamiken auch in den konkreten Interventionsformen und Settings von Beratung, Fortbildung, Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung gespiegelt. Insbesondere in der Psychoanalyse und in der psychodynamischen Beratung spielen dabei spezielle Settings und "Möblierungen" als wesentlicher Teil der Intervention eine Rolle. Was für die Psychoanalyse als Therapie gilt, lässt sich zweifellos auch für Settings im Bereich von Coaching, Training und Organisationsberatung sagen: Obwohl die Welt der unbelebten Objekte unbestreitbar zu den maßgeblichen Bedingungen und Bestandteilen jeglicher menschlicher Interaktion gehört, sei es durch die Räumlichkeit, sei es aber auch durch den Umgang und die Einbeziehung der unbelebten Objekte, weisen Berater:innen diesem Aspekt oft nur eine nachgeordnete Bedeutung zu. Dabei sind Beratungsräume als Bestandteil des beratenden Rahmens zu verstehen. Sie sind Spiegelbild von Struktur und Selbstverständnis der Berater:innen und ihnen kommt eine triangulierende Funktion zu. Was bedeutet das für die Praxis von Berater:innen und ihre Räume? Wie gestalten sie den geschützten Beratungsraum als abgeschlossenen Raum, um zu entschleunigen und damit sich die Klient:innen auf den Beratungsprozess einlassen können?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben von
Stefan Busse, Heidi Möller, Silja Kotte und Olaf Geramanis
Ahuti Alice Müller / Ullrich Beumer
Beziehungen bauen
Die Dynamik zwischen Mensch und Raum in der Beratung
VANDENHOECK & RUPRECHT
Mit 8 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2024 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Volkmar Müller
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
EPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-607X
ISBN 978-3-647-99329-4
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Einleitung
Identität und Raum – Woher komme ich?
Spatial Turn – ein neues altes Verständnis der Bedeutung des Raums
Veränderungen unserer Arbeits- und Lebenswelten – die Raumgestaltung als aktuelles Thema in Unternehmen
1 Die Dynamik zwischen Mensch und Raum
Wechselwirkung der Beziehung
Raumwirkung und -stimmung
Die Definition des Raumbegriffs
Der innere Raum
Räumliche und »psychische« Proportionen
Raumverhalten und Territorialität
Psychodynamische Aspekte der Bedeutung von Beratungsräumen
Organization in the mind: im Schnittpunkt gesellschaftlicher und biografischer Einflüsse
Beratungsräume als transformative Räume
Die Rolle der Beratenden als Hosts
Die Raumerwartung der Beratenen
2 Variationen von Beratungsräumen
Der fremde Beratungsraum
Die Eingangssituation
Meetingräume
Die geteilte Host-Rolle
Der geteilte Beratungsraum
Der eigene Beratungsraum
Der multifunktionale Beratungsraum – Zeichen einer veränderten Professionalität von Beratenden
Beraten ohne Raum: das Außen
3 Der inszenierte Beratungsraum
Raumdidaktik: Spacing und Inszenierung
Der »bedingte« Raum
Gruppensettings und Positionierung
4 Der »angemessene« Beratungsraum – ein Leitfaden zur Gestaltung
Lage, Orts-Identität und Nachbarschaft
Umraum
Der Beratungsraum selbst
Die Raumanalyse nach Feng-Shui-Kritierien
Der gesunde Arbeitsplatz: die Wand im Rücken
Farben
Abschließende Fragen zur Reflexion der Raumgestaltung
5 Diagnostische Methoden zur Arbeit mit Räumen
Raumbiografie
Soziale Fotomatrix
Lautes Denken
6 Abschiednehmen vom eigenen Beratungsraum
Dank
Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Berater/-innen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforscher/-innen, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mit gestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leser/-innen, die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe werden Themen bearbeiten, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So werden die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen nochmals offerieren und aufbereiten, sondern sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt bewegen. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und Schulen übergreifend, in der nicht einzelne Positionen prämiert werden, sondern zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene anregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Heidi Möller, Silja Kotte und Olaf Geramanis
Einleitung
Mario L. fährt zur Teamsupervision nach Aachen. Der Auftraggeber1 bringt ihn von der Rezeption seines Unternehmens in einen Besprechungsraum mit sieben großen Tischen und 14 schweren Konferenzstühlen. 14 Teilnehmende werden erwartet. Und der Raum passt so gar nicht.
Beratung findet in Räumen statt, immer. Jede beratende Person muss sich mit Räumen, also dem jeweiligen Setting, in den unterschiedlichsten Beratungsformaten auseinandersetzen. Die Wirkung von Räumen auf Beratungsprozesse ist nicht zu unterschätzen und verdient mehr Aufmerksamkeit in der Praxis sowie in der Aus- und Fortbildung von Beratenden. Dieses Buch leistet einen Beitrag zur systematischen Reflexion der Wechselwirkung zwischen Menschen und Räumen in der Beratung.
Identität und Raum – Woher komme ich?
Schon unsere Alltagskommunikation lässt wenig Zweifel daran, wie sehr unsere persönliche Identität an räumliche Bezüge gebunden ist: Werden wir gefragt, wer wir sind, nennen wir neben unserem Namen und unserem Geburtsdatum häufig auch den Ort, an dem wir geboren sind oder leben, so als könnten wir mit der Nennung des (Geburts-) Ortes etwas ausdrücken, was unsere Identität unzweifelhaft ausmacht. Mit dem Hinweis, »dass wir – ob wir wollen oder nicht – an einem anderen Ort ein anderer Mensch sind« (de Botton, 2008, S. 13), ist der unauflösbare Zusammenhang von Ort, Raum und Identität angesprochen. Dies führt uns zu der Frage, welche Bedeutung Beratungsräume für die Identität der Beteiligten haben.
Spatial Turn – ein neues altes Verständnis der Bedeutung des Raums
Das in den Sozialwissenschaften bezeichnete Phänomen des »Spatial Turn« (Döring u. Thielmann, 2008) ist eine neuere Entwicklung und beschreibt die Wiederentdeckung des Raums als wichtiges Element menschlichen Handelns, Arbeitens, zwischenmenschlicher Beziehungen und persönlicher Identität. Spatial Turn widerlegt damit die seit Langem vorherrschende öffentliche und wissenschaftliche Diskussion um das »Verschwinden des Raums« (vgl. dazu ausführlich Döring u. Thielmann, 2008; Schlögel, 2003; Castells, 2001). Diese war maßgeblich beeinflusst durch die Entstehung neuer Informationstechnologien und die Digitalisierung der Welt, mit denen es mehr noch als mit Auto, Schiff und Flugzeug möglich geworden ist, riesige Distanzen scheinbar mühelos zu überbrücken bzw. gar nicht mehr wahrzunehmen. Und es ist nicht zu leugnen, dass dadurch in den vergangenen Jahrzehnten neben der physischen eine neue virtuelle Welt entstanden ist. Unübersehbar haben die mit der Globalisierung einhergehenden Prozesse von Flexibilisierung, Entgrenzung, Virtualisierung etc. jedoch nun auch ein neues Bewusstsein dafür bewirkt, dass die Orte, an denen wir wohnen, die Räume, in denen wir leben und arbeiten, die Dinge, mit denen wir uns umgeben, seit jeher so etwas wie eine Rückversicherung der eigenen Grenze vermitteln und so unsere psychische Stabilität stärken; diese Aspekte nehmen also einen neuen Stellenwert ein.
Veränderungen unserer Arbeits- und Lebenswelten – die Raumgestaltung als aktuelles Thema in Unternehmen
Die aufgeführten Faktoren der Veränderung von Welt, der Diskurs des Spatial Turn und nicht zuletzt die Coronapandemie lassen sich auch in einem neuen Verständnis für die Funktion von (Büro-)Räumen in vielen Unternehmen ablesen:
»[Unternehmen] schaffen neuerdings Bürolandschaften, die dem Wohnumfeld ähneln, und wählen dafür Begriffe wie ›Begegnungsstätte‹, ›Möglichkeitsraum‹ oder ›Kommunikationszone‹. Ehemalige Schreibtischkolonnen avancieren zu Kreativorten für Austausch, Zusammenkommen sowie das gemeinsame Ideenentwickeln. Gleichzeitig aber werden persönliche Schreibtische ersetzt durch Desks, die von mehreren Kolleg*innen geteilt werden« (Müller u. Brünen, 2022, S. 10).
Die meist üblichen Einzelbüros sind in Auflösung begriffen, da Vereinzelung als hinderlich angesehen wurde für eine notwendige Kommunikation, die angesichts der geforderten Flexibilität im Arbeitskontext als unabdingbar galt. Innovationen, auf die besonders die Unternehmen angesichts des Dauerdrucks in der Globalisierung angewiesen waren, konnten – so die Erkenntnis – nicht im stillen Kämmerlein entstehen, sondern durch gegenseitige Inspiration und möglichst viel Austausch. Im Zentrum standen darum nun die erwähnten Großraumbüros mit flexiblen Arbeitsplätzen, Kaffeestationen, Spielmöglichkeiten, Meetingbereichen etc. Daraufhin folgte die Erweiterung in Richtung von Campusmodellen. Damit gemeint sind Zentrierungen betrieblicher Funktionen in einem räumlichen Bereich bei Beibehaltung getrennter Funktionsbereiche, die aber miteinander in Kontakt gebracht werden sollen. Gleichzeitig flexibilisiert das Campusmodell die Grenzen zwischen Beruf und Privatem, etwa durch Integration von Cafés, Restaurants, Kindertagesstätten, Sport- und Freizeitmöglichkeiten.
Dass Grenzen zwischen Privat und Beruflich verschwimmen und die Gestaltung neuen Raums im Arbeitskontext, wie wir sie darstellten, darauf Antwort finden muss, liegt per se in den Veränderungen des Privatlebens. So verliert die Familie als vorherrschendes Lebensmodell zunehmend an Einfluss, und aus der Vereinzelung des Menschen bei gleichzeitiger Sinnsuche folgt der Wunsch nach Selbstverwirklichung im Beruf. Mitarbeitende erleben Zugehörigkeit im Team oder in der Organisation, gleichzeitig aber wünschen sie sich eine ausgeglichene Work-Life-Balance. So wie die Arbeit via Homeoffice in das Privatleben einzieht, findet umgekehrt die Wohlfühl-Kultur in der Arbeitswelt ihren Niederschlag. Entsprechend gehören Themen wie Gesundheit, Aufenthaltsqualität und Bürodesign inzwischen zum State of the Art der Unternehmenskultur – das Feelgood soll zu einer besseren Arbeitskultur führen.
Von den beschriebenen Entwicklungen bleibt, neben der Fachberatung, auch das Feld der professionellen Beratung in Coaching, Supervision und Prozessberatung in Form von Organisationsentwicklung2 nicht unberührt. Aus den Phänomenen der räumlichen Mobilität und der veränderten Arbeitsumgebung bilden sich also für alle Formen der Beratung neue Fragen und Perspektiven3, denn die Neuerungen in Gesellschaft und Arbeitswelt haben neben aller Flexibilisierung und größeren Freiheit auch ein Gefühl elementarer Unsicherheit bewirkt. Der Kulturkritiker Daniel Schreiber spricht vom »zuhauselosen Zuhause« (2022, S. 80) als eine Art Dauerzustand des modernen Menschen, der sich zum einen in erhöhtem Beratungsbedarf von Privatpersonen und Organisationen niederschlägt.
Zum anderen sind davon auch die Beratenden selbst betroffen. Nehmen wir das Beispiel der Supervision: Stand in ihrer Entwicklung als Profession lange Zeit die Idee der eigenen Praxis im Sinne einer freiberuflichen Tätigkeit in persönlichen Räumen im Vordergrund, hat sich in den letzten Jahren eine Entgrenzung dieser Beratungsform vollzogen. Sie findet nun bspw. als Training in eigenen Bildungszentren oder Hotels statt, so dass sich neben konventionellen Raumstandards auch Beratungsrollen verschieben (Näheres dazu im Abschnitt »Der multifunktionale Beratungsraum – Zeichen einer veränderten Professionalität von Beratenden«). Was bedeutet das aber für die Praxis von Beratenden und ihre Räume? Braucht es nicht gerade den geschützten, abgeschlossenen Beratungsraum, um zu entschleunigen und sich auf den Beratungsprozess einlassen zu können? Darüber haben wir nachgedacht und für die Beantwortung dieser Fragen folgenden Ausgangspunkt gebildet: Das Instrumentarium jedes Coaches oder jeder Beraterin umfasst grundsätzlich zwei Wirkfaktoren, nämlich die beteiligten Personen (die Beratenen und die Beratenden) und das Setting innerhalb eines gegebenen Raums. Die Relevanz dieser Überlegung wird klar, wenn wir bedenken, dass beide Faktoren aufeinander einwirken (in welcher Form, stellen wir später heraus) und in ihrer »Ausgewogenheit« durchaus zu einem fruchtbaren Beratungsprozess beitragen können.4 Wie dies gelingen kann, möchten wir in diesem Band aufzeigen.
In Kapitel 1 stellen wir Theorien zur Wechselwirkung der Beziehung von Mensch und Raum vor. Dies reicht vom Raumbegriff über die Bedeutung des Beratungsraums bis zur Raumerwartung unserer Klienten. Im Kapitel 2 beschreiben wir unter Anwendung von Fallbeispielen Variationen von Beratungsräumen, darunter fremde, geteilte, multifunktionale und eigene Räume.
In Kapitel 3 erwartet Sie der Blick auf die konkrete Inszenierung von Beratungsräumen, einschließlich Sitzordnungen und Settings. Einen praktischen Leitfaden zur Gestaltung des eigenen Beratungsraums und diagnostische Methoden zur Arbeit mit Räumen finden Sie in Kapitel 4 und 5 des Buches.
Wir beschließen unsere Reflexionen und Anregungen mit dem Abschied vom eigenen Beratungsraum und von der aktiven Rolle des Beratenden.
1 Im Folgenden wird die männliche und weibliche Schreibweise alternierend verwendet. Im Sinne der gendersensiblen Sprache mögen sich alle jeweils mitgemeint fühlen.
2 Die Beratungsformen haben sich differenziert, wobei die sogenannte »Prozessberatung« (die Beratungsform, die sich weniger auf fachliche und strukturelle Aspekte fokussiert) insbesondere durch die Entwicklungen in Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung an Bedeutung gewonnen hat.
3 Eingeschlossen sind auch psychotherapeutische Interventionen, wie sie in Einzel- und Gruppenpraxen stattfinden.
4 Die noch im Entstehen befindliche Disziplin der Beratungswissenschaft, wie sie etwa an der Universität Kassel gelehrt wird, beschäftigt sich in diesem Kontext mit Beratungsarchitekturen und wissenschaftlich fundierten Interventionskonzepten.





























