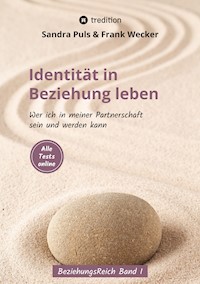9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: BeziehungsReich
- Sprache: Deutsch
Ein Buch über Beziehungsgrenzen und die Gründe, die zu einer Öffnung führen könnten. Geschrieben mit Respekt vor allen bedeutsamen Beziehungen und der Überzeugung, dass mehr als eine Lösung möglich sein kann. Die entscheidende Frage: Welche Auswirkungen hat eine Nebenbeziehung für die beteiligten Menschen? Wie hoch ist der "Gewinn", wie hoch der "Preis" (und wer zahlt ihn)? Mittels dieses Buches kann ich die Kräfte erforschen, die mich sowohl an meinen Partner binden, als auch mich zu Begegnungen mit anderen anziehenden Menschen motivieren. Wo stehe ich in diesem Kraftfeld gerade persönlich? Ausführlich betrachtet werden verschiedene Formen von Nebenbeziehungen und die jeweiligen Perspektiven: Wie geht es mir jeweils in der aktiven Rolle, als betroffener Partner und wie als die dritte Person? Und wo bleibt die Moral?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sandra Puls Frank Wecker
Beziehungsgrenzenneu denken
Nebenbeziehungen:Nur Problem oder auch Lösung?
© 2022 Sandra Puls, Frank Wecker
www.BeziehungsReich-online.de
ISBN Softcover: 978-3-347-56954-6
ISBN Hardcover: 978-3-347-56955-3
ISBN E-Book: 978-3-347-56956-0
Druck und Distribution im Auftrag der Autoren: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Cover-Foto: iStock.com/Iuliia Anisimova
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte sind die Autoren verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autoren, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
In einer wirklich beglückenden Beziehung
findet man nicht nur den anderen –
sondern auch sich selbst
Inhalt
I. Einleitung
II. Beziehungs-Grenzen
A. Gründe für geschlossene Grenzen
1. Exklusivität
2. Normorientierung
3. Beziehungs-Bindung
B. Gründe für geöffnete Grenzen
1. Unzufriedenheit
2. Autonomie
3. Schwebebedürfnis
C. Erreichbarkeit für Andere
III. Der Außenreiz
A. Der Einfluss des Außenreizes
B. Bedürfnis-Test
IV. Die Nebenbeziehungstypen
A. Das Goodie
B. Die Affäre
C. Die Parallel-Liebesbeziehung
D. Das Doppelleben
V. Moralische Aspekte – ein Dialog
VI. Nachwort
I. Einleitung
In dieser Einführung in die Thematik erfahren Sie etwas über unsere Haltung zu Beziehungen im Allgemeinen und Nebenbeziehungen im Besonderen. Wir stellen auch dar, mit welchen Sorten von zwischenmenschlichen Beziehungen wir uns befassen und unter welchen Fragestellungen und Perspektiven wir das tun.
Nach dem Lesen dieses Kapitels sollten Sie entscheidungsfähig sein: Könnte dieser Text für Sie einen Zugang zu diesem schwierigen und mit vielen Tabus versehenen Thema bieten? Mögen Sie einen Schreibstil, der versucht, zugleich seriös und unterhaltsam zu sein (manchmal auch provozierend direkt)?
Nebenbeziehungen als Lösung!?
Das hört sich mutig und vielleicht sogar etwas verrückt an. Auf jeden Fall provokativ.
Wollen wir vielleicht irgendein ausgeflipptes Beziehungskonzept aus den wilden Zeiten des letzten Jahrhunderts aufwärmen? Jede mit jedem – wild durcheinander? Alles ist erlaubt?
Nein – das wollen wir ganz bestimmt nicht! Ganz abgesehen davon, dass diese Fantasien mit der damaligen Realität nur am Rande zu tun hatten – wir wollen in diesem Buch nicht die monogame Zweierbeziehung oder die bürgerliche Ehe sturmreif schießen, wir wollen nicht zu hemmungslosen Experimenten aufrufen oder alle gängigen Moralbegriffe über den Haufen werfen.
In gewisser Weise wollen wir sogar das Gegenteil: Es geht uns in diesem Buch um den Respekt vor Beziehungen, um ihre Bedeutsamkeit und den Wunsch, sie auch unter schwierigen Umständen zu erhalten.
Reiben Sie sich gerade die Augen? Hatten Sie nicht ein Buch über Nebenbeziehungen in die Hand genommen? Ist nicht jeder beziehungsmäßige Nebenschauplatz ein Angriff auf den Kern einer Partnerschaft? Zeugen nicht unzählige Beziehungstragödien davon, dass kaum etwas mehr Chaos, Leid und Unglück in das Leben der Menschen bringt als der Versuch, eine bestehende Beziehung um einen weiteren bedeutsamen oder gar geliebten Menschen zu erweitern?
Reicht es dann nicht, möglichst eindeutig vor solchen Versuchen zu warnen? Muss man zu diesem Thema ein ganzes Buch schreiben?
Die mit diesen Fragen verbundene Haltung ist uns nicht fremd; wir verstehen sie. Wir wissen und respektieren die Unsicherheiten und Ängste, die das Thema auslöst. Auch davon handelt dieses Buch.
Wenn Sie sich auf dieses kleine Lese-Abenteuer einlassen, werden Sie erleben, dass wir alles andere als blind sind gegenüber den Risiken und den emotionalen Zumutungen von Nebenbeziehungs-Konstellationen. Dass wir insgesamt eher davor warnen, als Sie unvorbereitet in eine Situation zu schicken, in der Sie oder Ihre Beziehung(en) durchaus auch scheitern könnten.
Mit einer – vielleicht ungewohnten – Sachlichkeit und Neutralität wollen wir uns den ganz unterschiedlichen Facetten dieses Phänomens nähern. Nicht mit dem Ziel, sowieso bekannte Verurteilungen zu wiederholen, sondern mit dem Vorhaben, bisher im Dunkeln liegende Ecken auszuleuchten und damit das Bild zu vervollständigen.
Wir wollen schauen, was da warum, auf welchem Weg und mit welchen Folgenfür wen passiert, wenn ein Partner sich zusätzlich einem neuen Menschen zuwendet. Dass es passiert, ist nicht unsere Schuld und auch nicht unser Bestreben. Sich damit in Ruhe und mit der notwendigen Differenziertheit auseinanderzusetzen, falls es passiert, ist unser Anliegen und unser Angebot in diesem Buch.
Und damit es für Sie interessanter und persönlicher wird, haben wir dafür gesorgt, dass Sie aktiv im Geschehen sind. Zu allen wichtigen Überlegungen bieten wir Ihnen Selbst-Analysen in Form von kurzen Fragebogen an. Mit dem Wissen über Ihre eigene Position können Sie aus der vorgeschlagenen Reise einen ganz individuellen Trip machen.
Dabei sind uns alle Positionen und ihre unterschiedlichen Perspektiven gleich wichtig. Egal, ob Sie derjenige sind, der – trotz seiner Paarbeziehung – zu einem zweiten Menschen eine engere Beziehung eingeht, ob Ihr Partner – vermutlich ohne Ihre Zustimmung – eine solche Entscheidung gefällt hat oder ob Sie – auf der anderen Seite – dieser Nebenbeziehungs-Partner sind (und selbst eine oder auch keine Basis-Beziehung haben). Unsere Parteinahme gilt nicht vorrangig einer dieser Rollen, wir sprechen nicht von Opfern und Tätern. Unser Verständnis und unsere Empathie gelten allen Personen, die sich im komplexen Feld der Liebesbeziehungen um ihr ganz persönliches Glück bemühen oder es verteidigen wollen.
Vielleicht ist das eine Art Kernüberzeugung, die uns beim Schreiben dieses Buches begleitet hat: In den allerwenigsten Fällen werden in Liebesdingen Entscheidungen aus dem Motiv und mit dem Ziel gefällt, jemandem zu schaden. Die meisten Menschen, die irgendwann auf dem Weg zum eigenen Glück andere, sehr bedeutsame Menschen gekränkt oder verletzt haben, hätten das gerne irgendwie vermieden.
Aber wir wissen auch, dass sich das für die andere – betroffene – Seite in bestimmten Momenten ganz anders anfühlt bzw. dass selbst dieses Wissen nicht ohne weiteres über sehr schmerzhafte Erfahrungen hinweghilft.
Kann man in diesem Feld wirklich neutral sein? Ist nicht schon eine mehr oder weniger nüchterne Betrachtung der Geschehnisse rund um Nebenbeziehungen eine Art Einladung, zumindest eine Kapitulation vor einem moralischen Versagen?
Auch wenn in diesem Buch die Moralkeule tatsächlich nicht zu unserem Handwerkszeug gehört, leben und argumentieren wir nicht in einem moralfreien Raum.
Wir haben einen großen Respekt vor Beziehungen, auch und nicht zuletzt vor bestehenden, gewachsenen und tragenden Beziehungen. Beziehung leben heißt auch und immer, Verantwortung und Verbindlichkeit einzugehen.
Wir lassen nur zu, dass diese Werte in bestimmten Lebens- und Beziehungszeiten in Konflikt geraten können mit anderen Zielen, Prioritäten und Bedürfnissen. Wir sprechen dieser anderen Seite nicht von vorneherein ihre Berechtigung ab und begegnen auch ihr mit einem einfühlenden Respekt. Mit dem gleichen Verständnis dürfen auch die mitbetroffenen Partner rechnen, deren Beziehungskonzept und -leben mehr oder weniger stark durcheinandergewirbelt werden. Und auch den entstandenen Nebenbeziehungen und den dort involvierten Menschen – da schließt sich der Kreis – gelten unsere Aufmerksamkeit und unser Wohlwollen.
Wem das schon zu weit geht, wer nicht neugierig darauf ist, sich mit uns auf eine Reise durch das unübersichtliche Gelände der Nebenbeziehungslandschaft zu begeben, wer zu allen dort lauernden Fragen schon jetzt seine Antwort weiß – der möge bitte dieses Buch gleich wieder aus der Hand legen. Dann ist er bei uns falsch.
Wenn Sie sich mit uns auf den Weg machen, stellen Sie sich auf Umwege, Serpentinen, Mautstrecken und Baustellen ein. Nur Sackgassen wollen wir vermeiden – so gut es eben geht.
Wir versprechen Ihnen alles andere als einen Rosengarten. Oder besser: Den Rosengarten, den wir Ihnen hier vorstellen, verlassen Sie nicht ohne deutliche Spuren der Dornen in Ihrer Kleidung und – so ehrlich wollen wir sein – auch auf Ihrer Haut.
Wollen Sie immer noch weiterlesen?
Wenn ja, versprechen wir Ihnen eine anregende und an manchen Stellen auch herausfordernde Lektüre. Ganz sicher aber bieten wir Ihnen keinen Seitensprung-Ratgeber! Wir nehmen Beziehungen ernst und betrachten sie nicht als Spielwiese – obwohl (oder vielleicht auch gerade weil) wir über die Eine (bestehende) Beziehung hinausschauen.
Willkommen im Reich(tum) der Beziehungen!
Bevor wir uns unserem Hauptthema zuwenden – den unterschiedlichen Erweiterungs-Formen der klassischen monogamen Beziehung – möchten wir ein paar Dinge unmissverständlich klarstellen:
Auch wir freuen uns über jede stabile Beziehung, die von den beiden Beteiligten als glücklich, erfüllend oder auch nur insgesamt befriedigend erlebt wird. Glückwunsch! Auch das ist ein beziehungsreiches Leben, in dem die Schätze, die ein Beziehungsleben bereithält, ganz bewusst und ohne ein nennenswertes Defizitgefühl dauerhaft mit einem Partner gelebt und geteilt werden. Machen Sie weiter so!
Genauso haben wir volles Verständnis dafür, dass die meisten Menschen im Falle einer grundlegenden Unzufriedenheit auf die Suche nach einer Alternative gehen – manche schon, während sie noch in der Beziehung leben, manche erst nach einem klaren Ende. Das Ziel ist dann eine neue, möglichst bessere Beziehung.
Dieses Muster, das von der Mehrheit der Menschen bevorzugt wird, nennt man bekanntlich serielle Monogamie. In der Regel durchlaufen junge Erwachsene einige solcher Beziehungs-Zyklen, bevor sie sich dann – oft im Zusammenhang mit einer Familiengründung – dauerhaft binden; die meisten auch in einem formalen Rahmen. Andere halten diesen Sprung von einer zur nächsten Beziehung als lebenslanges Muster bei. Geschieht das in eher längeren Einheiten, können dabei die inzwischen sprichwörtlichen Lebensabschnittspartnerschaften herauskommen.
Natürlich führen auch diese Menschen ein beziehungsreiches Leben. Eine Beziehung muss nicht ausschließlich von ihrem Ende her beurteilt werden – und somit als letztlich gescheitert. Jeder von uns wird auf Beziehungen zurückschauen können, die vor ihrem Scheitern – und damit letztlich auch in einer Gesamtsicht – bereichernd für sein Leben waren.
Nach der Würdigung dieser beiden Formen von Beziehungsreichtum wenden wir uns jetzt und im Rest dieses Buches einer weiteren Perspektive zu. Diese hat es zwar in der Menschheitsgeschichte immer gegeben und sie wurde in Büchern und Filmen ausgiebig betrachtet – aber sie spielt seltsamerweise in der alltäglichen Kommunikation über Beziehungen eine untergeordnete Rolle. Man könnte auch sagen: Sie fristet ein Schattendasein – sozusagen unter dem Ladentisch.
Es sind wohl in erster Linie gesellschaftliche Normen und Tabus verantwortlich dafür, dass dieses Thema nur unter sehr vertrauten Menschen offen angesprochen wird. Nebenbeziehungen sind nämlich nicht nur irgendwie verboten, sondern werden auch ganz oft heimlich eingegangen und geführt. Also sorgt man dafür, dass die Zahl der Mitwisser sehr überschaubar bleibt. Was dann zu der Paradoxie führt, dass zwar alle wissen, dass es so etwas gibt, kaum jemand aber konkrete Beispiele aus seinem Bekanntenkreis nennen könnte.
Es geht im Folgenden um das Bedürfnis oder die – mehr oder weniger planvolle – Entscheidung, das eigene Leben durch einen Zweit- oder Nebenpartner beziehungsreicher zu machen, ohne das Ziel zu verfolgen, diese zusätzliche Beziehung zur (nächsten und alleinigen) Hauptbeziehung werden zu lassen. Um es noch stärker zu betonen: Wir setzen bei unseren Überlegungen zu Nebenbeziehungen genau diese innere Haltung ganz explizit voraus – wohl wissend, dass sich ungeplante und ungewollte Entwicklungen im menschlichen Miteinander nicht ausschließen lassen.
Wer einen neuen Partner sucht und das über den Weg einer Nebenbeziehung einleiten will, der mag das so tun und der soll auch gerne dieses Buch lesen. Aber für diesen Leser wurde das Buch nicht geschrieben. Uns geht es nicht um die Nebenbeziehung als Exit-Strategie oder als Übergangsphänomen, sondern als angestrebten Dauerzustand (was immer Dauer im Einzelfall bedeuten mag). Und es geht um die Menschen, die als Partner mitbetroffen oder selbst diese zweiten, zusätzlichen Partner sind.
Reden wir über Back-Up-Beziehungen, also über den Reservepartner für alle Fälle, den man in der Hinterhand hat und bei Bedarf aktualisieren kann? Eher nicht! Der Back-Up-Partner hat eine klar zugewiesene Funktion, die erst bei Bedarf ins Spiel kommt. In der Zwischenzeit kann sich die Pflege dieser Beziehung auf das Minimum beschränken, das notwendig ist, um diese Funktion zu erhalten. Damit hat diese Beziehung – zumindest in der Regel – nicht den Charakter einer Nebenbeziehung, die man aktuell in sein (Beziehungs-)Leben integrieren möchte.
Wir meinen mit Nebenbeziehungen nicht jeden intensiven Kontakt zu Menschen außerhalb der Paarbeziehung. Bis auf wenige – umso erschreckendere – Ausnahmen setzen wir voraus, dass wichtige und wohltuende Beziehungen zu Bekannten, Freunden und Familienangehörigen auch dann akzeptiert werden, wenn der Partner diese Sympathien nicht teilen kann. Das daraus entstehende Konfliktpotential für die Beziehung ist in der Regel überschaubar.
Die im Folgenden diskutierten Nebenbeziehungsformen enthalten jedoch sozusagen automatisch liebesbeziehungsrelevante Aspekte und damit auch eine gewisse potentielle Sprengkraft. Wir betrachten nämlich in diesem Buch ausschließlich Begegnungen mit Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit, ihrem Alter und ihrer Attraktivität potentiell auch als Haupt-Partner infrage kämen (bzw. gekommen wären). Wir befassen uns nicht mit Kontakten, die aufgrund ihrer Kurzlebigkeit (One-Night-Stand) oder ihrer kommerziellen Einbettung bei uns nicht als Beziehungen durchgehen. Intensivere virtuelle (Chat-) Beziehungen halten wir allerdings angesichts der gewachsenen Bedeutung digitaler Kommunikationskanäle für durchaus relevant.
Gesellschaftliche Bewertungen
Eigentlich ist es seltsam: Dem Wunsch, eine Beziehung durch die nächste zu ersetzen und somit einen einstmals wertvollen und geliebten Menschen auszusondern, wird so viel mehr Toleranz und Sympathie entgegengebracht als dem Versuch, eine wichtige Beziehung auch dann zu erhalten, wenn ein weiterer Mensch emotionale oder erotische Bedeutung gewinnt. Warum steht das Wechselspiel der seriellen Monogamie auf einer so viel höheren moralischen Stufe als das Bemühen, die vorhanden Beziehung zu erhalten und einen Weg zu finden, den zusätzlichen Reichtum einer Nebenbeziehung in sein Leben zu integrieren?
„Dumme Frage“, werden die meisten denken – und gleichzeitig spüren, dass diese Perspektive wirklich ungewohnt ist und doch tatsächlich etwas irritiert: Könnte man denn tatsächlich auf die Idee kommen, das Eingehen einer Nebenbeziehung als Ausdruck einer moralisch-korrekten Tendenz zur Beziehungs-Erhaltung zu interpretieren?
„Wo kämen wir denn da hin?! Der Fremdgänger als Beziehungsretter?! Geht’s noch?!“
Warum reagieren wir an dieser Stelle emotional so heftig und einseitig? An welchen Selbstverständlichkeiten und Tabus wird da gerüttelt? Warum hat man das Gefühl, mit dieser Betrachtung gleich einen Erdrutsch auszulösen?
Es geht offenbar ans Eingemachte. Man stellt, wenn man die Nebenbeziehung als ernsthaftes Modell ins Gespräch bringt, u.a. folgende Kernsätze in Frage:
• Man kann nicht alles haben!
• Man kann nur einen Menschen lieben!
• Offene Beziehungsmodelle sind etwas für Hippies oder ausgeflippte Künstler!
• Solche Beziehungskisten verbreiten letztlich immer Unglück und Leid!
• Es gibt bei so etwas immer (mindestens) einen Verlierer!
• Liebe bedeutet immer auch Verzicht!
• Wenn man liebt, kann/will man diesen Menschen mit niemandem teilen!
• Das kann kein Mensch emotional aushalten!
• usw.
Auch wenn wir hier den Volksmund sprechen lassen, sind die entsprechenden Grundhaltungen keineswegs auf die Durchschnittsbevölkerung beschränkt. Die Botschaft, dass man scheitern wird und Unheil anrichtet, wenn man sich auf dieses gefährliche Terrain begibt, findet sich in unzähligen Büchern und Filmen und macht auch vor ernstgemeinter Ratgeber-Literatur nicht halt.
Können denn all diese Menschen tatsächlich irren? Warum befassen wir uns trotzdem so ausführlich mit diesem Thema?
Zwei Hauptgründe haben uns motiviert: Erstmal wollen wir dieses tatsächlich existierende gesellschaftliche Phänomen aus der Schmuddelecke herausholen und uns bei Tageslicht anschauen. Dann kann man einfach mehr erkennen und sich vielleicht auch selbst besser entscheiden – wie man bewertet und was man selbst tun will.
Zum anderen sind wir tatsächlich auch ganz persönlich davon überzeugt, dass es nicht sinnvoll und auch nicht besonders ethisch-vorbildlich ist, gleich mit der Abrissbirne vorzufahren, wenn man das Bedürfnis nach etwas Anreicherung hat oder schlichtweg ohne große Vorplanung in eine solche Situation gerät – in welcher Rolle auch immer.
Wir wollen dabei der traditionellen Perspektive kein neues Standardmodell entgegensetzen. Es geht hier nicht um einen Werbefeldzug für Nebenbeziehungen. Es geht uns um eine möglichst vorurteilsfreie Betrachtung dieses Phänomens.
Dabei werden Sie bei uns keine Wertfreiheit finden. Beziehungen haben unserer Meinung nach immer auch etwas mit Verantwortung zu tun. Wir wollen auch keine Beliebigkeit propagieren. So sprechen wir grundsätzlich von der Nebenbeziehung nur in der Einzahl. Bedeutsamere Beziehungen zu andern Menschen (so wie wir sie hier verstehen) kann man nicht beliebig anhäufen – insbesondere, wenn mindestens eine davon eine echte Liebesbeziehung ist. Wer meint, er könnte z.B. gleich drei oder vier Parallel-Liebesbeziehungen führen, der sollte sich in der nächsten Buchhandlung andere Literatur besorgen.
Noch ein Wort zu offenen Beziehungsmodellen, die sich ganz offiziell und einvernehmlich von gängigen Treue-Konzepten verabschiedet haben. Wir haben nichts gegen solche Arrangements – und da, wo sie funktionieren, sind sie sicher nützlich und richtig. In unserem Buch gehen wir aber von einem starken und grundsätzlichen Bedürfnis nach Exklusivität in Liebesbeziehungen aus und halten damit auch Ambivalenzen, Widersprüche und Konflikte im Kontext von Nebenbeziehungen für unvermeidbar.
Unsere Skepsis und Abgrenzung gilt auch der modernen Spielart der offenen Beziehung, die seit einiger Zeit unter dem Begriff Polyamorie durch die Medien geistert. Ob sie tatsächlich ein gesellschaftlich relevanter Trend oder eher ein Medien-Hype, vermögen wir nicht zu entscheiden.
Wir möchten niemanden ausgrenzen. Wir machen nur darauf aufmerksam, dass wir uns in diesem Buch mit Themen befassen, die ein überzeugter Vertreter offener Konzepte eigentlich längst hinter sich gelassen haben müsste. Falls Sie Ihre Beziehungen so leben und sich trotzdem auf dieses Buch einlassen, würde uns tatsächlich sehr interessieren, wie es Ihnen damit ergeht.
Genug der Vorrede. Wir wollen jetzt in den Beziehungsreichtum der Nebenbeziehungen eintauchen und laden Sie unter dieser speziellen Perspektive zu diesen Fragen ein: „Wie beziehungsreich ist mein Leben?“ Oder: „Welchen zusätzlichen Reichtum halte ich für denkbar, wünschenswert oder im Einzelfall sogar für notwendig?“
Unsere Reiseroute
Vorweg eine gute Nachricht: Sie reisen nicht alleine! Unser fiktives Beispielpaar (Rainer und Tanja) wird Sie über alle Stationen begleiten und Sie insbesondere bei den Selbstanalyse-Tools unterstützen. So wird sehr schnell nachvollziehbar werden, wie die Auswertungen funktionieren und welche Schlussfolgerungen die jeweiligen Ergebnisse ermöglichen.
Wir wollen im Kern der bestehenden Beziehung starten und gucken uns daher zunächst die Kräfte an, die ein Paar zusammenhalten und gegenüber der Außenwelt schützen und abgrenzen. Um es auf unser Thema zu beziehen: Es geht um die (guten) Gründe, die für das Ziehen von klaren Grenzen um das Paarsystem und damit auch gegen das Eingehen einer Nebenbeziehung sprechen.
Wir beginnen unsere Betrachtungen bei dem Bestreben nach Exklusivität: Was bedeutet das Bedürfnis bzw. die Forderung, bestimmte (Er-)Lebensbereiche exklusiv seiner Liebesbeziehung zuzuordnen? Welche Entwicklungsmöglichkeiten oder Ausnahmen lässt das Konzept der Exklusivität zu? Wie sieht in diesem Bereich Ihre persönliche Haltung aus? Und vor allem: Was erwartet Ihr Partner?
Eng verbunden mit dem Prinzip der Ausschließlichkeit sind einige andere traditionelle Erwartungen und Normen, auf deren Hintergrund die meisten Liebesbeziehungen eingegangen und gelebt werden. Wir laden Sie ein, Ihre Einstellung in diesen Fragen in einem Selbsttest zu erkunden. Die Ergebnisse werden wir – so wie bei allen anderen Selbstanalyse-Tools auch – später noch nutzen.
Aber Beziehungen haben natürlich auch eine inhärente emotionale Bindungskraft, die mit dazu beiträgt, dass die Grenzen nach außen – zu anderen (potentiell) bedeutsamen Personen – in der Regel klar definiert sind. Auch die Ausprägung dieses Faktors werden wir uns anschauen.
An dieser Stelle verändern wir die Perspektive schrittweise in Richtung der Faktoren, die uns auch innerhalb einer Liebesbeziehung als Einzelpersonen fühlen und handeln lassen – was oft auch eine partielle Öffnung von Beziehungsgrenzen zur Folge hat.
Zunächst schauen wir, ob Aspekte der aktuell empfundenen Beziehungsqualität dazu führen könnten, die heimelige Paar-Innigkeit etwas zu relativieren: Gibt es bei Ihnen Punkte einer eher unspezifischen Unzufriedenheit, die der oben diskutierten Bindungskraft entgegenwirken könnten?
Mit dem Blick auf das (unterschiedlich ausgeprägte) Bedürfnis nach Autonomie innerhalb der Paarbeziehung, nähern wir uns ganz allmählich einem Bereich, den man sowohl als Basis-Thema für jede Partnerschaft wie auch als Grundlage für ein weitergehendes Interesse an Außenkontakten betrachten kann.
Spezifischer und gründlicher analysieren wir diese soziale Autonomie mithilfe unseres Konzeptes der Schwebe-Neigung: dem Bedürfnis von Menschen, sich in anregende (flirtige) Begegnungen mit anderen relevanten Menschen einzubringen und diese Kontakte als Teil der eigenen Identität zu pflegen. Wie immer ermöglichen wir Ihnen einen Blick auf Ihre eigene Ausgangslage.
Im nächsten Schritt werden wir dann die betrachteten Einzelkräfte zusammenführen und ein Modell entwickeln, in dem die Gesamtbilanz der Kräfte zu einer Position zwischen zwei gegenüberliegenden Polen führt: Zwischen der Basisbeziehung und einem (potentiellen) Nebenbeziehungspartner. Konkret auf Sie bezogen: Wir wagen – mithilfe der von Ihnen gelieferten Ergebnisse der Fragebogen – eine (grobe!) Aussage, wie weit Sie möglicherweise schon für einen bedeutsamen Anderen (einen Außenreiz) erreichbar wären. Haben Sie den (relativ) sicheren Beziehungsraum vielleicht schon ein stückweit verlassen?
Bei all dem, was nun passiert (oder nicht passiert) spielt das konkrete Gegenüber, der Außenreiz, naturgemäß eine entscheidende Rolle. Wir betrachten einige Aspekte der Wechselwirkung zwischen den beiden Personen, insbesondere den Aspekt ihrer Passung. Wenn an dieser Stelle die Signale auf GO stehen, dann kann es tatsächlich zu einer Nebenbeziehung kommen.
Doch wir wollen noch konkreter werden: Das Interesse an Kontakten zu einem Anderen kann ja ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Wir wollen deshalb auch schon einmal hineinspüren, welche Vorlieben oder Neigungen Sie in potentielle Begegnungen miteinbringen. Sind Sie überhaupt der Typ für eine Neben-Beziehung – und wenn ja: für welche Art?
Man glaubt es kaum: Wir sind dann (endlich) am Kernpunkt unseres Buches angekommen!
Wenn Sie die von uns vorgeschlagenen Selbst-Tests durchgeführt und ausgewertet haben (auch online möglich), können wir Sie als einen Leser mit in unsere Nebenbeziehungs-Welt mitnehmen, der über seine eigenen Voraussetzungen und Motive schon eine Menge weiß.
Im Folgenden liegt der Schwerpunkt unserer Ausführungen darin, die unterschiedlichen Formen von Nebenbeziehungen genauer zu analysieren. Auf was lässt man sich tatsächlich ein, wenn man eine Affäre beginnt? Was mutet man seinem Partner zu, wenn man tatsächlich eine echte zweite Liebesbeziehung führt? Gibt es auch harmlose Varianten solcher Zusatz-Beziehungen? Wie fühlt man sich als drittes Rad am Fahrrad?
Da uns ein systematisches Vorgehen liegt, werden wir jede Beziehungsform immer aus der Perspektive aller beteiligten Personen anschauen. Dabei werden unser Verständnis und unsere Empathie unparteiisch in alle Richtungen verteilt sein – was aber keineswegs bedeutet, dass wir Menschen von jeglicher Verantwortung für ihr Tun freisprechen. Ganz im Gegenteil: Als Konsequenz der Bewusstmachung der Perspektiven und Emotionen aller Beteiligter versprechen wir uns eher verantwortungsvolle Entscheidungen als durch das Nachplappern bekannter Verbote. Daher werden wir nicht die sonst überall lauernde Moral-Keule schwingen. Damit würden wir Sie und uns nur langweilen.
Um nochmals zu unterstreichen, dass auch unserer Überzeugung nach das Verhalten innerhalb von Beziehungen nicht in einem moralischen bzw. ethischen Freiraum stattfindet, beenden wir unser Buch mit einem ausführlichen Dialog der beiden Autoren über genau diese Aspekte: Gibt es akzeptable Wege, den Konflikt zwischen persönlicher Bedürfnislage und Verantwortung gegenüber der Beziehung zu lösen?
Bevor es losgeht
Vielleicht haben Sie ein grundsätzliches Problem mit der Bezeichnung Nebenbeziehung. Das kann zwei – für uns gut nachvollziehbare – Gründe haben:
Es kann einmal sein, dass Sie überhaupt keine Rangfolge bilden können oder wollen oder sich vielleicht sogar die Bedeutungszuschreibung so verändert hat, dass die Zweitbeziehung zur Hauptbeziehung geworden ist.
Der andere Grund kann in Ihrem Platz im Beziehungssystem begründet sein: Als Nebenbeziehungspartner haben Sie vielleicht gar keine andere Beziehung; diese Beziehung ist Ihre Beziehung, also auch automatisch Ihre Hauptbeziehung.
Wir verstehen Sie! Mit Nebenbeziehung meinen wir eine Zweit- oder Zusatzbeziehung, die Sie zu einem Zeitpunkt eingegangen sind, an dem schon eine auf Dauer angelegte Beziehung bestand. Eine Bedeutungsrangfolge meinen wir damit nicht (auch wenn diese in den meisten hier diskutierten Fällen zumindest naheliegt).
Als Partner ohne eine weitere Beziehung behalten wir Sie in diesem Buch im Auge – versprochen! Wir bitten Sie aber um Verständnis dafür, dass die vielfältigen Konflikte und Ambivalenzen auf der Seite Ihres doppelt gebundenen Gegenübers eine besondere Aufmerksamkeit erfahren.
Wir haben uns bzgl. der Gender-Frage für ein konservatives sprachliches Modell entschieden und halten das sehr konsequent durch. Wir schreiben grundsätzlich in der männlichen Form, die wir aber – wie es immer noch (als generisches Maskulinum) gebräuchlich ist – neutral bzw. umfassend meinen. Wir sprechen z.B. immer vom Partner, auch wenn genauso die Partnerin gemeint ist. Das ist für viele Menschen ein harter Brocken. Sorry!
Für uns hätte sich ein nur schwer verträgliches Sprach-Kauderwelsch ergeben, wenn wir in jedem Satz beide Varianten (mit den entsprechenden Pronomina) ausformuliert oder moderne Wort-Neubildungen (Partner: innen, Partner*innen) benutzt hätten. Wir lieben eben auch Sprache, und ein gut lesbarer Text erschien uns wichtiger als die politische Korrektheit in diesem Punkt.
Wir kennen uns nur mit heterosexuellen Beziehungen und binären Geschlechtsidentitäten aus, halten es aber für naheliegend, dass viele in diesem Buch angestellten Überlegungen auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen Bedeutung haben könnten. Wenn wir zwischendurch mal vom gegengeschlechtlichen Gegenüber sprechen, ist das nicht als Ausschluss gemeint; wir meinen jeweils das partnerschaftsrelevante Geschlecht.
Unsere Fragebogen, auch Selbstanalyse-Tools genannt, sind keine wissenschaftlich entwickelten und normierten Verfahren. Sie – und unsere Anmerkungen zu Ihren Ergebnissen – haben keinen weiteren Anspruch, als Ihnen eine grobe Rückmeldung zu Ihrer Verortung auf der jeweils besprochenen Dimension zu geben. Sie wollen und können keine fachlichen Diagnosen sein, sondern sollen Denkanstöße geben und Ausgangspunkt für weitere Fragen und Gespräche schaffen. Nehmen Sie die Ergebnisse also bitte nicht so bierernst; im Zweifelsfall kennen Sie sich besser als der Fragebogen.
Es erscheint uns naheliegend zu sein, dass Sie dieses Buch in einem geschützten Raum durcharbeiten: Sie würden Ihre Erkenntnisse über sich deutlich schmälern, wenn Ihre Antworten sich nach den Erwartungen Ihres Partners ausrichten würden.
An einigen Stellen des Textes tauchen Bezüge zu den beiden anderen Publikationen auf, die wir zum Thema Beziehungen verfasst haben. Die dort angebotenen Anregungen, Perspektiven und Selbstanalyse-Tools können die Breite und Tiefe des Zugangs zum Thema Beziehungen erweitern. Natürlich ist aber dieser Text hier ohne die Kenntnis dieser Ausführungen aus sich heraus verständlich.
Im Band I (Identität in Beziehung leben– Wer ich in meiner Partnerschaft sein und werden kann) geht es zunächst um eine Erkundung der eigenen Persönlichkeit, nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. In weiteren Verlauf schauen wir uns dann an, welche Resonanz Sie auf die verschiedenen Facetten Ihrer Identität erhalten und wie die gegenseitige Einflussnahme beschaffen ist. Zuletzt machen wir Ihnen eine Reihe von Vorschlägen, wie Sie das Zusammenspiel von Identität und Beziehung noch verbessern könnten.
Im zweiten Band ( Beziehungsglück tanken – Wie wir unser Paar-Substrat vermehren und schützen können) analysieren wir, aus welchen Quellen Zufriedenheit in Ihren persönlichen Beziehungs-Tank fließen. Wie man dieses kostbare Substrat im Alltag pflegt und vermehrt, wird ausführlich besprochen; dabei berücksichtigen wir einige wichtige Aspekte Ihrer Persönlichkeit und liefern ganz konkrete Strategien.
Sollten bei Ihnen Zweifel bestehen, ob die Potentiale Ihrer Basisbeziehung wirklich schon ganz ausgereizt sind, wäre es vielleicht keine schlechte Idee, die beiden Bücher vor einer endgültigen Entscheidung hinsichtlich einer ersthaften Nebenbeziehung zu lesen.
Zusätzliche Online-Angebote
Auf beziehungsreich-online.de finden Sie jede Menge Nützliches und Interessantes zu diesem Buch und zu unserer Reihe:
• Alle Fragebogen-Tests zur Durchführung am Smartphone, Tablet oder Laptop (inklusive sekundenschneller grafischer Auswertung; Zugangscode s. letzte Seite)
• Alle benutzen Tabellen und Grafiken für Sie zum (kostenlosen) Download
• Informationen über unser Angebot für eine individuelle Gesamt-Interpretation Ihrer Ergebnisse
• Unser Forum zum Austausch mit uns und anderen Leser/innen
• Informationen zu unseren anderen Büchern
• Aktuelles rund um die Themen unserer Reihe BeziehungsReich
Schauen Sie am besten gleich mal vorbei!
II. Beziehungs-Grenzen
Sie werden vielleicht staunen, wie viel Raum wir in diesem Buch der Basisbeziehung und dem Prozess geben, der uns (oder vielleicht unseren Partner) in Richtung Nebenbeziehung führen könnte. Der Grund dafür ist, dass wir auf die Komplexität dieser Dynamik hinweisen wollen, auf die innewohnenden Ambivalenzen und Widersprüche. Wir wollen einen Gegenentwurf zum Klischee des notorischen Fremdgängers bzw. zu den locker-flockigen Seitensprung-Ratgebern anbieten, in denen scheinbar das einzige ernsthafte Problem in der erfolgreichen Verheimlichung gesehen wird. Wir wollen Menschen ansprechen und erreichen, denen Beziehungen wertvoll sind und die sich daher um einen verantwortlichen Umgang mit diesen bemühen.
Wenn die Ausgangsbeziehung Ihnen nicht am Herzen liegen würde, dann hätten Sie jetzt vermutlich kein Buch über Nebenbeziehungen in der Hand, sondern vielleicht einen Trennungs-Ratgeber oder eine Dating-App.
Da wir über Nebenbeziehungen schreiben, gehen wir von einer Hauptbeziehung aus. Ohne das Bestehen einer – auf Dauer angelegten – Ausgangsbeziehung würde sich ein Großteil der in diesem Buch angestellten Überlegungen schlicht erübrigen. Die Nebenbeziehung ist sozusagen das fokussierte Motiv, das sich auf dem Hintergrund der Basisbeziehung abhebt.
Auch diese Ausgangsbeziehung grenzt sich ab – von den sie umgebenden Nicht-Beziehungen - also von einem unverbindlichen Nebeneinander in Bekanntschaft, Nachbarschaft oder im beruflichen Kontext. Noch stärker als bei anderen Beziehungsformen sind die Grenzen um eine Liebesbeziehung oder eine Paarbeziehung nach innen und außen markiert und deutlich spürbar.
Da die Thematik dieses Buches von dem Spannungsfeld zwischen Haupt- und Nebenbeziehung lebt, halten wir es für sinnvoll, sich zunächst mit der Ausgangslage zu beschäftigen. Bevor wir uns dem möglichen Öffnen von Beziehungsgrenzen widmen, wollen wir uns anschauen, warum es eigentlich diese Grenzen vorher gibt bzw. gab.
A. Gründe für geschlossene Grenzen
Vielleicht wundern Sie sich über diese Überschrift. Muss man wirklich erklären, Gründe anführen, warum man eine intime Beziehung gegenüber der Außenwelt abgrenzt?
Sie haben völlig recht! Mit dem Eingehen einer Liebesbeziehung macht man nach innen und nach außen unmissverständlich klar, dass sich diese Verbindung zwischen zwei Menschen von anderen sozialen Kontakten unterscheidet. Eine Grenzziehung um diese Paar-Einheit herum ist sozusagen in die Begrifflichkeit – und fast immer auch in die Lebenswirklichkeit – schon eingebaut.
Wir wollen in diesem Kapitel über diese Selbstverständlichkeit ein wenig hinausgehen und uns einige der Faktoren, die dem Bedürfnis nach einer klaren Grenzziehung zu Grunde liegen, genauer anschauen.
Wir starten mit dem Konzept der Exklusivität, das wohl das stärkste Bollwerk gegen eine Öffnung der Grenzen rund um das Paar-System darstellt. Darüber hinaus gibt es aber noch andere Regeln und Erwartungen, die insgesamt darauf ausgerichtet sind, die bestehende Beziehung zu festigen und zu schützen; wir nennen sie Beziehungs-Normen.
Keineswegs vergessen wollen wir die bindende Kraft der Emotionen und der gemeinsamen Welt: Schließlich sollte die gefühlte Gewissheit, fest in der Beziehung und beim Partner verankert zu sein, ja der wichtigste Grund für die nach außen geschlossenen Grenzen sein. Unser Name dafür: Beziehungs-Bindung.
Wir halten die Betrachtung dieser Faktoren übrigens nicht nur für die Beteiligten interessant, die Teil dieser Ausgangsbeziehung sind. Auch wenn ein Nebenbeziehungspartner selbst gerade als Single leben sollte, kann ein Einblick in die Dynamiken des Beziehungs-Zusammenhalts wertvolle Erkenntnisse liefern – kann er doch dann die lebhaften und häufig belastenden Konflikte auf der anderen Seite besser verstehen. Spätestens wenn die mit ihm gelebte Nebenbeziehung selbst zu einem stabilen und schützenswerten Gut geworden ist, werden ihm die Kräfte des Beziehungsschutzes durch Grenzziehung vielleicht auf einmal auch persönlich sehr wertvoll erscheinen.
1. Exklusivität
Wir beginnen die Reise am Ausgangspunkt. Das ist in der Logik dieses Buches eine vorhandene Beziehung mit einem bestimmten – schwächer oder stärker ausgeprägten – Anspruch an gegenseitiger Exklusivität. Da jede Nebenbeziehung solche Erwartungen zumindest in Teilbereichen in Frage stellt, also Exklusivität bedroht, wollen wir uns den Startpunkt etwas genauer anschauen. Denn auch wenn man neue Wege gehen möchte (oder muss), sollte man wissen, woher man kommt.
Die böse Eifersucht
Neben den moralischen Leitlinien sind es in erster Linie eifersüchtige Gefühle, die eine neutrale Sicht auf das Phänomen der Nebenbeziehungen so erschweren.
Eifersucht ist ein hässliches Wort. Schon die beiden Bestandteile vermitteln ungute Assoziationen: Eifer hört sich sofort nach Übereifer an, nach etwas Übertriebenem. Über Sucht braucht man gar nichts weiter zu sagen: Sie ist eine ausgewiesene menschliche Schwäche, ja sogar eine Krankheit; sie bedeutet Kontrollverlust und Maßlosigkeit. Man denke an den vielzitierten Satz: „Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.“
Aber unabhängig von der Begrifflichkeit hat Eifersucht als Gefühl inzwischen – unter halbwegs modernen Menschen – keine besonders gute Lobby. Eifersüchtig zu sein, ist zumindest ziemlich uncool; irgendwie altmodisch, spießig. Dieses Gefühl wird oft in Verbindung gebracht mit überkommenen Vorstellungen von Beziehungen, die mit Verboten, Besitzansprüchen und Beschränkungen einhergehen. Eifersucht wird sogar oft mit sehr realen Gefahren in Verbindung gebracht: Wer hätte noch nicht von einem Fall gehört oder gelesen, in dem jemand in rasender Eifersucht ganze Familien ausgelöscht hätte.
Kann man sich da noch trauen, eifersüchtig zu sein? Gehört das Wort nicht auf den Sprach-Müllhaufen?
Das Problem besteht nun allerdings darin, dass mit dem Begriff nicht gleichzeitig das dahintersteckende Empfinden zu entsorgen ist. Hört man sich im Bekannten- oder Freundeskreis mal genauer um, wird man auf verdächtige Spuren von Gefühlen stoßen, die zumindest dezent an die gute alte Eifersucht erinnern.
Ist die Eifersucht eventuell doch einer genaueren Betrachtung wert?
Wir meinen „Ja“, schlagen aber als Konsequenz der oben angestellten Überlegungen vor, den geschmähten Begriff zu ersetzen und stattdessen von einem Gefühl der bedrohten Exklusivität zu sprechen. Also dem Zustand, der sich einstellt, wenn es meinem Bedürfnis an den Kragen geht, für meinen Partner exklusiv und einzigartig bedeutsam zu sein. Diese Bedrohung wird in der Regel durch einen anderen Menschen ausgelöst – zumindest fühlt sich so etwas wie Eifersucht auf die Berufstätigkeit des Partners deutlich anders an.
Das Bedürfnis nach Exklusivität
Aber fangen wir mal am anderen Ende an: Bei dem Bedürfnis nach Exklusivität. Wenn man zunächst über etwas Vertrautes spricht, fällt es später vermutlich leichter, sich auch die andere Seite anzuschauen.
Wir alle wollen für wichtige andere Menschen besonders sein, nicht austauschbar, unverwechselbar. Dieses Bedürfnis geht über die Paarbeziehung hinaus. Auch für die Eltern will ein Kind am liebsten exklusiv sein und spürt Rivalität zum Geschwisterkind. Selbst für die eigenen Kinder will ein Vater, eine Mutter exklusiv sein und kennt vielleicht das Gefühl von Eifersucht in Bezug auf eine innige Beziehung des eigenen Kindes zur neuen Partnerin oder dem neuen Partner im Falle einer Trennung. Selbst unter Freundinnen gibt es im Kindes- und Jugendalter Eifersüchteleien.
Aber in unseren Überlegungen ist natürlich ausschließlich die Paarbeziehung gemeint. In diesem intimen Kontext wollen wir wirklich ausschließlich selbst gemeint sein, wenn ein geschätzter oder geliebter Mensch von uns spricht, Zeit mit uns verbringt oder seine erotischen Wünsche und Fantasien mit uns in Verbindung bringt. Unverwechselbar zu sein, schafft Identität und Bestätigung. Wir können kein Gefühl für die eigene Identität (für das, was uns im Innersten ausmacht) entwickeln, wir können nicht von unserem Wert als Person überzeugt sein, wenn wir nicht für wichtige andere eine exklusive Bedeutung haben. Etwas, was uns von allen anderen unterscheidet – wenigstens ein bisschen, wenigstens in Teilbereichen.
Jetzt könnte man es sich ganz einfach machen und sagen: „Da jeder Mensch ein Individuum ist, hat auch jede Beziehung ganz automatisch etwas ganz Exklusives, weil sie sich immer von jedem anderen Kontakt zwischen zwei Menschen unterscheidet!“ Das Bedürfnis scheint problemlos erfüllbar zu sein. Stimmt zwar irgendwie – reicht uns aber nicht!
Leider sind wir da in der Regel etwas anspruchsvoller. So richtig wichtig, besonders und einmalig, so wirklich bestätigt in unserem Wert, fühlen wir uns nämlich erst dann, wenn wir ganze Beziehungs-Bereiche für uns reserviert bekommen. Im radikalsten Sinne könnte das bedeuten: Mein Exklusivitätsbedürfnis ist erst dann gestillt, wenn ich sicher sein kann, überhaupt der einzige Mensch zu sein, mit dem mein Gegenüber eine Beziehung von relevanter Intensität pflegt. Nach dem Motto: „Wenn man doch glücklich verheiratet ist, braucht man keinen anderen nahen Menschen mehr, denn mein Ehepartner kann sowohl mein bester Freund, mein Geliebter, mein Vertrauter, als auch mein Freizeitpartner usw. für mich sein.“
Das mag im 21. Jahrhundert in unserem Kulturkreis ein wenig übertrieben klingen – aber ganz sicher sind wir nicht, ob Sie nicht auch in Ihrer Nachbarschaft noch ähnliche Idealvorstellungen antreffen würden. Unmittelbar einleuchtend ist sicherlich, dass ein solch extremes Exklusivitätsbedürfnis leicht erschütterbar wäre: Jeder, der – egal auf welchem Gebiet – eine bestimmte Wertigkeit für unseren Beziehungspartner gewinnen würde, wäre ein feindlicher Eindringling. Er würde uns Exklusivität streitig machen – oder: unser Exklusivitätsbedürfnis bedrohen.
Der zeitgenössische und aufgeklärte Mensch würde sich vermutlich eher einer solchen Aussage anschließen: „Ich bin so tolerant, dass ich es problemlos ertragen kann, wenn mein Partner bedeutsame, vertraute und intensive Beziehungen zu anderen Menschen hat.“ Denn wir alle wünschen und brauchen Anregungen von außen. Niemand muss allein dafür zuständig sein, alle Kontakt- und Aktivitätsbedürfnisse des andern zu befriedigen.
Ersetzt man aber den Begriff Mensch mit der eigenen Geschlechtsbezeichnung (die bei der sexuellen Orientierung des Partners offenbar relevant ist), fühlt sich die gleiche Aussage schon ganz anders an (bitte mal in der passenden Form innerlich mitsprechen): „Ich bin so tolerant, dass ich es problemlos ertragen kann, wenn meine Partnerin/mein Partner bedeutsame, vertraute und intensive Beziehungen zu anderen Männern/Frauen hat.“
Ups!
Scheinbar sind bei unserer Toleranz gegenüber anderen Beziehungen doch eher die Freunde und Freundinnen unseres Partners gemeint, die nicht dem interessanten und damit potentiell bedrohlichen Geschlecht angehören. Es macht scheinbar einen gravierenden Unterschied, durch wen und auf welchem Gebiet unsere Exklusivitätsbedürfnisse angekratzt werden.
Da es uns bei unseren Betrachtungen um Liebesbeziehungen geht, bleiben wir bei dieser Konstellation und stellen uns die Frage: Kann es überhaupt Beziehungen geben, die unter keinen Umständen durch einen befürchteten Exklusivitätsverlust bedroht wären? Das würde dann bedeuten, dass es in allen Aspekten und Ebenen des Beziehungslebens nicht nur legitim, sondern auch für alle Beteiligten unproblematisch wäre, den bisherigen Beziehungspartner durch einen Menschen des gleichen Geschlechts zu ergänzen oder gar – vielleicht zeitweise – zu ersetzen: im Bett, im Urlaub, beim Besuch einer Familienfeier, beim Gespräch mit dem Chefarzt nach einem lebensgefährlichen Unfall, beim Besuch der Messe am Heiligabend…
Gut – das mag sich fürchterlich übertrieben anhören – aber solche Zuspitzungen machen zumindest eines deutlich: Es geht bei dieser Frage nicht um „Ja“ oder „Nein“, sondern um Bereiche und unterschiedliche Ausprägungen eines letztlich unvermeidlichen und damit auch erlaubten Gefühls.
Wohin hat uns dieser Gedankengang geführt? Von einer ersten emotionalen Ablehnung des Begriffes Eifersucht als einer zu überwindenden menschlichen Gefühlsverirrung zu der Erkenntnis, dass es wohl in jeder denkbaren Liebesbeziehung Bereiche gibt, in denen der Verlust einer exklusiven Position sich gewöhnungsbedürftig, schmerzhaft, vielleicht sogar unerträglich anfühlen kann.
Gleichzeitig erleichtert der Verzicht auf den Eifersuchts-Begriff die Differenzierung: Während die Eifersucht meist als Global-Gefühl zuschlägt, lässt die Betrachtung von Exklusivitätsbedürfnissen Platz für Zwischentöne:
Welche Beziehungsebene ist individuell bedeutsamer als eine andere? Könnte ich zum Wohle des anderen auch auf etwas Exklusivität verzichten? Worauf kann ich unmöglich verzichten, weil ich sonst lieber gehen würde? Gibt es da keinerlei Spielraum? Auch nicht im langen Verlauf von Beziehung? Könnte ich vielleicht irgendwo Grenzen öffnen? Wie fühlt es sich an, wenn ich es mal versuche? Was passiert, wenn ich mal die Exklusivitätsgrenzen lockern möchte? Erschreckt mich der Gedanke, mein Partner würde dasselbe tun – oder auch nur wünschen?
Wollen Sie das Buch schon wütend in die Ecke werfen, weil Sie denken, dass wir verrückt sind? Bleiben Sie dran! Lassen Sie sich mal ein!
Wir hinterfragen kritisch und möglichst vorurteilsfrei Art, Umfang und Dauer des Bereichs, der traditioneller Weise ganz der Paarbeziehung gehört und nicht von außen gestört werden darf. Wir lösen uns mal von dem normativen Gedanken des AMEFI (ALLES MIT EINEM FÜR IMMER).
Sind damit alle Probleme gelöst? Natürlich nicht; jetzt wird es erst interessant!
Wir halten – wie gesagt – Bedrohungsgefühle für durchaus verständlich und legitim. Wir bezweifeln nur die alleinige Gültigkeit und den ausschließlichen Nutzen der drei vorgebahnten, scheinbar alternativlosen Umgehensweisen: sich entweder diesen Gefühlen des Partners vollständig anzupassen, die trotzdem vorhandenen Bedürfnisse heimlich auszuleben oder die Beziehung gleich zu beenden.
Nun führt natürlich nicht jede Einschränkung bei der Exklusivität zu dramatischen emotionalen Konflikten. Es gibt Toleranzbereiche und Zwischentöne, auch gesellschaftlich augenzwinkernd legitimierte Ausnahmesituationen – wie den Karneval, das Schützenfest, die Weihnachtsfeier oder die Kegeltour nach Mallorca.
Nichtsdestotrotz kommt es noch entschieden darauf an, wie ansprechbar Sie überhaupt für dieses Thema sind. Auf diese persönlichkeitsspezifische Neigung zu anregenden und flirtigen Außenkontakten, die wir auch gerne Schwebebedürfnis nennen, kommen wir später noch ausführlich zurück.
Natürlich ist die Exklusivität einer Beziehung nicht zu jeder Zeit gleich bedroht. Zu einem echten Konfliktpunkt für Beziehungen wird eine bedrohte Exklusivität vor allem dann, wenn
• die Beziehung sich noch in einem relativ frischen Zustand befindet und das Bedürfnis nach Nähe und Verschmelzung noch recht hoch ist,
• die subjektiv als zentral erlebten Bereiche von Exklusivitätsverlust bedroht sind (z.B. Erotik, Sexualität, intensive Emotionalität),
•