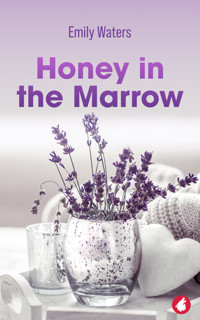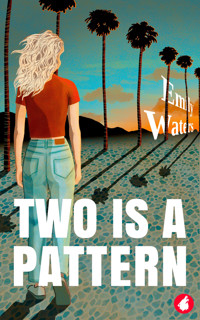Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Ylva VerlagHörbuch-Herausgeber: Klangkantine Audiobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Verlust zu Leidenschaft: Zwei Frauen entdecken das Glück neu. Als Stella Carters Mann im Dienst erschossen wird, steht sie plötzlich vor dem Nichts. Ihren Job als Staatsanwältin kann sie nicht mehr ausüben, Freunde hat sie sich nie erlaubt und die Trauer zieht sie in ein tiefes Loch. Die einzigen Lichtblicke in ihrem Leben sind ihre Nichte Addie, die kurzerhand bei ihr einzieht, und überraschenderweise Elizabeth Murphy, die Frau, mit der Stella jahrelang eine berufliche Hassliebe verbunden hat. Doch die sonst so eiskalte Elizabeth ist auf einmal gar nicht mehr distanziert. Und Stella sieht sich erneut mit Gefühlen konfrontiert, die sie eigentlich für die furchtbar heterosexuelle Elizabeth nicht haben dürfte … Was für Stella als langer Kampf zurück in ein erfülltes Leben begonnen hat, wird bald so viel mehr, als beide Frauen sich je hätten träumen lassen. "Bienen unter der Haut" wurde bei den GCLS Awards als bester Debutroman 2023 ausgezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Ebenfalls im Ylva Verlag erschienen
Über Emily Waters
Sie möchten keine Neuerscheinung verpassen?
Dann tragen Sie sich jetzt für unseren Newsletter ein!
www.ylva-verlag.de
Danksagung
Vielen Dank an Astrid, Lee Winter und das Ylva-Team, die sich in meine kleine Ecke des Internets verirrt und mich in ihre Mitte aufgenommen haben. Es war eine fantastische Reise mit euch. Danke an meinen Partner Jacob für die Unterstützung. Du hast mir die Zeit, den Raum, die Kraft und das Mobiliar gegeben, damit ich dieses Buch schreiben konnte. Und mein ganz besonderer Dank gilt Charity und Zowie, die mich mit einem nachdrücklichen »TU ES!« dazu ermutigt haben, dieses Buch zu veröffentlichen. Ich habe es getan.
Kapitel 1
Als Stella Carter aufwacht, greift sie direkt nach ihrem Handy. Zum ersten Mal seit Wochen hat sie das Gefühl, dass heute etwas von Bedeutung passiert. Die Sonne schickt ihre Strahlen über ihr Bett und Stella dreht sich auf die andere Seite. Ihre Haut fühlt sich unangenehm verschwitzt an. Sie hat seit Ewigkeiten Probleme beim Einschlafen und wenn sie es dann endlich tut, wacht sie erst wieder auf, wenn der Hunger sie spät am nächsten Tag aus dem Bett treibt.
Jetzt ist es beinahe Mittag und sie hat eine Nachricht von Addie.
Bis in ein paar Stunden!
Vielleicht ist man mit einundfünfzig ein bisschen alt, um sich eine Mitbewohnerin ins Haus zu holen. Aber als ihre Nichte sie drei Monate nach Rons Beerdigung angerufen und darum gebeten hat für eine Weile bei ihr wohnen zu dürfen, hat Stella sofort zugesagt. Addie will nach Kalifornien ziehen und Stella hat ein freies Gästezimmer. Außerdem ist ihr Ehemann tot und begraben und sie ist allein.
Vielleicht hatte Addie genau darauf abgezielt. Als Stella angeboten hatte, nach Nashville zu fliegen und mit ihr zusammen herzufahren, hatte sie allerdings abgelehnt. Stella bestand dann auch nicht weiter darauf, weil sie gar keine Lust auf den Trip hatte, und außerdem ist Addie dreiundzwanzig und durchaus in der Lage, die Strecke allein zurückzulegen.
Jetzt, wo ihre Nichte praktisch vor der Tür steht, schaut Stella sich mit ganz anderen Augen und zunehmender Verzweiflung in ihrem kleinen Bungalow um. Sie wohnt seit eineinhalb Monaten hier, aber es sieht aus, als wäre sie erst gestern eingezogen. Da sie nach Rons Tod nicht in der gemeinsamen Doppelhaushälfte bleiben wollte, nutzte sie das Geld aus seiner Lebensversicherung, um sich den Bungalow in ihrem alten Viertel zu kaufen. Sie hatte gehofft, vielleicht noch einmal von vorne anfangen zu können, als wäre sie gerade erst nach L.A. gezogen.
Als könnte sie die vergangenen acht Jahre ungeschehen machen.
Die letzten Monate waren furchtbar. Von einem Tag auf den anderen wurde sie von einer überaus erfolgreichen Juristin und stellvertretenden Staatsanwältin des Countys Los Angeles, die mit einem Deputy Chief des LAPD verheiratet war, zu seiner Witwe, die auf unbestimmte Zeit freigestellt war und nun durch die fünf Räume ihres neuen Zuhauses geistert.
Sie hatte das Haus für Addies Ankunft vorbereiten wollen, doch die Tage verstrichen und verschwammen ineinander, ohne dass sie aktiv wurde. Nach dem Monat, den sie sich aufgrund des Trauerfalls freigenommen hatte, entschied sie spontan, nicht zur Staatsanwaltschaft zurückzukehren. Auch ein Teil ihres Neuanfangs. Sie will die alte Stella Carter sein, eine andere Stella Carter. Die, die sie vor ihrer Ehe war, bevor sie eine vielversprechende Anwaltskarriere wegwarf und Nashville zugunsten des sonnigen Südkaliforniens verließ – alles nur, um von ihrer Familie wegzukommen.
Das war das Mutigste gewesen, was sie je getan hatte. Aber nach ihrer Ankunft in L.A. hatte man sie einem Team von Detectives der Mordermittlung zugeteilt, die ihr die schlimmsten Gesichter der Stadt zeigten: Vergewaltigungen, Morde, die zwielichtige Kehrseite der Unterhaltungsindustrie. Menschen mit Geld, die sich für unantastbar hielten.
Aber was sie eigentlich zurückhaben will, ist ihr Leben, bevor sie diese verfluchte Frau kennengelernt hat: Captain Murphy. Sie schließt die Augen und schüttelt den Kopf. Darüber wird sie jetzt nicht weiter nachdenken.
Ihr Bungalow wurde in den 1930er-Jahren gebaut und dementsprechend klein sind die Räume. Obwohl sie vor dem Umzug die meisten ihrer Habseligkeiten losgeworden ist, fühlt ihr neues Zuhause sich trotzdem vollgestopft an. Addie kommt in dem kleineren Schlafzimmer unter und während der Kaffee durch die Maschine läuft, wirft Stella einen Blick auf die aufgestapelten Kartons und Müllsäcke. Sie sollte sie auspacken, den Raum vorbereiten, aber im Moment ist ihr das alles zu viel und sie schafft es einfach nicht, das allein anzugehen.
Nichts scheint mehr wie früher zu funktionieren.
Addie trifft am frühen Nachmittag ein und trotz der vier Tage, die sie quer durchs Land gefahren ist, wirkt sie ausgeruht und entspannt. In ihren schulterlangen, blond gefärbten Haaren zeigt sich der hellbraune Ansatz ihrer natürlichen Farbe.
Stella macht einen kleinen Rundgang mit ihr und lauscht ihrem fröhlichen Geplapper. Addies Auto ist bis auf den letzten Zentimeter vollgepackt, aber sie braucht nicht einmal eine Stunde, um ihre Koffer und Kisten ins Haus zu verfrachten. Stella ist schon vom bloßen Zusehen erschöpft.
»Ich lege mich mal für eine Weile hin.«
Addie nickt. »Klar. Ich mache das hier schon.«
Innerhalb der ersten Woche schafft Addie es, Stellas Bücher – inklusive denen, die Stella noch nicht ausgepackt hatte – nach Farbe in die dafür vorgesehenen Einbauregale zu sortieren. Der Regenbogen aus Buchrücken lenkt von dem blätternden Lack des Holzes ab.
Dann fotografiert Addie ihr Werk aus verschiedenen Perspektiven. »Für Instagram«, erklärt sie.
Als wenn Stella damit etwas anfangen könnte.
Dann holt Addie einen Teil der Möbel aus der Garage ins Wohnzimmer. Innerhalb kürzester Zeit fühlt sich das Haus an, als würde tatsächlich jemand darin leben.
Innerhalb von drei Wochen hat Addie einen Job als Barkeeperin, instruiert Stella jedoch, dass sie ihren Eltern gegenüber von einem Kellnerjob sprechen soll. Stella ist es prinzipiell egal, ob Addie hinter der Bar steht – man verdient dort besser –, aber sie will auch nicht, dass ihre Nichte blauäugig in einer Kaschemme arbeitet, wo Straftaten wahrscheinlicher sind. Leute, die in solchen Läden verkehren, hat Stella jahrelang hinter Gitter gebracht.
Aber Addie versichert ihr, dass Casey’s einfach nur ein Irish Pub ist.
»Das ist eine Cop-Bar«, sagt Stella.
»Ach ja?«, fragt Addie betont unschuldig.
Casey’s befindet sich in fußläufiger Reichweite des Verwaltungsgebäudes der Polizei und der Büros der Staatsanwaltschaft. Im Laufe ihres Berufslebens hat Stella sich dort mehr als nur ein paar Gläser Wein genehmigt. Der Laden ist nicht wirklich ihr Ding, aber die Detectives vom Morddezernat, mit denen sie gearbeitet hat, mochten die Bar.
»Was soll mir schon in einer Bar voller Cops passieren?«, will Addie wissen.
Stella sieht ihr durchdringend in die Augen. »Vielleicht sollte ich da auch anfangen«, scherzt sie, doch es klingt eher bitter. Sie muss sich langsam klar werden, was sie mit ihrem Leben anfangen will. Bis jetzt wartet sie noch darauf, dass ihr etwas in den Schoß fällt oder dass jemand sie rettet.
»Lass uns shoppen gehen«, schlägt Addie vor und wechselt damit das Thema.
Shopping-Therapie. »Okay.«
Sie lässt Addie den Hybrid fahren, den sie sich ein Jahr nach ihrer Beförderung zur stellvertretenden Staatsanwältin gekauft hat. Rons neuerer SUV steht nach wie vor in der Einzelgarage.
Als sie auf den Parkplatz einbiegen, sagt Stella: »Hey, willst du Onkel Rons Auto haben?«
Addie wirft ihr einen Seitenblick zu. »Was?«
»Es ist erst ein paar Jahre alt«, meint sie. »In echt gutem Zustand. Und es steht einfach nur rum.«
»Ich habe ein Auto.«
»Du könntest deins verkaufen.« Stella starrt auf das leuchtende, rote Logo an der Vorderseite des Ladens. »Ich könnte wahrscheinlich auch Rons verkaufen, aber es wäre wohl sinnvoller, das zu behalten, das weniger Kilometer hat.« Sie schaut wieder zu Addie. »Abgesehen davon kenne ich mich mit Autos nicht aus.«
»Vielleicht. Lass mich drüber nachdenken.«
Mit einem Einkaufswagen bewaffnet folgt Stella ihrer Nichte durch das riesige Geschäft. Addie hat eine Liste auf ihrem Handy, aber es landen auch Dinge im Wagen, die wohl eher Spontankäufe sind: eine Kerze mit Piña-Colada-Duft, eine pinke Tasse, auf der in verschnörkelter, rotgoldener Schrift Hallo, Schönheit steht, und ein Set mit drei Schneidebrettern aus Holz. Außerdem kauft sie ein Fünfundzwanziger-Paket samtbezogener Kleiderbügel und einen Plastikwäschekorb.
Stella zieht sich im Moment immer in der Waschküche um und nutzt die Waschmaschine als Wäschekorb. Nicht besonders erbaulich, aber effizient.
Auf dem Weg zur Kasse durchqueren sie die Bekleidungsabteilung. Addie nimmt hier drei schwarze Jeans und ein paar schwarze Tanktops mit.
»Gott, wer ist denn gestorben?«, entfährt es Stella.
Sofort fühlt sie sich dumm und der Schmerz ist wieder da.
Zu Rons Beerdigung hat Addie ein dunkelgrünes Kleid getragen, was ein winziges bisschen Farbe in den ansonsten grauen Tag gebracht hat. Stella erinnert sich noch gut an das grüne Kleid, die gelben Blumen auf dem Sarg, Captain Murphys lange rotbraune Haare, die sie hochgesteckt getragen hat, weil sie in Uniform erschienen ist. Einer von Stellas Lippenstiften ist ihr in der Handtasche aufgegangen und hat Flecken auf dem Innenfutter hinterlassen, weswegen sie die Tasche wegwerfen musste. Dann hat sie angefangen, andere Sachen wegzuwerfen und sich für den Umzug entschieden.
»Das ist meine Arbeitskleidung in der Bar«, murmelt Addie. »Gehen wir.«
Zurück im Auto bestellt Stella ihnen Pizza. Nachdem sie aufgelegt hat, fragt sie: »Wie bist du eigentlich auf Casey’s gekommen?«
»Wie kommt irgendwer auf irgendwas?«
»Ist das eine rhetorische Frage?«, entgegnet Stella schärfer.
»Ich habe den Pub im Internet gefunden«, antwortet Addie. »Ich kann mir auch woanders einen Job suchen, wenn es dich so sehr stört.«
»Es stört mich nicht. Ich hatte nur vergessen, wie klein die Welt sein kann.«
Später isst Stella ein Stück Pizza im Stehen in der Küche, während Addie in ihrem Zimmer telefoniert. In diesem Haus gibt es kaum Geheimnisse. Es ist schlecht gedämmt und außerdem hat Addie ihre Tür nicht zugemacht.
»Keine Ahnung. Ich habe noch nicht angefangen.« Addie wühlt in ihren Shopping-Tüten. Eine Pause. »Alles in Ordnung. Das Haus ist echt gemütlich und wir gewöhnen uns aneinander.«
Stella lauscht angestrengt, was ihre Schwägerin – Addies Mutter – am anderen Ende erwidert, aber natürlich hört sie nichts.
»Ja«, sagt Addie. »Ich meine, total depressiv, aber wärst du das nicht?«
Stella tunkt ihren Pizzarand in Ranch-Dressing, von dem etwas auf dem Weg zum Mund auf ihrem Shirt landet.
»Sie tut einfach gar nichts. Ich glaube, sie würde sich besser fühlen, wenn ich sie dazu bringen könnte irgendwas zu machen … Keine Ahnung. So lange bin ich ja noch nicht hier.«
Stella geht auf, dass Addie vermutlich über sie spricht. Ist sie depressiv?
Sie schaut auf den hellen Fleck auf ihrem Shirt, die dreckige Küche, den halb leeren Pizzakarton von heute, der auf dem leeren Pizzakarton von vor zwei Tagen steht.
Sie ist einfach nur faul. Das war sie schon immer und jetzt ist Ron nicht mehr da, um sie aus ihrem Tran zu reißen. Ron ist nicht mehr da, weil jemand ins Polizeiverwaltungsgebäude eingedrungen ist und ihn einfach so erschossen hat. Jetzt ist er tot. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Sie ist nicht depressiv. Sie ist einundfünfzig und noch genauso unorganisiert, wie sie es mit vierzig, dreiunddreißig und siebzehn war. Aber es geht ihr gut und sie kann noch mal von vorne anfangen.
Stella wischt sich mit dem Handrücken erst über den Mund und ihn dann am Saum ihres Shirts ab, bevor sie es sich auszieht und in die Waschmaschine steckt.
Sie schläft in BH und Jogginghose ein. Der Ventilator in ihrem Schlafzimmer quietscht leise.
* * *
Addie ist tagsüber viel zu Hause, schläft dann aber die meiste Zeit. Stella oft auch. Sie versucht, das Haus zumindest einmal am Tag zu verlassen, schafft aber manchmal nur einen kurzen Spaziergang um den Block oder fährt in den nächsten Drugstore, um Shampoo, Rasierklingen oder Schokolade zu besorgen. Hauptsächlich Schokolade. Die Kassierer kennen sie inzwischen schon.
Dieses Mal hat sie eine Tüte Mini-Schokoriegel und eine Avocado-Gesichtsmaske dabei. Addie steht vor der Kaffeemaschine. Sie trägt Baumwollshorts und ein graues Tanktop. Ihre Haare hat sie zu einem unordentlichen Knoten zusammengebunden.
»Hey, Schätzchen.« Stella schiebt ihre Sonnenbrille nach oben.
»Hey.« Addie gähnt und holt sich eine Tasse aus der Spülmaschine.
»Wie war die Arbeit?«
»Nicht viel los. Ich bin immer noch an der Zapfstation. Wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich Cocktails mixen darf.« Addie ist die neueste Mitarbeiterin, also zapft sie hauptsächlich Bier und räumt Tische ab. »Du könntest es dir ja mal anschauen.«
»Ich kenne die Bar«, meint Stella.
»Nicht, während ich dahinterstehe«, sagt Addie. »Ich habe dich auch schon auf der Arbeit besucht.«
Daran erinnert Stella sich noch gut. Mit sechzehn hat Addie eine Woche bei ihnen in Kalifornien damit verbracht, in Gerichtssälen zu sitzen oder wahlweise in Stellas Büro oder mit Ron abzuhängen, der ihr ein paar Touristenattraktionen zeigte, bevor Addie das Interesse am Sightseeing verlor. Stella hat ihre Nichte immer geliebt, aber ihr ist diese erwachsene, unabhängige Version von Addie deutlich lieber als der schmollende Teenager mit dem dick aufgetragenen, schwarzen Kajal und den unzähligen Gummiarmbändern von damals.
»Du könntest heute Abend doch mal vorbeikommen«, schlägt Addie vor. »Es ist Donnerstag, da ist es immer ziemlich ruhig.«
»Honey …« Plötzlich ist Stella unglaublich müde und will nie wieder etwas anderes tun, als in Jogginghose Süßigkeiten zu essen.
»Drinks gehen aufs Haus«, fügt Addie noch hinzu. »Wir haben diesen Wein von Markham Vineyards, den du so gerne magst.« Die Kaffeemaschine piept und Addie rührt einen Schluck Mandelmilch und ein Päckchen Süßstoff hinein, bevor sie einen Schluck trinkt. »Oh mein Gott, schmeckt das gut.«
»Ich könnte vielleicht kurz mal reinschauen«, gibt Stella nach. »Wann fängt deine Schicht an?«
»Halb fünf.«
»Gut.« Sie knabbert an der aufgerissenen Haut um ihren Daumennagel. »Vor dem Schichtwechsel. Vielleicht treffe ich dann niemanden, der mich kennt.«
»Wäre das denn so schlimm?« Addie umfasst die Tasse mit beiden Händen.
Ihr grüner Nagellack ist so dunkel, dass er beinahe schwarz aussieht, und blättert an beiden Daumen ab. Bei Stella sieht so etwas immer furchtbar aus. Bei Addie dagegen wirkt es auf natürliche Weise cool.
»Ich kann das jetzt einfach nur nicht gebrauchen«, sagt Stella.
»Na ja, es wirkt schon, als könntest du … Und würden sie das mit Onkel Ron nicht verstehen?«
»Das mit Ron?«, fragt Stella. »Natürlich. Aber ich bin keine von ihnen mehr.« Sie schüttelt den Kopf. »Ist auch egal.« Sie erwartet von ihrer jungen Nichte nicht, dass sie versteht, wie der Hase innerhalb der Strafverfolgungsbehörden läuft.
Addie trinkt ihren Kaffee und zieht sich dann für eine Joggingrunde um. Als sie zurückkommt, geht sie duschen und macht sich für die Arbeit fertig. Sie ist komplett in Schwarz gekleidet – üblicherweise Skinny-Jeans und ein schwarzes Oberteil. Heute ist ihr Shirt mit V-Ausschnitt so dünn, dass Stella die Träger ihres Sport-BHs darunter erkennt.
So jung war Stella auch mal. Hübsch und unverbraucht.
Aber in Addies Alter studierte Stella Jura und wurde von einer der größeren Kanzleien in Nashville angeworben. Nach zehn strapaziösen Jahren entschied sie schließlich, dass sie nichts mit der freien Wirtschaft anfangen konnte. Also arbeitete sie etliche Jahre für den Bundesstaat Tennessee in dem Glauben, Leuten vielleicht helfen zu können, bevor sie auf der Suche nach einem Tapetenwechsel ins Los Angeles County zog.
Im Rückblick wünscht sie sich nun, dass sie in der Kanzlei geblieben wäre.
Dann hätte sie jetzt deutlich mehr Geld und Ron nie kennengelernt. Ein Leben ohne den Schock des plötzlichen Verlusts.
Addie sitzt umgeben von Make-up-Utensilien auf dem Boden vor ihrem Ganzkörperspiegel. Stella nimmt auf der Bettkante Platz und beobachtet sie dabei, wie sie Foundation auf ihre ohnehin schon perfekte Haut tupft, dann Concealer aufträgt, gefolgt von Puder, Bronzer und Blush. Mit ein paar wenigen Handgriffen zieht sie sich zwei gleichmäßige Wing-Lidstriche mit schwarzem Eyeliner. Stella verkneift sich den Kommentar, dass Make-up unnötig ist, weil sie es selbst immer gehasst hatte, wenn Leute das früher zu ihr sagten.
»Was ziehst du an?«, fragt Addie und sucht sich ein pinkes Wimperntusche-Fläschchen aus der Make-up-Box, die neben ihrem Knie auf dem Holzfußboden steht.
»Keine Ahnung.«
»Gehst du vorher noch duschen?«, hakt Addie vorsichtig nach.
»Wahrscheinlich.«
»Und du ziehst dir was Richtiges an?«
»Okay. Wink mit dem Zaunpfahl verstanden.«
»Ich denke nur, dass es dir guttun wird, wenn du mal aus dem Haus kommst«, meint Addie. »Und mit jemand anderem als mir redest.«
»Dass ich mit Leuten reden muss, war aber nicht ausgemacht.« Eigentlich war das scherzhaft gemeint, aber es klingt eher nüchtern.
»Du schaffst das schon.« Addie tuscht ihre Wimpern und steckt den Mascara dann zurück in die Box. »Okay, ich muss los. Wir sehen uns dann da.«
Sie gibt Stella einen Kuss auf die Wange, schnappt sich dann ihren Hoodie und ihre Handtasche und ruft auf dem Weg zur Haustür noch über die Schulter: »Und vergiss nicht, dir die Haare zu kämmen!«
Stella steht unter der Dusche und schaut dem Wasser zu, das ihre Füße umspült, bevor es in den Abfluss der Keramikwanne kreiselt. Sie verliert jedes Zeitgefühl und bis sie es schafft, sich die Haare und den Rest ihres Körpers zu waschen, ist es schon fast fünf. In ein Handtuch gewickelt verbringt sie eine weitere Viertelstunde auf ihrem Bett, bevor sie sich schließlich Unterwäsche anzieht. Darüber folgt eine Jeans und ein hellrosafarbener Pullover. Das Haareföhnen spart sie sich und knetet stattdessen etwas Schaumfestiger hinein, damit ihr Haar in goldenen Wellen lufttrocknen kann. Zum Schminken fehlt ihr die Kraft, also beschränkt sie sich auf etwas Feuchtigkeitscreme.
Da ihr Auto mehr als dreckig ist, nimmt sie Rons SUV. Am Spiegel hängt noch eine polizeiliche Parkerlaubnis. Das Innere des Autos riecht noch ein wenig nach Ron, aber sie fährt trotz ihrer Tränen los. Sie ist fest entschlossen, Addie nicht zu enttäuschen, indem sie ihr etwas verspricht und es dann nicht einhält.
Als sie im Parkhaus ankommt, wirft sie einen Blick in den Rückspiegel. Ihre geröteten, geschwollenen Augen lassen sich schlicht nicht verbergen. Sie wischt sich mit dem Ärmel über die Wangen, mit dem Handrücken über die Nase und entscheidet sich dafür, dass ihr das egal ist. In der Bar ist es sowieso so dunkel, dass es keinem auffallen wird.
Es ist Jahre her, seit sie das letzte Mal dort war. Das war vor ihrer Ehe mit Ron, aber alles sieht noch genauso aus wie damals. Die Bartische sind alle besetzt, also wählt sie einen Hocker am Ende des Tresens, direkt an der Wand, hinter der sich die Toiletten befinden. Sie setzt sich mit dem Rücken zum Eingang.
»Was darf es sein?«, fragt eine Männerstimme.
»Ein Glas Merlot. Gerne den Hauswein«, antwortet sie, ohne aufzusehen.
Er mustert sie neugierig. »Sind Sie Addies Tante?«
Ihr Kopf ruckt nach oben. Er ist groß und jung, sieht gut aus. »Ja.«
Er grinst und entblößt dabei perfekte weiße Zähne. »Ich sage ihr, dass Sie da sind.«
»Woher wussten Sie das?«, fragt Stella.
»Sie sehen ihr ähnlich«, erwidert er. »Der Merlot kommt sofort.«
Addie ist noch vor dem Wein bei ihr. Sie schenkt Stella ein Lächeln, ein echtes, das sie übers ganze Gesicht strahlen lässt. Aber als sie näher kommt, verblasst es.
»Du bist da. Ich habe gerade hinten Zitronen und Limetten geschnitten. Geht’s dir gut?«
»Alles okay.« Stella deutet mit dem Kopf in Richtung Gastraum. »Sieht alles aus wie früher.«
»Bist du dir sicher, dass es dir gut geht?«
»Ja, versprochen. Ich bin nur müde.«
»Möchtest du was zu essen? Die Küche hat gerade aufgemacht. Es gibt eine Auswahl zur Happy Hour.«
Der attraktive junge Barkeeper kommt zurück und stellt ein Glas Wein vor ihr auf der blank geputzten Theke ab, bevor er sich einem anderen Gast widmet.
Stella nippt an dem Wein, der wirklich gut schmeckt und definitiv kein Hauswein ist. Es gibt Schlimmeres, als in einer Bar ein ordentliches Glas Wein zu trinken und Addie sieht so hoffnungsvoll aus, dass Stella jetzt nicht einfach abhauen kann. Sie hat es schon bis hierhin geschafft und etwas zu Essen wird sicher nicht schaden. »Vielleicht ein paar Nachos.«
An Nachos ist nichts irisch, aber sie sind hier ja auch in L.A.
Addie nickt. »Die kriegst du.«
Nachdem sie wieder allein ist, sucht Stella nach ihrem Handy, bis ihr aufgeht, dass sie es im SUV gelassen hat. Ihre Handtasche ist voller zerknüllter Verpackungen und Kassenzettel.
Früher hatte sie immer ein Buch dabei, selbst wenn es nur ein billiger Heftroman war, aber diese Angewohnheit hat sie schon vor ihrem Umzug nach Los Angeles abgelegt. Vielleicht sollte sie sich einen Büchereiausweis besorgen. Mal wieder etwas lesen. Sich für eine Weile hinter den Problemen anderer Leute verstecken.
Die Bar füllt sich nach dem Schichtwechsel zunehmend. Niemand kommt hier in Uniform her, aber Stella weiß genau, wer zur Polizei gehört, und erkennt sogar ein paar der Anwesenden, auch wenn sie sich kaum an ihre Namen erinnert. Wahrscheinlich sind auch Staatsanwälte unter den Gästen, aber für gewöhnlich pflegen diese keine sozialen Kontakte zu den Einheiten, mit denen sie arbeiten.
Bis sie ihre Nachos bekommt – einen riesigen Berg davon mit Bohnen, geschmolzenem Käse, Sour Cream und Pico de gallo –, ist der Pub ziemlich voll. Abgesehen von dem Barhocker neben ihrem sind alle Plätze am Tresen belegt.
Der niedliche Barkeeper schenkt ihr nach.
Ihre Anspannung löst sich ein wenig, nachdem sie etwas gegessen hat. Der Wein hilft zusätzlich. Und sie gibt nicht gerne zu, dass Addie recht hatte, aber es fühlt sich gut an, das Haus zu verlassen und was anderes zu sehen als den Drugstore oder Supermarkt.
Addie schaut mit einer kleinen Schale Cocktailkirschen in der Hand vorbei. »Hast du Spaß?«
Es ist inzwischen lauter. Die Leute spielen Songs aus der digitalen Jukebox.
Stella muss Addies Lippen lesen, um sie zu verstehen. »Die Nachos sind lecker«, sagt sie. »Vielleicht war es wirklich eine gute Idee, mal rauszukommen.«
»Hast du schon neue Leute kennengelernt?« Addies Blick wandert durch den Gastraum in Richtung Eingang.
»Für so was bin ich zu alt.« Stella ist vollkommen klar, wie verhärmt sie aussieht. Wer findet so was attraktiv? »Bringst du mir die Rechnung?« Sie steckt sich eine süße Kirsche in den Mund. Sie mildert das Brennen der Jalapeños, die unter die Nachos gemischt waren.
»Ach komm«, meint Addie. »Du zahlst hier nichts.« Sie macht eine wegwerfende Handbewegung und sieht dann erneut zur Tür.
Stella folgt ihrem Blick über die Schulter hinweg, erkennt aber niemanden dort.
»Ich hole dir eine Schachtel für die restlichen Nachos«, bietet Addie an.
»Brauche ich nicht.«
»Du hast gerade mal die Hälfte gegessen.« Addie zieht ein kleines weißes Geschirrtuch aus ihrer Schürze und wischt damit über die Theke. »Den Rest kannst du mit nach Hause nehmen.«
»Vielleicht will ich die nachher nicht mehr.«
»Dann esse ich sie«, sagt Addie. »Warte kurz.«
In diesem Moment schlagen Stellas Instinkte an und sagen ihr, dass etwas nicht stimmt. Im Gerichtssaal war sie gnadenlos und präzise, hat Angeklagten und Zeugen eine Frage nach der anderen gestellt, bis sie die richtige erwischte, um die Lügengeschichte auffliegen zu lassen. Genau dieses Gefühl hat sie jetzt auch, das Verlangen, nach der Wahrheit zu bohren, aber sie ist aus der Übung und das Bedürfnis muss sich durch viele Schichten nach oben kämpfen. Durch das Gespinst aus Apathie und Trauer, in dem sie lebt. Sie braucht ein paar Minuten, um zu begreifen, dass Addie sie anlügt.
Sie weiß nicht, worum es dabei geht – Addie befindet sich auf der anderen Seite des Raums und holt eine To-go-Box, aber sie schaut immer wieder zur Tür.
Als sie schließlich zurückkommt, schiebt sie Stella die Schachtel über die Theke hinweg zu und sieht sich wieder um. Und dann entspannen sich ihre Schultern auf einmal.
Stella dreht sich um, um herauszufinden, auf was Addie gewartet hat. Nicht auf was – auf wen.
Hitze kriecht ihren Nacken nach oben, während sie sich ihrer Nichte wieder zuwendet. »Addison, was soll das?«, faucht sie sie wütend an.
Addie schüttelt den Kopf. »Das hier … das hier ist eine Cop-Bar.«
Stella will von ihrem Hocker rutschen und durch die Hintertür verschwinden, aber es ist zu spät. Captain Elizabeth Murphy kommt bereits auf sie zu. Sie trägt einen schwarzen Bleistiftrock, eine pfirsichfarbene Bluse und schwarze Pumps. Ihre Handtasche hängt über einer Schulter und ihre schulterlangen, rotbraunen Haare sind ordentlich nach hinten gekämmt.
Stella hat sie seit der Beerdigung nicht mehr gesehen und davor schon nicht mehr, seit Stella eine Beförderung angenommen und Captain Murphys Morddezernat verlassen hat. Aber sie erinnert sich noch sehr gut an sie. Auch ohne ihre Uniform vergisst man Elizabeth nicht so schnell. Mit ihren hohen Wangenknochen und faszinierenden grünen Augen sieht sie aus wie eine junge Greer Garson, obwohl Captain Murphy zehn Jahre älter als Stella ist.
Bei der Beerdigung hat sie Stella eine Hand auf den Arm gelegt und ihr Beileid für ihren Verlust ausgesprochen, für den Verlust, den es auch für die Truppe bedeutet. Und dann hat Lieutenant Sam Warren sie weggeführt.
Elizabeth bleibt an der Bar stehen und wirft Addie einen kurzen Blick zu. »Sie haben Ihr nicht gesagt, dass ich komme?«
»Ich dachte … ich … Sie wäre nie …«
»Addie!«, ruft jemand vom anderen Ende des Tresens.
»Tut mir leid«, entschuldigt sie sich und flitzt davon.
»Tja …«, meint Elizabeth und wendet sich Stella zu. »Wie geht es Ihnen denn?«
»Ich …« Panik überrollt sie. »Ich muss los.« Sie schnappt sich ihren Mantel und eilt in Richtung Tür. Die Nachos bleiben vergessen auf der Theke zurück, zusammen mit dem Rest ihres Weins.
»Warten Sie!«, ruft Elizabeth ihr hinterher, aber Stella ist schon durch die Tür und draußen in der kühlen Nachtluft.
Ihr ist schwindelig, als sie wieder in den SUV steigt.
Darin riecht es immer noch nach Ron und sie beginnt erneut zu weinen.
Kapitel 2
Stella hat den ganzen Weg nach Hause geweint. Und im Bad beim Zähneputzen auch. Und dann weint sie sich in den Schlaf. Als sie aufwacht, fühlt sie sich ein bisschen verkatert, taub und merkwürdig neben der Spur. Sie merkt, dass ihr Gesicht geschwollen und die Haut unter ihren Augen empfindlich ist.
Blinzelnd schaut sie in die helle Vormittagssonne – Vorhänge stehen auf ihrer Liste, insbesondere jetzt, wo der Frühling vor der Tür steht und die Tage länger werden. Draußen zwitschern Vögel und aus der Küche dringt das Klappern von Kochgeschirr und Tellern. Sie riecht Speck.
Stella schlägt die Decke zurück und schleicht sich ins Bad. Aber die Rohre sind alt und die Toilette spült laut. Der Wasserhahn quietscht, als sie ihn aufdreht, um sich die Hände zu waschen und die Zähne zu putzen.
Sie mustert ihr Spiegelbild. Ihr Gesicht ist tatsächlich geschwollen. Das, was sie früher mal als attraktiv an sich empfunden hat – helle Haut, lockige blonde Haare, dunkelbraune Augen – lässt sie nun schmal und bleich aussehen. Sie wirkt zunehmend nach außen so, wie sie sich innerlich fühlt.
In der Küche rührt Addie gerade in einem Topf auf dem Herd. Offenbar gibt es frische Biscuits und Gravy und das klassische Südstaatenfrühstück weckt Erinnerungen. Daneben steht gebratener Speck. In einer Pfanne wartet Rührei darauf, serviert zu werden. Die Carters bringen Entschuldigungen immer in Form von Essen rüber.
Addie hat sich die Haare nach hinten geklemmt und trägt Baumwollshorts und einen Kapuzenpullover. Sie sieht Stellas Bruder Thom so ähnlich, aber die Haar- und Augenfarbe hat sie von ihrer Mutter Joyce.
Ihre Nichte wirft ihr einen Blick über die Schulter zu, bevor sie sich wieder der Soße widmet. »Ich hoffe, du hast Hunger.«
Stella mustert sie und das Festessen. »Ich habe immer Hunger.« Ihre Stimme klingt heiser von den Tränen des vergangenen Abends.
Die Anspannung weicht sichtlich aus Addies Schultern.
Stella kann ja nicht ewig sauer auf sie sein. Aber sie will … eine Erklärung.
Addie hat die Post und den restlichen Kram auf dem Küchentisch beiseitegeschoben und ihn mit Tellern und Besteck gedeckt. Das Essen ist gut, aber Addie war schon immer eine gute Köchin. Eigentlich ist sie in allem gut, was sie anpackt. Alle haben sich Sorgen gemacht, als sie nach ihrem Collegeabschluss noch keinen fixen Plan für ihre berufliche Zukunft hatte, aber Stella macht sich da keine großen Gedanken. Addie wird eine gute Barkeeperin werden und falls sie sich irgendwann einen anderen Job sucht, wird sie auch den wunderbar meistern. Und wenn sie sich dafür entscheidet, zu heiraten und ein paar Kinder zu bekommen, wird sie auch zweifellos eine hervorragende Mutter.
»Hör mal …«, setzt Stella zum Sprechen an, nachdem sie fertig gegessen haben.
»Nein«, unterbricht Addie sie. »Es tut mir leid. Ich habe dir zu schnell zu viel aufgedrängt.«
Stella spielt mit ihrer Gabel in dem Rest Gravy auf ihrem Teller herum und beobachtet, wie die Zinken Furchen hineinziehen, die sich gleich wieder schließen. »Honey, du verstehst das nicht.«
»Ich meine, es war meine Idee, also übernehme ich auch die volle Verantwortung dafür. Und ich kann total nachvollziehen, dass jeder auf seine eigene Art trauert und man sich die Zeit nehmen muss, die man braucht. Ich sollte mich da raushalten.« Sie schaut auf ihre Hände, die sie im Schoß gefaltet hat. »Deswegen tut es mir wirklich leid.«
Stella schweigt einen Moment, während sie verarbeitet, was Addie gerade gesagt hat. Bis das gesackt ist, stapelt Addie schon Geschirr im Spülbecken.
»Addie«, meint sie. »Was meinst du damit, dass es deine Idee war?«
»Was?« Sie dreht sich um.
»Du hast gesagt, dass es deine Idee war. Was meinst du damit?«
»Mal aus dem Haus zu gehen«, erwidert Addie.
»Und mich mit Captain Murphy zu treffen?«
»Na ja, es ist … es ist eine Cop-Bar.« Addie verschränkt die Arme vor der Brust. »Du hättest da ja alle möglichen Leute treffen können.«
»Aber du hast die Tür im Auge behalten«, sagt Stella. »Du hast auf Elizabeth Murphy gewartet, oder?«
Addie gießt die übrig gebliebene Soße aus dem Topf in eine Plastikdose.
»Woher kennt ihr euch überhaupt?«, will Stella wissen.
»Wir haben uns auf der Beerdigung kennengelernt. Das weißt du doch.« Addie öffnet eine Schublade und wühlt darin herum. »Gibt es für das Ding auch einen Deckel?«
»Die Beerdigung ist Monate her.«
Addie wühlt weiter, schließt die Schublade dann aber wieder, um die darüber zu öffnen, der sie eine Rolle Alufolie entnimmt.
»Addie!« Stella lässt nicht locker.
Ihre Nichte reißt ein Stück Folie ab und schließt damit die Soßendose. »Wir haben auf der Beerdigung Nummern ausgetauscht. Nur für den Fall der Fälle.«
»Was für ein Fall soll das sein?«
»Keine Ahnung!«, entgegnet Addie. »Ich habe nicht groß darüber nachgedacht. Alle waren so traurig und durcheinander. Ich hatte das mit der Telefonnummer eigentlich ganz vergessen, aber als du deinen Job gekündigt hast, hat sie davon erfahren und mir eine Nachricht geschrieben, um sich nach dir zu erkundigen.«
»Oh Gott.« Stella vergräbt das Gesicht in den Händen.
»Du weißt doch, wie so was läuft. Plötzlich kommt man irgendwie ins Gespräch. Sie ist nett.«
Stella schnaubt spöttisch. »Captain Murphy ist nicht nett.«
Elizabeth Murphy ist eine ausgezeichnete Polizistin, aber auch eine regelbesessene Eiskönigin, die mehr Zeit damit verbracht hat, mit Stella zu streiten, als mit ihr zu arbeiten. Cops und Juristen müssen zusammenarbeiten, aber die Staatsanwaltschaft berücksichtigt inkompatible Persönlichkeiten bei der Zuteilung ihrer Mitarbeiter zum LAPD nicht. Stella war sich bis zum Schluss nicht sicher, ob sie und Captain Murphy nicht miteinander klarkamen, weil sie zu verschieden oder sich zu ähnlich waren. Die Frau war stur, spießig und unnachgiebig. Captain Murphy hielt Stella für manipulativ und Stella sie für unkreativ.
Der Hauptunterschied zwischen ihnen besteht – oder bestand – darin, dass Elizabeth Murphy gut innerhalb der Grenzen arbeiten kann, die das Gesetz ihr vorgibt, und Stella das Gesetz für sich arbeiten lässt. Diese fundamentalen Differenzen in ihrer Herangehensweise konnten sie nie überwinden. Also wurden sie auch nie warm miteinander, warfen sich bissige Kommentare an den Kopf und es entwickelte sich nie eine Freundschaft.
Irgendwann schafften sie es schließlich doch, miteinander zu koexistieren. Fünf Jahre nach Stellas Zuteilung zum Morddezernat gingen sie beinahe nett miteinander um – bevor Stella herausfand, dass Captain Murphy, die regeltreuste Frau, die sie kannte, mit Lieutenant Warren schlief. Das warf sie aus der Bahn und sie fühlte sich sogar ein wenig hintergangen, also bewarb sie sich um eine Beförderung, anstatt darüber nachzudenken, warum sie so empfand.
»Sie scheint sich echt Sorgen um dich zu machen«, meint Addie. »Auf eine sehr nette Art, wenn ich das mal so sagen darf.«
»Du kannst dich nicht mit ihr unterhalten, Addison. Das ist nicht okay.« Stella hatte so hart daran gearbeitet, ihre Familie und Karriere voneinander zu trennen. Bei ihrer Familie war sie einfach nur Tochter, Tante oder Schwester. Im Gerichtssaal galt sie bei ihren Kollegen, gegnerischen Anwälten und Richtern als hartnäckig, sogar aggressiv. Addie weiß nicht, welchen Ruf ihre Tante dort genießt und Stella würde es auch gerne dabei belassen, insbesondere da dieser Teil ihres Lebens vorbei ist. Wenn Addie und Captain Murphy miteinander Zeit verbringen, verschwimmen die Grenzen automatisch irgendwann.
»Ich verstehe nicht, was du gegen sie hast, Tante Stella.«
»Ich will nicht darüber reden.« Es wäre viel zu kompliziert, zu erklären, was sie selbst nicht versteht. Stella lässt die Ereignisse des Abends erneut Revue passieren: den Wein, das Essen, die vertraute Umgebung, die bekannten Gesichter. Das Gefühl, belogen zu werden. »Casey’s ist eine Cop-Bar …«
Addie beißt sich auf die Unterlippe.
»Hat sie dir den Job dort verschafft?«, fragt Stella, der plötzlich ein Licht aufgeht.
Addie nickt.
Und damit geht Stella zurück ins Bett.
* * *
Stella wünschte, sie könnte irgendwo anders schmollen – in einem Büro oder Ferienhaus –, wo ihr jemand eine Tasse heiße Schokolade macht und sie für eine Stunde jammern lässt. Die Ironie dahinter entzieht sich ihr nicht: Sie braucht Freundschaft und deswegen hat sie Addie in ihr Zuhause eingeladen. Aber Elizabeth war nie ihre Freundin. Ihre Beziehung wurde zum Ende hin weniger unterkühlt, ging aber nie über das Berufliche hinaus. So oder so kann Stella auch keine Freundschaft mit ihr aufbauen, weil die Frau etwas an sich hat, das etwas vollkommen Unbekanntes in Stella entfesselt.
In ihrer Gegenwart ist sie nicht sie selbst. Hat keine Kontrolle über ihre Gefühle. Wenn Stella ein Berg Dynamit ist, dann ist Elizabeth ein lichterloh brennendes Streichholz.
Und Stella kann es sich nicht leisten, zu explodieren.
Sie verkriecht sich den ganzen Nachmittag im Bett, starrt auf ihr Handy und döst. Sie ist ständig so müde, egal, wie viel sie schläft. Nachdem sie gehört hat, wie Addie duscht und das Haus verlässt, rafft sie sich auf und lässt sich ein Bad ein, zündet eine Kerze an und macht das Deckenlicht aus.
Sie bleibt lange im heißen Wasser liegen. Als sie den Stöpsel schließlich zieht, ist es draußen beinahe schon dunkel und die flackernde Kerze erhellt den dampfigen Raum um sie herum. Sie wickelt sich ein Handtuch um die Haare und ein zweites um den Körper, bevor sie über den Spiegel wischt, um ihr verschwommenes Spiegelbild darin zu erkennen.
Erst jetzt geht ihr auf, dass sie Elizabeth ja einfach anrufen und ihre ein paar Takte sagen könnte.
»Halten Sie sich von Addie fern«, sagt sie zum Spiegel. Dann wiederholt sie es noch einmal in dem Versuch, ernster und nachdrücklicher zu klingen. »Halten Sie sich von Addie fern!«
Sie putzt sich die Zähne und bürstet ihre Haare. Zieht sich ordentliche Kleidung an – einen BH, einen sauberen Slip und ein knielanges Kleid aus weichem altrosafarbenem Stoff mit kleinen Flügelärmeln. Der Schnitt sieht immerhin nicht wie ein Sack an ihr aus. Dann setzt sie sich an den Schminktisch in ihrem Schlafzimmer und trägt Feuchtigkeitscreme auf ihre Haut auf, tupft sich etwas Concealer unter die Augen, tuscht sich die Wimpern, entscheidet sich für einen Nude-Lippenstift und verleiht ihren Wangen mit etwas Blush eine gesündere Farbe. Sie dreht die langen Strähnen ihres Ponys ein und steckt sie nach hinten fest. Anschließend betrachtet sie ihr Werk. Seit Langem sieht sie wieder ein bisschen mehr aus wie sie selbst.
Damit fühlt sie sich bereit genug, um in der Küche ihr Handy aus der Handtasche zu holen, nur um dabei festzustellen, dass der Akku leer ist. Sie zieht dem Toaster den Stecker – offenbar brauchten die Leute in den 1930ern nicht so viele Steckdosen – und hängt ihr Handy an den Strom.
Als es schließlich wieder genug Saft hat, um sich einschalten zu lassen, scrollt sie durch die Benachrichtigungen, um zu sehen, was sie verpasst hat. Ihr ältester Bruder Brick hat ihr eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, in der er mit ihr schimpft, dass sie nicht ans Telefon geht. Thom hat ihr eine Textnachricht geschickt, in der er sich nach Addies Geburtstag im Mai erkundigt und ob die Familie vielleicht nach L.A. kommen könnte? Außerdem ist da noch eine Nachricht von Addie vom Vorabend, in der sie darum bittet, dass Stella in den Pub zurückkommt.
Sie öffnet ihre Kontaktliste und sucht Elizabeths Eintrag. Ein Bild hat sie nicht eingespeichert, aber die Handynummer und sogar eine Adresse. Jemand – Warren oder Esposito – muss ihr wohl irgendwann die vollständigen Kontaktinfos geschickt haben. Die beiden kannten sie immerhin schon sehr lange.
Stella versucht immer noch, genug Mut aufzubringen, um die Nummer anzutippen, als ihr Display auf einmal blinkend Elizabeths Namen anzeigt. Hat sie draufgedrückt, ohne es zu merken? Doch dann geht ihr auf, dass Elizabeth sie gerade anruft. Was für ein merkwürdiger Zufall.
Der Anruf versetzt Stella einen regelrechten Schock und bringt sie vollkommen aus dem Konzept. Mit einem angespannten »Hallo?« nimmt sie den Anruf an.
»Stella.« Elizabeths Stimme klingt tief und leise und Stella lässt sich gegen die Arbeitsplatte sinken.
»Hi«, erwidert sie dümmlich. Wo ist ihre Wut hin? Ihre Empörung? Elizabeth hat ihr vollkommen den Wind aus den Segeln genommen, indem sie Stella zuerst anruft. Was so typisch für sie ist.
»Ich wollte mich nur kurz bei Ihnen melden«, sagt Elizabeth. »Ich hoffe, dass ich Sie gestern Abend nicht in Verlegenheit gebracht habe.«
»Tatsächlich wollte ich Sie gerade deswegen anrufen.«
»Oh?«
Das Scheinwerferlicht vom Auto ihrer Nachbarn gegenüber fällt durchs Küchenfenster, als diese in ihre Einfahrt einbiegen. »Ich verstehe nicht, warum Sie Kontakt zu meiner Nichte halten, Captain.«
»Ah.« Elizabeth schlägt ihren freundlichsten, nettesten Tonfall an, den sie normalerweise auf Opfer oder trauernde Angehörige von Ermordeten beschränkt. »Sie war nach dem Tod Ihres Manns sehr besorgt um Sie, Stella. Das waren wir alle. Ich habe nur meine Unterstützung angeboten, falls sie sie braucht.«
Stella schnaubt spöttisch und tippt mit den Nägeln auf die geflieste Anrichte. »Sie haben kein Recht, meine Nichte in Ihre Welt aus Mord, Tod und den schlimmsten Menschen der Welt zu ziehen. Sie ist noch ein Kind.«
Elizabeth zieht deutlich hörbar scharf Luft ein. »Ich verstehe, warum Sie das so sehen, aber ich will wirklich nur helfen. Ihr und Ihnen.«
»Klar«, erwidert Stella. »Natürlich.«
»Es war schön, Sie wiederzusehen.« Das ist dann wohl ein Ölzweig, den Elizabeth ihr reicht. »Vielleicht könnten wir uns ja mal zum Essen oder auf eine Tasse Kaffee treffen. Uns auf den neuesten Stand bringen.«
Stella lehnt ihre warme Stirn gegen die kühlen Fliesen. »Das halte ich für keine gute Idee, Captain.«
»Ich verstehe.«
»Ich … Seien Sie einfach vorsichtig bei Addie.«
»Stella …«
»Bis dann.« Stella beendet den Anruf. Legt das Handy weg. Öffnet die Hintertür, um den Kopf in die Nachtluft zu halten und ein paarmal tief durchzuatmen.
Diese Frau tut ihr nicht gut. Überhaupt nicht gut.
* * *
Sie träumt von Ron. Sie sind im Großraumbüro des Morddezernats. Er trägt seine LAPD-Uniform und sie ist noch Captain Murphy zugeteilt. Sie unterhalten sich, bis er sich plötzlich den Bauch hält und sie entsetzt anstarrt. Er hebt die Hände. Sie sind voller Blut.
»Warum?«, fragt er.
Sie schaut auf die Pistole, die sie in den Händen hält und ihr entfährt ein Schrei.
»Alles gut. Es ist alles gut.« Addie rüttelt sie wach.
Stella ist einen Moment lang verwirrt, weil es dunkel ist und das Zimmer nur vom Ganglicht erhellt wird, wodurch sie Addie kaum erkennt.
»Es war nur ein Albtraum.«
Stella ist verschwitzt, ihr ist schlecht und eins ihrer Beine ist in die Quilt-Decke gewickelt. Sie setzt sich ein wenig auf und streicht sich die Haare aus dem Gesicht. »Alles okay. Tut mir leid.«
Addie schüttelt den Kopf. »Möchtest du darüber reden?«
»Nein.« Stella zieht die Knie an die Brust und schlingt die Arme darum. »Ich, hm, erinnere mich an nichts.«
»Okay.«
»Wie spät ist es?«
»Drei.«
Erst jetzt merkt Stella, dass Addie noch ihren Mantel trägt und ihr Make-up verschmiert ist. Ihre Handtasche steht neben dem Bett auf dem Boden. »Bist du gerade erst nach Hause gekommen?«
»Ja. Ich habe abgeschlossen«, erwidert Addie. »Ich wollte gerade … Willst du vielleicht einen Film schauen oder so?«
»Ja«, sagt Stella. »Gern.« Alles ist besser, als wieder einzuschlafen.
Stella nimmt ihren Quilt mit auf die Couch. Addie macht salzig-süßes Popcorn in der Mikrowelle, wie Stella es mag. Sie stellen die große Schüssel zwischen sich und kuscheln sich unter den Quilt. Addie zappt durch die Fernsehkanäle, bis sie eine Romantikkomödie findet. Gerade ist Werbepause.
Stella wirft Addie einen Seitenblick zu. Im Licht des Fernsehers wirkt sie müde und erschöpft. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen.
»Geht es dir gut?«, fragt Stella. »Gefällt es dir hier in Kalifornien?«
Addie schaut sie an. »Ja, ich bin gern hier. Es ist anders. Ich habe die Veränderung gebraucht.«
»Hast du kein Heimweh?«
»Nein. Vielleicht wenn ich alleine wäre, aber ich habe ja dich.« Addie lächelt. »Ich wünschte nur, ich könnte dir mehr helfen.«
»Ich werde einfach noch eine Weile traurig sein, glaube ich. So läuft das eben. Mir ist klar, dass das für dich nicht besonders toll ist.«
»Schon in Ordnung«, meint Addie. »Ich habe Montag frei. Vielleicht könnten wir da ja was zusammen unternehmen. An den Strand fahren oder so.«
»Machen wir.«
Addie wendet sich ein paar Minuten lang wieder dem Film zu, bevor sie wieder das Wort ergreift. »Hast du mit Elizabeth gesprochen?«
»Was?«
»Sie hat gesagt, dass sie dich anrufen und sich entschuldigen will.«
»Wir haben uns unterhalten«, sagt Stella. »Aber wir waren nie Freundinnen. Und ich brauche sie auch jetzt nicht als Freundin, nur weil mein Mann tot ist und sie mich deswegen bemitleidet.«
Addie presst die Lippen aufeinander und senkt das Kinn auf die Brust. »Ich mag Elizabeth wirklich. Und ich kenne hier sonst niemanden. Nicht so richtig.«
»Du kennst mich. Und deine Freunde von der Arbeit …«
Addie schaut Stella abrupt an. »Es ist in Ordnung, wenn du sie nicht magst, aber du hast kein Recht, für mich zu entscheiden, ob ich Zeit mit ihr verbringen darf.«
»Okay«, meint Stella. »Aber halt mich aus der Sache raus.«
Sie schauten den Film weiter, bis Addie sich ins Bett verabschiedet.
Stella bleibt vor dem Fernseher sitzen, bis die Sonne aufgeht. Dann zieht sie sich an und fährt zum Coffee Bean. Dort reiht sie sich in die Schlange der Leute ein, die auf dem Weg zur Arbeit einen Zwischenstopp hier einlegen, und bestellt einen klebrig süßen Kaffee, der eigentlich mehr aus Schokolade besteht. Den Großteil trinkt sie im Auto, in dem sie dann noch eine Weile durch die Gegend fährt, bis sie zu dem Restaurant kommt, in dem sie mit Ron an seinen seltenen freien Vormittagen oft frühstücken gegangen ist. Damals, als sie sich frisch kennenlernten, vor ihrer Hochzeit. Das hat sie bis eben ganz vergessen.
Mit einem Koffeinschub und dem Bauch voller French Toast ist die Bücherei ihr nächstes Ziel. Sie lügt die Frau am Tresen an und behauptet, dass die Adresse auf ihrem Führerschein aktuell ist, und bekommt für ihre Sünde auch prompt einen Büchereiausweis verliehen. Sie streift durch die Regale, stöbert durch die neuen Bücher. Dann greift sie nach einem CIA-Spionageroman, doch die Prämisse ist so albern, dass sie ihn wieder wegstellt und geht, ohne etwas auszuleihen.
Als Nächstes fährt sie zum Supermarkt und kauft Milch und Kaffeesahne, Butter, Brot und Eier. Dinge, die normale Menschen immer im Haus haben. Und sie macht weiter, bis der Einkaufswagen voll ist.
Als sie nach Hause kommt, ist Addie wach und beobachtet sie dabei, wie sie die erste Einkaufstüte hereinbringt. »Wo warst du?«
»Nur ein paar Besorgungen erledigen«, sagt Stella. »Du kannst mir mit den Tüten helfen.«
»Du warst einkaufen?« Addie klingt überrascht.
»Ja.« Verärgerung schleicht sich in Stellas Stimme, aber sie versucht, sie zu verbergen. »Ich dachte mir, dass wir wohl Lebensmittel im Haus haben sollten, wenn du schon für mich kochst.«
Addie scheint ihren Tonfall nicht zu bemerken. »Großartig.« Das klingt absolut ehrlich. Sie geht nach draußen, um zwei Tüten zu holen.
Als nur noch eine Zwölferpackung Coladosen übrig ist, schnappt Stella sie sich und schließt den Kofferraum des SUV.
Sie fährt ihn jetzt doch gelegentlich. Stella kann ihn inzwischen sogar fahren, ohne in Tränen auszubrechen. Tatsächlich schwindet der Duft nach Ron, je öfter sie das Auto benutzt. Und es gefällt ihr, höher zu sitzen – so fühlt sie sich sicher, als würde sie einen großen schwarzen Panzer fahren. Es macht es ihr etwas leichter, das Haus zu verlassen.
Früher hatte sie nie Angst, sich der Welt zu stellen.
Addie hilft ihr beim Auspacken der Einkäufe. Sie hat so viele Cornflakespackungen und Dosenfutter mitgenommen, dass sie einen der Schränke zur Behelfsspeisekammer umfunktionieren müssen.
Die schlaflose Nacht holt sie ein, also entscheidet Stella sich für ein Nickerchen. Als sie wieder aufwacht, geht die Sonne bereits unter und Addie ist weg.
Sie gießt sich ein Glas Wein ein und geht in den Garten, wo sie den Himmel beobachtet, wie er sich von Orange zu Violett färbt und dann in Dunkelheit versinkt, in die sternlose Weite, die in dieser Stadt die Nacht darstellt.
* * *
Am Montag fahren sie nach Santa Monica, essen Fisch-Tacos bei Wahoo’s und gehen dann weiter zum Pier. Sie beobachten die Passanten und bummeln durch die Geschäfte, ohne etwas zu kaufen. Stella bietet eine Karussell- oder Riesenradfahrt an, doch Addie lehnt beides höflich ab.
Einem Besuch des Aquariums stimmt sie allerdings zu und Stella blecht die zehn Dollar Eintritt. Das Gebäude ist klein und ein bisschen altmodisch. Addie wirkt ziemlich gelangweilt, bis sie zu den Quallen kommen. Vor diesem Becken stehen sie lange und beobachten die Tiere. Addies hübsches Gesicht wird vom blauen Licht beschienen und sie wagt sich sogar ans Anfassbecken, was Stella lieber sein lässt. Glitschig und kalt ist nicht so ihre Kragenweite.
»Wie lange braucht man zu dem Aquarium in Monterey?«, fragt Addie, als sie wieder draußen sind. »Das soll doch das schönste hier in der Gegend sein, oder?«
Stella überlegt kurz. »Fünf oder sechs Stunden, denke ich.«
»Wirklich? Mir war wohl nicht klar, wie groß dieser Bundesstaat ist.«
»Wir könnten einen Zwei-Tages-Ausflug machen«, sagt Stella. »Kein Problem.«
Sie suchen sich einen Platz am Geländer des Piers und schauen aufs Wasser hinaus. Addie trägt Jeansshorts, einen blauen Kapuzenpullover und weiße Sneaker. Sie fröstelt ein wenig in der kühlen Brise. »Es gefällt mir hier.«
»Gut. Ich wäre traurig, wenn du wegziehen würdest.«
»Daddy meint, dass ich nächstes Jahr wieder aufs College gehen sollte.« Addie zieht an den Bändeln ihrer Kapuze und klammert sich dann praktisch daran fest. Ihre Faust ruht über ihrem Herzen. »Dann bin ich lange genug hier, damit ich keine zusätzlichen Studiengebühren für den Wechsel in einen anderen Bundesstaat mehr zahlen muss.«
»Welches Fach?«
»Ich habe keine Ahnung!« Addie verdreht die Augen. »Aber ich habe ja noch Zeit, mich zu entscheiden. Mein bisheriger Abschluss ist in Soziologie. Wenn ich irgendwann nicht mehr in der Gastronomie arbeiten will, sollte ich wohl in dieser Richtung weitermachen.«
»Was hat dich an Soziologie interessiert?«
»Ehrlich gesagt habe ich einfach irgendwelche Kurse belegt, um herauszufinden, was ich machen will, bis ich mich irgendwann für ein Hauptfach entscheiden musste.« Addie steckt ihre Haare unter die Kapuze. »Also habe ich mir die Punkte angeschaut, die ich bis dahin gesammelt hatte, und die meisten waren in Soziologie.«
Stella lacht.
»Ich habe wirklich keinen Dunst, Tante Stella. Alle erwarten von mir … Vielleicht liegt es daran, dass ich dir so ähnlich sehe, aber die Familie vergleicht mich ständig mit dir. Weil du die einzige Frau warst und ich das jetzt auch bin, aber du hast immer irgendwo großartige Dinge geleistet. Du hattest immer einen Plan. Ich hatte noch nie einen.«
»Oh, Honey«, sagt Stella. »Ich mache so vieles einfach aus dem Bauch heraus. Glaub mir.«
»Wirklich?«
»Wirklich. Und ich habe jetzt gerade auch keinen Plan, oder?«
»Das ist was anderes. Du trauerst.«
»Und ich weiß, dass das nicht ewig so weitergehen kann, aber es ist so schwer, mich daraus zu lösen.« Sie legt Addie einen Arm um die Schultern. »Wir werden wohl einander helfen müssen.«
»Ja«, stimmt Addie ihr zu. »Ein Neuanfang. Deswegen bin ich hergekommen. Um ganz neu anzufangen.«
Dafür kommen die Leute nach Los Angeles, denkt Stella, und sie fragt sich, was für Addie so schlimm war, dass sie es unbedingt hinter sich lassen will.
Der Wind frischt merklich auf und es wird kälter. Gänsehaut breitet sich auf Addies nackten Beinen aus.
»Besorgen wir uns was Warmes zu trinken«, schlägt Stella vor. »Ich glaube, ich habe da hinten irgendwo ein Café gesehen.«
* * *
Nach dem Ausflug nach Santa Monica versinkt Stella wieder in ihrer Trauer und verschläft den Tag. Am Abend stopft sie in der Küche einen Rest Nudeln, kalte Pizza und eine halbe Schachtel Käsecracker in sich hinein. Sie schnüffelt an einem Karton mit Resten von chinesischem Lieferessen und isst den Inhalt dann, ohne ihn vorher aufzuwärmen, direkt am Spülbecken.
Sie betrachtet ihr jämmerliches Abbild, das sich im Glas des alten Fensters verzerrt widerspiegelt. Die Maklerin hat das Haus als historisches Juwel bezeichnet und ihr die Dielenböden, den Stuck an der Decke, die gepflasterte Terrasse und den Garten hinterm Haus angepriesen.
Aber Historie hat nicht umsonst einen vergleichsweise niedrigen Kaufpreis. Die Fenster mussten ausgetauscht werden. Das Dach ist an mehreren Stellen geflickt. Die Elektrik läuft noch auf einem einzigen Schaltkreis. Das Abwasser wird noch in eine Grube geleitet. Sie hat das Haus trotzdem gekauft, weil sie so sehr in das Viertel zurückwollte, in dem sie vor ihrer Hochzeit gewohnt hat. Als könnte sie damit in der Zeit zurückreisen. Als könnte eine Adressänderung ihren Schmerz lindern.
Vier Tage verbringt sie so niedergeschlagen, bis sie plötzlich um ein Uhr morgens das Bedürfnis verspürt, rausgehen zu müssen. Sie zieht sich eine dreckige Jogginghose und Addies schwarzen Hoodie über. Schlüpft in Flipflops und schnappt sich ihre Schlüssel.
Sie fährt zwei Blocks und parkt vor ihrem alten Haus. Dort betrachtet sie den weißen Hyundai und den alten, verbeulten Toyota, die in der Einfahrt stehen.
Wem sie das Haus verkauft haben, weiß sie nicht mehr, und außerdem könnten da jetzt inzwischen auch ganz andere Leute wohnen. Um solche Sachen hat Ron sich gekümmert. Sie war immer zu beschäftigt, wurde oft bei Gericht aufgehalten und wollte ihren Terminkalender nicht für etwas Banales wie den Verkauf einer Immobilie umplanen.